Besser Unrecht leiden als Unrecht tun

Die Christen des 21. Jahrhunderts leben im Westen in Staaten, die sich als liberale Demokratien verstehen. Deren politische Institutionen sind deshalb, anders als im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, nicht mehr oder nur noch in Restbeständen vom christlichen Glauben geprägt. Bei den Moralvorstellungen wird dies besonders deutlich. Plakativ könnte man sagen, die liberalen Demokratien seien „permissiv“: Sie erlauben nicht gerade alles, aber sehr viel.
Das Mittelalter und die Frühe Neuzeit erscheinen dagegen als „repressiv“. Denn damals wurden vom Christentum abweichende Meinungen und Verhaltensweisen nicht selten unterdrückt durch Zensur, Verbannung oder gar durch den Scheiterhaufen. Man wollte im Namen des rechten Glaubens dem „Irrtum“ in Staat und Gesellschaft kein Existenzrecht zubilligen. Dafür verbündete sich die Kirchenhierarchie mit der weltlichen Gewalt, um dem christlichen Glauben im Leben der Menschen zur Durchsetzung zu verhelfen.
Zu den langfristigen Konsequenzen dieser Politik gehören eine religionsfeindliche Aufklärung und schließlich die Französische Revolution. Beides prägt den Westen bis zum heutigen Tag zutiefst. Und man kann sich – jenseits einer moralischen Beurteilung – fragen, ob die mittelalterliche Allianz von Thron und Altar der Verbreitung des Evangeliums langfristig mehr genützt als geschadet hat.
Unkraut und Weizen: Zwang widerspricht dem christlichen Glauben
Wie auch immer: Die repressiven katholischen – und evangelischen – Herrscher wurden gestürzt. Damit wurde auch der Einfluss der Kirche beschnitten. Sie kann nicht mehr erwarten, dass der Staat die Geltung ihrer Glaubensinhalte und die Lehre ihrer Moral notfalls mit Zwang durchsetzt. Die allen bekannte Folge besteht darin, dass liberale Demokratien heute die Präsenz zahlreicher Religionen und Weltanschauungen erlauben, auch die Ehescheidung, „Homo-Ehe“, pränatale Selektion, Abtreibung, Suizidbeihilfe, etc.
Zweifellos werden durch den liberal induzierten Individualismus auch Ehe und Familie unterminiert. Die Geburtenrate ist im Keller, und der Liberalismus droht sich damit letztlich selbst abzuschaffen. Denn die Menschen, die der zusehends entvölkerte Westen importiert, um die Löcher im Humankapitel zu füllen, lehnen den Liberalismus zu guten Teilen ab und werden ihn abschaffen, wenn sie dazu Gelegenheit erhalten.
Der neuzeitliche Liberalismus hat uns persönliche Freiheit, technischen Fortschritt und Wohlstand gebracht. Dafür sollten wir dankbar sein. Niemand will diese Errungenschaften missen. Aber man kann gleichwohl an der (links-)liberalen Zersetzung dessen, was das christliche Humanum ausmacht, als Christ keine Freude haben. Allen via Staat, notfalls mit Zwang, den christlichen Glauben und die damit zusammenhängenden moralischen Gebote aufzuerlegen, kann aber nach den gemachten Erfahrungen auch nicht die Lösung sein. Vor allem muss man festhalten: Zwang widerspricht dem christlichen Glauben selbst. Und das Gleichnis Jesu vom Unkraut und vom Weizen, das am Schluss dem Herrn das Urteil über Wahrheit und Irrtum überlässt, gilt auch heute noch (Mt 13,24-30).
Die frühen Christen fielen auf durch das, was sie nicht taten
Ein Blick in die Geschichte offenbart, dass die Welt nicht immer so gewesen ist, wie sie im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit bestanden hat. Diese Epoche ist weder alternativlos noch kann sie als alleingültiges Modell postuliert werden, an dem unsere Zeit zu messen ist. Denn es gab bereits einmal eine Zeit, als die Christen nicht die Gesetze im Staat diktierten. Sie lebten schon einmal in einem „permissiven“ Staat. Es waren die ersten Jahrhunderte der Christenheit. Das Verhalten der damaligen Christen kann deshalb für das Heute eine Inspirationsquelle sein.
Im Römerreich fielen die Christen zuerst einmal nicht so sehr dadurch auf, was sie taten, sondern dadurch, was sie nicht taten. Sie schöpften nämlich das, was der permissive Staat erlaubte oder gar propagierte, einfach nicht aus. Konkret: Christen besuchten keine Zirkusspiele, wo zum Spaß Menschen getötet wurden. Sie hielten sich von Thermen und anderen Orten der Prostitution fern. Den heidnischen Götzenkult mieden sie. Die Ehescheidung, die erlaubt war, praktizierten sie nicht.
› Lesen Sie auch: Edle Antike – moralinsaures Christentum?
Sie übten auch bestimmte Berufe nicht aus. In einem Katalog für Taufbewerber aus dem frühen 3. Jahrhundert, in der „Traditio apostolica“, heißt es: „Wenn jemand Bildhauer ist oder Maler, muss man ihn darüber belehren, keine Götzenbilder anzufertigen. Entweder hört er damit auf, oder er wird zurückgewiesen.“ Auch Tätigkeiten als Gladiator, Sänger und Darsteller von Gottheiten waren unvereinbar mit dem Empfang der Taufe. Lehrer zu sein, konnte ebenfalls problematisch sein, solange damit die Vermittlung des polytheistischen Götterglaubens verbunden war. Ebenso gestaltete sich anfänglich die Ausübung öffentlicher Ämter als heikel, weil sie zum Götzendienst verpflichtete.
Es ist der Brief an Diognet aus dem 3. Jahrhundert, der die Praxis der Christen zusammenfasst. Von ihnen heißt es, dass sie „weder durch Heimat noch durch Sprache und Sitten von den übrigen Menschen verschieden“ seien und sich „der Landessitte in Kleidung, Nahrung und in der sonstigen Lebensart“ fügten. Also: keine Ghettos, sondern solidarisches Zusammenleben mit allen Menschen in den bürgerlichen Angelegenheiten. Aber es hat dann auch gegolten: „Die Christen heiraten wie alle andern und zeugen Kinder, setzen aber die Geborenen nicht aus“ – das Aussetzen von Säuglingen war das Äquivalent zur heutigen Abtreibung.
Der Diognetbrief bringt schließlich das, worum es geht, mit einem Satz auf den Punkt, wenn er von der Haltung der Christen gegenüber den Mitmenschen sagt: „Sie haben gemeinsamen Tisch, aber kein gemeinsames Lager.“
Erst als der Staat illiberal wurde, begann für Christen das Martyrium
Die Christen reagierten auf den „liberalen“ Staat somit positiv, aber auch selbstbewusst, indem sie bürgerliche Rechte, die ihnen zustanden, nicht wahrnahmen. Das war eine zugleich „marktwirtschaftliche“ und liberale Politik im permissiven Staat. Denn wenn mit dem Anwachsen der Zahl der Christen heidnische Praktiken wie die Zirkusspiele oder die Götzenverehrung keinen Markt mehr hatten, wurden sie irgendwann aufgegeben. Das Töten und die Aussetzung von Säuglingen kamen auf die gleiche Art und Weise außer Übung. Ebenso verloren gelebte Homosexualität und Päderastie die gesellschaftliche Anerkennung. Nicht politisch, via Staatsmacht, wurde also viel Widerchristliches beseitigt, sondern zivilgesellschaftlich.
Die Christen gingen erst dann auf die Barrikaden, als der Staat illiberal wurde. Denn das antike Rom gab sich nicht mehr damit zufrieden, dass sich die Christen von Praktiken wie der Götterverehrung enthielten. Vielmehr übte der Staat nun Zwang aus, indem er verlangte, dass der Kaiser als Gottheit zu verehren sei. An diesem Punkt fing das Martyrium der Christen an. Es wurde – wie Tertullian bemerkt – zum Samen der Christenheit.
› Lesen Sie auch: Katholisch, intelligent und liberal?
Dieses Handeln der Christen lässt sich in die heutige Zeit übertragen. Das bedeutet nicht, dass christliche Bürger nicht auch versuchen sollten, durch die Wahrnehmung ihrer politischen Rechte auf die Ausgestaltung der Staatsgesetze Einfluss zu nehmen. Dies ist Teil der Kohärenz, die man als Christ lebt. Dabei wird es jedoch auch heute schwierig sein zu bestimmen, wo eine – im Moment hypothetische – Mehrheit von Christen gesetzgeberische Zurückhaltung üben müsste, um den gesellschaftlichen Frieden zu erhalten. Anders formuliert: Die Christen müssten, um den Bürgerkrieg zu verhindern, als staatliche Gesetzgeber selbst in bestimmten Fragen „permissiv“ sein, also Dinge erlauben, die sie eigentlich vom eigenen Glaubensverständnis her ablehnen.
Auch heute müssten Christen wieder lernen, nicht das zu tun, was alle tun
Aber unabhängig von dieser Frage, die sich nicht abschließend klären lässt und die sich sowieso auf absehbare Zeit – zumindest im deutschsprachigen Raum – kaum stellen dürfte, geht es zunächst um etwas anderes: Auch heute wäre nicht zuerst das Tun, sondern das Nicht-Mittun gefragt. Christen müssten zuerst einmal wieder verstärkt lernen, dass das zu tun, was alle tun, nicht der Maßstab des Christen ist.
Schon in den alten Zeiten hat Johannes Chrysostomus den Gläubigen gesagt:
„Führe mir nicht die Gesetze an, die von denen erlassen sind, die draußen sind. Gott wird dich an jenem Tag nicht nach diesen Gesetzen richten, sondern nach denen, die er selbst erlassen hat.“
Es ginge also heute darum, dass ein Christ weiß und sich sagt: Abtreiben, Scheiden, eine Homo-Ehe eingehen, anderen beim Suizid behilflich sein, sich selbst umbringen, vorgeburtliche Selektion betreiben, etc., etc.: Das tut ein Christ einfach nicht. Der permissive Staat erlaubt es zwar, viele tun es. Aber ich tue es nicht. Das wäre die „marktwirtschaftliche“ Antwort auf die vom Staat zugelassene freie Marktwirtschaft in moralischen Fragen.
Bischöfe sind noch nicht in der liberalen Demokratie angekommen
In der liberalen Demokratie kommt dem kirchlichen Lehr- und Hirtenamt der Bischöfe sowie des Papstes eine wichtige Rolle zu. Sie können nicht mehr – wie dargelegt – mit dem Staat die Durchsetzung christlich geprägter Gesetze aushandeln. Ihre Aufgabe besteht nun mehr denn je darin, die Gläubigen in der nicht einfachen Lage, in der sie sich im liberalen Staat befinden, tatkräftig zu unterstützen. Dies geschieht zuerst durch die Seelsorge und die Spendung der Sakramente. Aber auch unverkürzte Glaubensverkündigung, unter Einschluss ihrer ethischen Folgerungen, sowie mutiges persönliches Zeugnis wären gefragt.
› Lesen Sie auch: Hasenangst
Stattdessen wird die Glaubenslehre ausgerechnet von vielen Bischöfen verraten, gerade im deutschsprachigen Raum. Um die drei oder vier Ausnahmen aufrechter Bischöfe sind Christen äußerst dankbar. Es geht jedoch dem überwiegenden Teil der Bischöfe im deutschsprachigen Raum darum, gesellschaftlich mehrheitsfähig zu bleiben, um die Kirchensteuer zu erhalten und um weiterhin ihre rechtlichen Privilegien zu genießen.
Dieses Verhalten zeigt, dass sie noch nicht in der liberalen Demokratie angekommen sind, sondern immer noch im Mittelalter-Modus denken und die letzten Relikte aus dieser Zeit – die Staatfinanzierung der Kirche und deren staatsähnlichen Charakter – zu bewahren versuchen. Sie geben sich progressiv und sind doch nur zurückgeblieben.
„Gott kann nicht gerettet werden durch den Teufel“
Das alles ist nicht neu. Schon Heinrich Heine hat diesen Geist bei den alten Jesuiten erkannt. Er bezieht sich damit auf die Jesuiten, die Blaise Pascal in den „Lettres provinciales“ in der Mitte des 17. Jahrhunderts kritisiert hat. Pascal hat ihnen vorgeworfen, mit demagogischen Sophismen die kirchliche Morallehre zu unterminieren, um die Kirche bei den Mächtigen angenehm zu machen. Über diese vermeintlich schlauen Jesuiten schreibt Heine in „Die romantische Schule“ (1833; vgl. 2. Buch, III., letzter Abschnitt):
„Nie hat der menschliche Geist größere Kombinationen ersonnen als die, wodurch die alten Jesuiten den Katholizismus zu erhalten suchten. Aber es gelang ihnen nicht, weil sie nur für die Erhaltung des Katholizismus und nicht für den Katholizismus selbst begeistert waren. An letzterem an und für sich war ihnen eigentlich nicht viel gelegen; daher profanierten sie zuweilen das katholische Prinzip selbst, um es nur zur Herrschaft zu bringen; sie verständigten sich mit dem Heidentum, mit den Gewalthabern der Erde, beförderten deren Lüste“ (…).
Wo es darauf angekommen sei, seien sie sogar zu Atheisten geworden. Aber vergebens hätten ihre Beichtväter die „freundlichsten Absolutionen“ erteilt. Und vergeblich sei es gewesen, dass ihre Kasuisten mit jedem Laster und Verbrechen gebuhlt hätten. Vergebens hätten sie mit den Laien in Kunst und Wissenschaft gewetteifert, um beide als Mittel zu benutzen. Fruchtlos sei all ihr Tun und Wirken gewesen. Denn aus der Lüge könne kein Leben erblühen.
Und Heine schließt: „Gott kann nicht gerettet werden durch den Teufel“.
Die Anbiederung bei Postchristen ist nutzlos
Die zeitgenössischen Wiedergänger der alten Jesuiten wollen in diesem Sinn ein staatskirchliches Setting, das aus einer Zeit stammt, die es nicht mehr gibt, erhalten. Nicht um den katholischen Glauben als solchen geht es ihnen dabei, sondern um den Erhalt von dessen Strukturen. Dies ist die Motivation, um gegenüber der Unterminierung von Ehe und Familie zu schweigen. Diese Bischöfe entbinden ihre Laienmitarbeiter davon, nach der kirchlichen Ehemoral zu leben. Den Postchristen biedern sie sich mit der Forderung nach der Priesterweihe der Frau und der Abschaffung des Zölibats an.
Sie geben sich regierungstreu und propagieren lieber das links-grün-regenbogenfarbene Gutmenschentum, anstatt gegen Abtreibung, Pränataldiagnostik, Suizidbeihilfe, Leihmutterschaft und Homo-Ehe Stellung zu beziehen. Denn dadurch würden sie sich der Kritik und dem Spott der Postchristen auszusetzen. Diese wiederum könnten mit Liebesentzug – mit dem Entzug von staatlichen Privilegien – antworten.
Verhalten solcher Art erschwert es den Christen, sich dem postchristlichen Mainstream entgegenzustellen. Denn sie befinden sich dann ja nicht nur im Widerspruch zu diesem, sondern auch zum eigenen Episkopat. Wie dieser auf die Idee kommen kann, Postchristen würden durch seine anpasserische Politik der Kirche gewogen bleiben, wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Denn wenn die Kirche gutheißt, was die Postchristen tun, fühlen sich diese in ihrer Meinung von der Kirche bestätigt. Warum also sollten sie umdenken?
Als Christen Zeugnis geben – ein Zeugnis, das in der Ehe anfängt
Bei weitem nicht überall in der Weltkirche herrschen jedoch Verhältnisse wie in den deutschsprachigen Ländern. So gibt es viele Bischöfe, ganze Bischofskonferenzen, welche die Gläubigen in ihrem zivilgesellschaftlichen Einsatz ermutigen. Sie unterstützen sie durch eine klare Verkündigung darin, unterscheidend christlich zu leben. Und es ist offensichtlich, dass die Kirche in solchen Ländern besser gedeiht, zum Teil sogar blüht.
Damit die Christen nicht einfach mittun, was alle tun, reicht das unerschrockene Zeugnis der kirchlichen Hierarchie allerdings nicht aus. Es bedarf darüber hinaus einer Stützung der Gläubigen unter sich. Das fängt in einer christlichen Ehe zwischen den Ehepartnern an. Es zeigt sich in einer Vielzahl zivilgesellschaftlicher Initiativen. Das können Schulen und Kindergärten sein, hinter denen christliche Eltern stehen. Es gibt auch Gesundheitseinrichtungen, die nach christlichen Grundsätzen handeln.
› Lesen Sie auch: Die sieben Todsünden der westlichen Welt

Und selbst dann, wenn der Staat inzwischen übergriffig fordert, dass Suizidbeihilfe in kirchlichen Einrichtungen erlaubt sein muss, findet sie dort gleichwohl nicht statt. Denn wenn alle im Heim Christen sind, wird niemand den Giftmischer anfordern, und dann kommt er auch nicht. Zu erwähnen sind hier auch die Vereinigungen christlicher Juristen, die mit den Mitteln des Rechtsstaats, gestützt auf die Grundrechte, Christen vor Gerichten verteidigen gegen woke Aktivisten und ihre Verbündeten im Justiz- sowie im Staatsapparat.
Lehramtstreue Priester, private Medien, Pro-Lifer stören den faulen Frieden
Die Pro-Life-Bewegung mit ihren Initiativen und Unterstützungsangeboten gehört ebenfalls zu den bedeutsamen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten von Christen. Vielen Bischöfen in den deutschsprachigen Ländern ist dieses Engagement von Laien peinlich bis lästig, weil es den faulen Frieden mit dem postchristlichen Mainstream stört. Auch Christen, die auf Christenverfolgungen aufmerksam machen – diejenige in islamischen Ländern, aber auch die inländische mit freundlichem Gesicht durch linksgrün-woke Aktivisten – laufen der bischöflichen Appeasement-Politik zuwider. Man darf sich jedoch davon nicht entmutigen lassen und sollte solche christlich-zivilgesellschaftlichen Initiativen weiter vorantreiben.
› Lesen Sie auch: „Ihr seid die Lösung!“

Nicht zuletzt sind Medien, die von katholischen Laien gegründet und geleitet werden, von großer Bedeutung. Sie stehen – vor allem im deutschsprachigen Raum – oft im Gegensatz zu den von der Hierarchie kontrollierten Medien. Diese müssen der Politik folgen, die auf den Erhalt der staatskirchlichen Privilegien ausgerichtet ist. Deren Mitarbeiter tun dies darüber hinaus auch aus Eigeninteresse, weil sie weiterhin von der Kirchensteuer profitieren wollen. Mediale Privatinitiativen von Laien können demgegenüber unverkürzt zur kirchlichen Glaubenslehre stehen. Sie sind damit eine nicht zu unterschätzende Stütze vieler Gläubiger, die so aus der Vereinzelung geholt und ermutigt werden, nicht einfach dem gesellschaftlichen Mainstream zu folgen.
Und was man auch nicht unterschätzen darf: Zivilgesellschaftliche Initiativen, gerade im Medienbereich, helfen Priestern, die am ganzen Lehramt der Kirche festhalten und die deshalb unter dem Druck ihrer Bischöfe und Ordinariate stehen. Denn auch diese Seelsorger stören durch ihr Zeugnis die regierungstreue Politik der Staatskirche. Private christliche Medien bieten hier Unterstützung, indem sie über die wahren Zustände in der Kirche Öffentlichkeit schaffen und indem sie immer wieder an das erinnern, was weltkirchlich gilt.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Bei all diesen Initiativen zeigt sich, dass die freie, offene Gesellschaft für Christen auch ihre Vorteile hat, weil sie Freiräume schafft, die es unter autoritären Regimen nicht gibt. Die liberalen Freiheitsrechte haben in der Kirche zudem paradoxerweise die Funktion eines Schutzschilds erhalten. Denn sie erlauben es vor allem Laien, sich dem regressiven und manchmal repressiven Kurs ihrer Bischöfe zu entziehen, die Teile der kirchlichen Lehre verschweigen sowie bekämpfen und die versuchen, diesen Kurs der Kirche in ihren Diözesen aufzuzwingen. Staatlich garantierte Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist für sie eine Grenze, die sie nicht zu überschreiten vermögen.
Ein permissiver Staat steht in der Gefahr, repressiv zu werden
Es ist allerdings auch klar, dass ein permissiver Staat stets in der Gefahr steht, repressiv zu werden. Schon im alten Rom war das – wie dargelegt – der Fall. Die von Kardinal Ratzinger vor seiner Wahl zum Papst im Jahr 2005 angeprangerte „Diktatur des Relativismus“ steht heute vor der Tür. Die Diktatur des Relativismus war in den ersten Jahrhunderten Realität. Denn der Staat verlangte damals von den Christen nicht so sehr das Abschwören vom Christentum. Vielmehr ging es – im Sinne des Relativismus – darum, dass die Christen die herrschende Staatsreligion zu ihrem Glauben dazunehmen sollten.
Ähnliches geschieht heute. Wir sollen uns als Christen nicht mehr unterscheiden dürfen, indem wir gewisse Dinge nicht tun. So gleicht es schon seit mehr als zwei Jahrzehnten einem Spießrutenlauf, wenn christliche Gläubige Gynäkologin oder Hebamme werden wollen. Der Zwang, an Abtreibungen mitzuwirken, bringt sie der Lage der ersten Christen nahe, die bestimmte Berufe nicht ausüben konnten.
Auch Lehrer zu sein, kann wieder problematisch werden. In der Schweiz wurde kürzlich ein Pädagoge an einem staatlichen Gymnasium gekündigt, weil er sich geweigert hat, einen Schüler, der sich zur Frau umdefiniert hatte, gemäß dem neuen, frei erfundenem Geschlecht als Frau anzusprechen – Biologie und Naturwissenschaft hin oder her. Das oberste Schweizer Gericht (Bundesgericht), das immer offensichtlicher christianophob agiert und die Religionsfreiheit dem Dogma des Wokeismus nachordnet, hat diese Entlassung gutgeheißen. Es entfremdet durch solche neuartige Christenverfolgung die Christen dem Staat und der liberalen Demokratie.
Das Leiden – in dieser Welt und Zeit unvermeidlich
Es kann also auch heute wiederum das Martyrium geben. Der zivilisatorische Fortschritt dürfte es inzwischen mit sich bringen, dass nur noch Druckerschwärze und kein Blut mehr fließt. Und es wird nicht mehr der Kopf abgeschnitten, sondern „nur“ noch die Ehre. Bedroht wird nicht mehr das Leben, sondern „nur“ noch die wirtschaftliche Existenz. Dieses unblutige Martyrium ist aber auch heute ein Same der Christenheit. Denn es entlarvt postliberal-woke Staaten als Verächter der Freiheit. Und es zeigt immer mehr Menschen, dass der christliche Glaube eine befreiende Wirklichkeit ist.
Wie erwähnt, gab es auch im Mittelalter Verfolgungen – sozusagen spiegelverkehrt zur Situation von heute: Nichtchristliche Abweichler hatten damals zu leiden. Heute leiden Christen in Staaten, die formell liberal, aber vom Wokeismus infiziert sind. Das Leiden scheint in dieser Welt und Zeit unvermeidlich zu sein, denn es gibt nicht den perfekten Staat für alle. Es stellt sich allerdings die Frage, was dem christlichen Glauben angemessener ist. Wenn wir auf unseren Herrn Jesus Christus schauen, müssen wir sagen: Es ist besser, Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun.




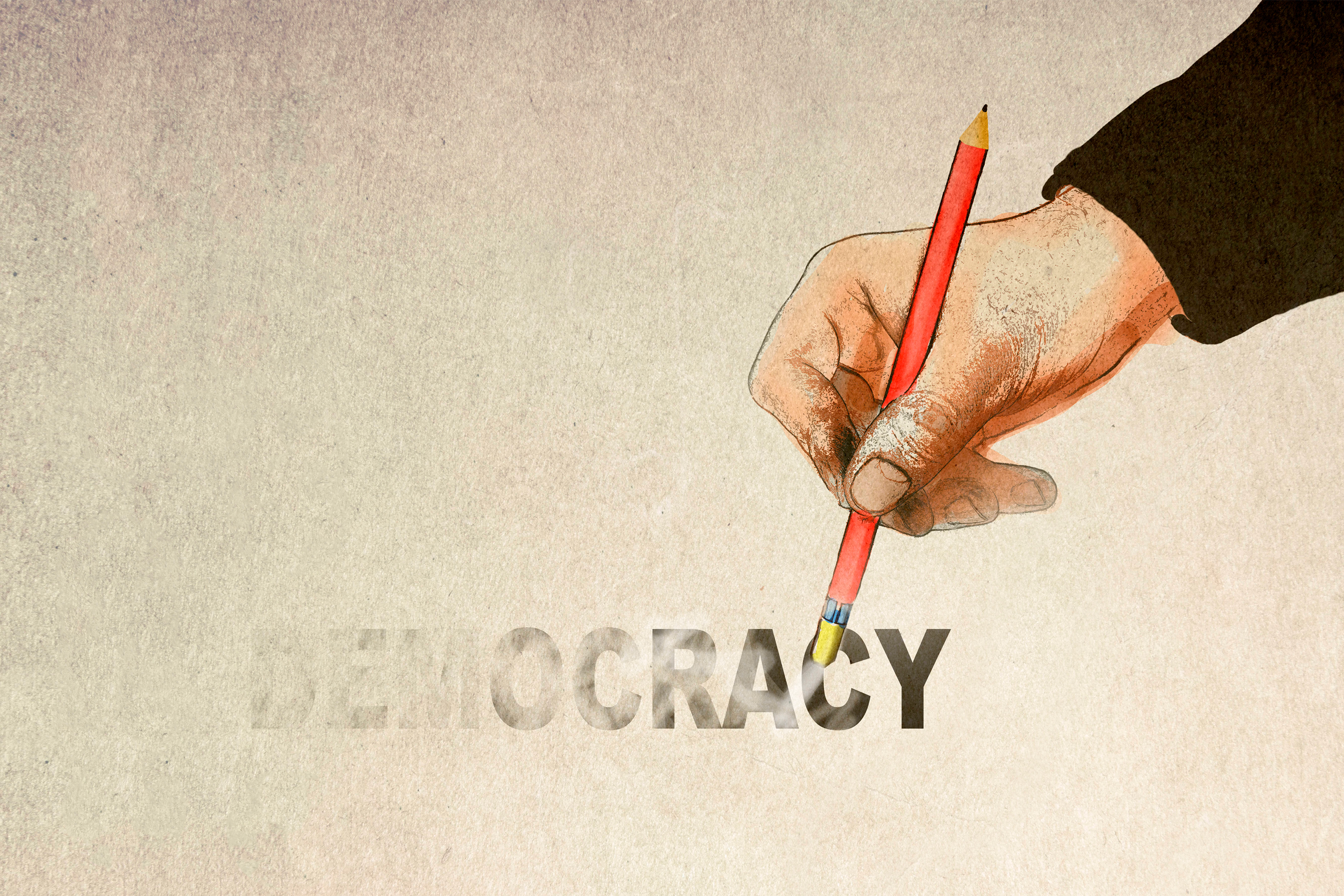
Kommentare
Ich bin kein ausgesprochener Freund von groß angelegten historischen Vergleichen, da solche zwangsläufig sehr holzschnitzartig sind, doch ist dem Anliegen von Herrn Grichting voll zuzustimmen: den Zustand einer bestimmten Epoche der Vergangenheit oder, ergänzend, die Volkskirchlichkeit der Zeit von ca. 1850-1950 als ideal hinzustellen, führt uns Christen letztlich in die Irre.
Die Kirche im Sinne einer beamtenmäßigen Struktur macht in Deutschland denselben Fehler wie etliche andere Institutionen, wie z. B. Gewerkschaften: während eine echte plurale Demokratie forderte, dass jeder Akteur sein Weltbild oder seine religiösen Überzeugungen in die Debatte einbringt und via Parteien und Parlament um Mehrheiten für seine Anliegen wirbt, predigen im Demokratismus (Begriff nicht von mir) heutiger Prägung alle miteinander denselben permissiven Vielfalts-Einheitsbrei.
Die Tatsache, dass wir im öffentlichen Raum Kompromisse mit anderen gesellschaftlichen Gruppen eingehen müssen, heißt nicht, dass wir unsere Glaubensüberzeugungen aufgeben sollen.
Das ist der "Dritte Weg" neben reaktionärem Traditum und modernistischen Häresien, der mir dazu noch am gangbarsten erscheint. Dieser Beitrag könnte die Basis weiterer Gedanken und Taten sein, die den Okzident retten könnten.
@Veritas Das ist der "Dritte Weg" neben reaktionärem Traditum und modernistischen Häresien...
Sehe ich auch so.