„Grundsätzlich zählt jedes einzelne dieser Leben“

Der Fall des Mediziners Joachim Volz aus Lippstadt hat im Sommer bundesweit Aufmerksamkeit erregt und abermals die Debatte um Abtreibungen befeuert: Nachdem das Evangelische Krankenhaus, an dem Volz jahrelang als Chefarzt wirkte, von einem katholischen Träger übernommen wurde, untersagte ihm dieser die Durchführung medizinisch indizierter Schwangerschaftsabbrüche.
Der Fall rückte erneut die Thematik der Schwangerschaftsabbrüche in den Fokus, die nach dem mühsam ausgehandelten „Abtreibungskompromiss“ in den neunziger Jahren zwar formaljuristisch befriedet wurde, doch durch die anhaltend hohe Zahl von Abbrüchen eine schmerzende Wunde unserer Gegenwart bleibt. Zudem unternahm die gescheiterte Ampel-Regierung mehrere Vorstöße, den Kompromiss in vermeintlich progressiver Richtung wieder aufzukündigen.
Corrigenda hat in einem ausführlichen, zweiteiligen Interview Professor Alexander Scharf-Jahns, einem renommierten Experten für Pränatalmedizin, Gelegenheit gegeben, die juristischen, medizinischen und ethischen Facetten dieses Konflikts anzusprechen und auszuleuchten. Mit fast 40 Jahren Erfahrung in seinem Fachgebiet bietet der Mainzer sowohl aus der Perspektive des niedergelassenen Arztes wie des Wissenschaftlers nicht immer bequeme Einblicke in die Eigenheiten der einschlägigen Gesetzeslage in Deutschland und die Alltagsrealitäten der pränatalmedizinischen Versorgung von Menschen in einer Ausnahmesituation.
Herr Professor Scharf-Jahns, ein Arzt im westfälischen Lippstadt, Joachim Volz, hat vor Gericht verloren, nachdem er gegen die Weisung seines katholischen Arbeitgebers geklagt hatte, der ihm Abtreibungen nach medizinischer Indikation untersagt beziehungsweise nur noch in Ausnahmesituationen erlaubt hatte. Er ist jetzt in die nächste Instanz gegangen. Er argumentiert damit, dass durch diese Weisung Frauen Hilfe verwehrt und Ärzte kriminalisiert würden. Können Sie diese Sichtweise nachvollziehen?
Grundsätzlich kann ich als Mensch und Arzt sehr gut die Sichtweise und Betroffenheit von Professor Volz, der gegen die Weisung seines katholischen Arbeitgebers klagt, medizinisch indizierte Schwangerschaftsabbrüche zu untersagen, aus seiner speziellen persönlich-biografischen Perspektive heraus nachvollziehen.
Nach 13 Jahren Durchführung solcher Abbrüche am Evangelischen Klinikum Lippstadt, dessen Perinatalzentrum von regional herausragender Bedeutung ist, sieht er die neue Weisung des fusionierten katholischen Klinikums als Eingriff in seine ärztliche Autonomie und als Verschlechterung der Versorgungsqualität für Schwangere, die sich bisher in der Notsituation, ein erkennbar schwerstkrankes Kind zu tragen, an ihn wenden konnten. Der Fall hat mediale Aufmerksamkeit erregt und steht im Kontext der gesellschaftlichen Debatte um die Abtreibungsgesetzgebung, die seit 30 Jahren weitgehend unverändert ist.
Primärer juristischer Bewertungsmaßstab ist hier jedoch nicht Ethik und Moral, sondern die Gesamtheit der versorgungs- und sozialrechtlichen Regularien, und diese beginnen und enden längst nicht beim Paragrafen 218 allein: Rein rechtlich ist die Weisung des Trägers, wenn ich die Sachlage richtig verstehe, wohl zulässig, da der Träger des Krankenhauses gemäß Paragraf 12 Absatz 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz bestimmen kann, dass in seiner Einrichtung keine Abbrüche vorgenommen werden, außer natürlich in Notfällen. Es gibt insoweit bei einem Trägerwechsel keinen grundsätzlichen rechtlichen Anspruch auf die Fortführung solcher Eingriffe, weder für Ärzte noch für die Patienten.
Die Versorgungslage in Deutschland zeigt, dass medizinisch indizierte Abbrüche – wir sprachen schon von den circa 4.000 solcher Abbrüche pro Jahr – meist in spezialisierten Zentren erfolgen, wobei die Kapazitäten in einer bundesweiten Makrobetrachtung, festzumachen an den konstanten Abbruchzahlen der letzten 15 Jahre, insgesamt ausreichend scheinen. Regional, also im Kreis Soest, könnte die Weisung jedoch die Versorgung erschweren. Ob hier gegen objektivierbare Standards einer Gerechtigkeit, Billigkeit oder Verhältnismäßigkeit verstoßen worden ist? Dem sollte in der nächstinstanziellen sozialrechtlichen Aufarbeitung sinnvollerweise weiter nachgegangen werden.
Sofort sprangen die „üblichen Verdächtigen“ auf den Fall auf, Politiker von SPD, Grünen und Linkspartei, die eine generelle Legalisierung von Abtreibungen und eine Reform oder gar Abschaffung von Paragraf 218 StGB fordern.
Zunächst muss ich noch mal festhalten: Es besteht in rechtlicher Struktur wie praktischer Bedeutung – die biologische und psychologische Situation, die Häufigkeiten – ein Fundamentalunterschied zwischen Fristenregelung und medizinischer Indikation. Staat und Gesellschaft kommen den Schwangeren in beiden Fällen aus rechtlicher Sicht in unterschiedlicher Weise maximal weit entgegen. Der Fall Lippstadt betrifft die medizinische Indikation. Er eignet sich daher nicht als Beispielsargument für oder gegen eine Änderung der Fristenregelung, sei es innerhalb oder außerhalb des Strafgesetzbuches.
Laut Paragraf 218a Absatz 1 ist übrigens bei Beachtung der Anforderungen der Fristenregelung der Abtreibungs-Tatbestand juristisch „nicht verwirklicht“. Das heißt, dieser ist, obwohl materiell erfolgt, in einer juristischen Wertung primär nicht gegeben: Was juristisch nicht ist, kann folglich nicht kriminalisiert werden. Damit entpuppt sich das mit missionarischem Eifer in alle Bereiche der Gesellschaft hinein propagierte Narrativ von der generellen „Kriminalisierung“ beziehungsweise vom generellen „Verbot“ des Schwangerschaftsabbruchs der Pro-Choice-Bewegung als gegenstandslos: Nur weil die Ausnahmeregelungen zum Schwangerschaftsabbruch als positives Recht im StGB kodifiziert sind, bedeutet ihre dortige Verortung keineswegs automatisch eine Kriminalisierung – das Gegenteil ist der Fall!
Kriminalisiert ist der Abbruch vielmehr immer nur dann (§ 218), wenn er nicht rechtskonform gemäß eben dieser Ausnahmeregelungen (§ 218a) erfolgt. In den letzten 15 Jahren wurden auf dieser Basis (§ 218 StGB) praktisch ausschließlich gegen Schwangere gewalttätig gewordene Männer rechtskräftig verurteilt. Der § 218 diskriminiert nicht die Schwangeren, er schützt sie gegen männliche Gewalt.
In der Debatte um die Neuregelung der Abtreibungsgesetze war oft von einer „Legalisierung“ die Rede.
Der Gesetzentwurf 20/13775 zur Neuregelung der Abbruchsgesetzgebung sah keine „generelle“ Legalisierung, sondern eine eingeschränkte, bedingte Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs vor: Geplant war, den Abbruch auf Verlangen bis zum Ende der 12. Woche nach Empfängnis (p.c.) – das entspricht 13 + 6 SSW nach der Menstruation (p.m.) – grundsätzlich rechtmäßig, also nicht nur straffrei zu stellen. Die Pflichtberatung wäre geblieben, die dreitägige Wartefrist jedoch entfallen. Nach 12 + 1 p.c. sollte der Abbruch grundsätzlich rechtswidrig bleiben, hätte aber – wie bisher – bei medizinischer Indikation bis zum Beginn der Geburt rechtmäßig sein können; die kriminologische Indikation sollte bis 15 Wochen p.c. ermöglicht werden. Zugleich sollte der Straftatbestand „Schwangerschaftsabbruch“ im Strafgesetzbuch aufgehoben und die Regelungen in das Schwangerschaftskonfliktgesetz verlagert werden; strafrechtlich geschützt wäre vor allem die gewollte Schwangerschaft gegen Eingriffe Dritter geblieben.
Bei seiner Annahme wäre diese Änderung nicht bezugs- und folgenlos für das übrige normative Gesamtgefüge geblieben: Er hätte eine Kaskade von dann notwendigen Anpassungen erfordert, vor allem im Gesundheits- und Sozialversicherungsrecht (insbesondere SGB V), in der Finanzierung (Haushaltsrecht) und in Gesetzen, die Leistungen der Grundsicherung betreffen (SGB II, XII). Auch infrastrukturelle und versorgungsbezogene Regelungen (Krankenhausrecht, Praxen, Beratungseinrichtungen) wären betroffen gewesen.
„Nicht für jede im Konflikt befindliche Schwangere stellt die Abbruchsoption eine tragfähige ‘Lösung’ dar“
Der Gesetzentwurf war gekennzeichnet durch die fehlende Berücksichtigung legitimer ärztlicher Interessen in der Neuformulierung der Regeln ärztlichen Handelns in diesem medizinisch und gesellschaftlich so sensiblen Bereich: Konkret hätte sich im Vergleich zu bisher für die Ärzte in der praktischen Anwendung und Umsetzung der Abbruchsregularien, das heißt auf der formal-prozeduralen Ebene, außer der Aufhebung der Wartepflicht bei der Fristenregelung nichts geändert. Jedoch hätte man den Ärzten die alleinige juristische Verantwortung der Durchführung eines Abbruchs aufgebürdet, da nur diese strafrechtlichen Risiken ausgesetzt gewesen wären, wenn der Abbruch nicht regelkonform durchgeführt worden wäre.
Auch fehlten jegliche Maßnahmen der konkreten Unterstützung für Schwangere in Not und ihre Familien, die sich für ihr Kind entscheiden wollen: Nicht für jede im Konflikt befindliche Schwangere, welche vor der Entscheidung für oder gegen die Austragung der Schwangerschaft steht, stellt die Abbruchsoption tatsächlich eine dauerhaft tragfähige „Lösung“ dieses Konflikts dar: immerhin ein Drittel der jährlich ca. 150.000 Frauen (Dienerowitz, 2023), welche in Deutschland eine Konfliktberatung in Anspruch nehmen, entschließen sich im Anschluss an die Beratung zur Fortführung der Schwangerschaft.
Zur Person Professor Dr. med. Alexander Scharf-Jahns
Professor Dr. med. Alexander Scharf-Jahns ist seit 2022 Geschäftsführer des MVZ PraenatGyn GmbH in Mainz. Mit fast 40 Jahren Berufserfahrung in der Frauenheilkunde und 30 Jahren in der Pränatalmedizin zählt er zu den führenden deutschen Experten seines Fachs. Nach seinem Medizinstudium an der Universität des Saarlandes (1980-1987) promovierte er 1991 und habilitierte 2005 an der Medizinischen Hochschule Hannover. 2008 erhielt er eine außerplanmäßige Professur an der Universität Heidelberg. Zusätzlich absolvierte er berufsbegleitende Studiengänge zum Medical Hospital Manager (2006-2007) und zum MBA (2007-2008).
Seine Laufbahn umfasst Stationen als den Universitäts-Frauenkliniken in Frankfurt, Hannover und Heidelberg. Seit 2011 ist er niedergelassener Facharzt für Pränatalmedizin, zuerst in Darmstadt, später in Mainz.
Dr. Scharf-Jahns verfügt über zahlreiche Fachkunden, unter anderem in spezieller operativer Gynäkologie, Perinatalmedizin und Ultraschalldiagnostik (DEGUM II). Er ist Mitglied in Fachgremien wie der DEGUM und war Vorsitzender des Berufsverbands Niedergelassener Pränatalmediziner (2015-2020). Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Versorgungsforschung, pränatalen Neurowissenschaften, fetales Bewusstsein und Philosophie des Geistes. Mehrfach wurde er für seine wissenschaftlichen Beiträge ausgezeichnet, so mit dem ASCO Merit Award (2004).
Alexander Scharf-Jahns wurde 1962 in Mannheim geboren.
Aus Sicht der Befürworter einer sogenannten „Legalisierung“ der Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche ist für die mediale Verbreitung ihres kontrafaktischen Narrativs natürlich jeder Anlass willkommen und wird entsprechend auch genutzt, welcher geeignet zu sein scheint, die Verbreitung dieser gefühlten Kriminalisierung der ungewollt Schwangeren und der bei ihnen und – Stichwort Mifegyne – mit ihnen abbrechenden Ärzte zu befördern.
Wie sinnvoll ist die aktuelle Gesetzeslage mit Paragraf 218, 218a und 219 StGB sowie Schwangerschaftskonfliktgesetz aus ethischer, juristischer sowie aus medizinischer Sicht?
Aus juristischer Sicht berücksichtigt die aktuelle Gesetzeslage vollumfänglich die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes, insbesondere Artikel 1 (1) Menschenwürde, Artikel 2 (2) Lebensrecht und bringt hier die legitimen Interessen der Beteiligten (Schwangere, Fetus) in einen tragfähigen, stabilen und respektvollen Ausgleich.
Dies wird erreicht, indem der Staat seiner Schutzpflicht gegenüber Schwangeren in einer Konfliktlage während der ersten 12 Wochen maximal entgegenkommt über die juristische Bewertung des nicht gegebenen Tatbestandes („nicht verwirklicht“) eines Schwangerschaftsabbruchs trotz materiellen Vollzugs, sofern die Voraussetzungen eingehalten wurden. Andererseits kommt der Staat über die Kodifizierung der Formen des nicht rechtswidrig durchgeführten Schwangerschaftsabbruchs (Straflosigkeitsbestimmungen, § 218a) und die Sanktionsandrohung bei Durchführung eines Abbruches außerhalb dieser Regeln (§ 218) seinen Pflichten gegenüber dem Fetus, aber auch dem Schutz der Mutter gegen männliche Gewalt nach.
„In einer normativ-ethischen Bewertung ist die aktuelle Gesetzeslage ein tragfähiger Kompromiss“
Indem der Fetus, anders als die Schwangere, keine Rechtsperson darstellt, sondern als sogenanntes objektives Schutzgut betrachtet wird, hat dabei das ungeborene Leben keinen eigenen subjektiven Rechtsanspruch gegen die Mutter, jedoch hat der Staat die objektive Schutzpflicht pro cura foeti, die auch gegen die Mutter wirksam werden darf. Dieser staatliche Schutzauftrag ist jedoch nicht absolut, sondern durch Abwägung mit den mütterlichen Rechten modifizierbar.
Auch in einer normativ-ethischen Bewertung stellt die aktuelle Gesetzeslage einen tragfähigen Kompromiss dar, der sich den Realitäten der menschlichen Natur in einer existenziellen Konfliktlage stellt und hier Wege aufweist, wie mit Konflikten, die ihrer Natur nach nicht lösbar sind, handlungs- beziehungsweise zielorientiert umgegangen werden kann, ohne dabei die Einzigartigkeit und Würde aller Beteiligten aus dem Auge zu verlieren.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Ähnliches gilt für die medizinische Bewertung: Sie hat zunächst einmal seit ihrem Inkrafttreten vor 30 Jahren auf der pragmatischen Handlungsebene dazu geführt, dass die Arbeitsprozesse ruhig und unauffällig im Hintergrund laufen können: Dies wird in einer formalen Betrachtung – unabhängig einer inhaltlichen oder persönlichen Bewertung – belegt durch die bemerkenswerte Konstanz der Leistungsindikatoren in diesem Bereich. Für die These einer generellen Versorgungslücke oder Unterversorgung findet sich in der medizinischen Versorgungsforschung kein Hinweis.
Indem, außer im akuten Notfall, Ärzte aus Gewissens- und/oder Berufsgründen die Teilnahme an einem Schwangerschaftsabbruch ablehnen dürfen, ohne die Patientin im Stich zu lassen, hat jeder Arzt die Möglichkeit und die Freiheit, sich in seinem Berufsfeld im Einklang mit seinen ethischen Vorstellungen und Standards als Arzt und Mensch bewegen und handeln zu können. Damit ist die aktuelle Gesetzeslage grundsätzlich stabil, funktional und ausgesprochen sinnvoll. Kleinere Verbesserungen wären aus pränatalmedizinischer Sicht bei den prozeduralen Regularien des Spätabbruchs mit Fetozid hilfreich, da geht es um jährlich etwa 700 Fälle.
Oft heißt es sowohl von Abtreibungsbefürwortern als auch Lebensschützern, die gesetzlichen Regelungen seien widersprüchlich, schwer verständlich und zeigten keine Wirkung. Stimmt das?
Ich kann diese vorwurfsvollen Thesen absolut nachvollziehen: Auf einen Laien, der sich nicht tiefer mit Reproduktionsbiologie, Rechtswissenschaften und medizinischer Versorgungsforschung beschäftigt hat, müssen die gesetzlichen Regelungen schwer verständlich und widersprüchlich wirken. Auch ist die sachgerechte Beantwortung der Frage nach ihrer ordnungspolitischen und versorgungsmedizinischen Wirkung für einen Laien ohne weitere Fachkenntnis nicht möglich.
Unterzieht man die Gesetzgebung jedoch einer fachlichen Analyse, so lautet die Antwort: nein.
Könnten Sie das bitte ausführen? Warum ist es nicht widersprüchlich, wenn einerseits eine Rechtswidrigkeit suggeriert, diese aber nicht verfolgt wird?
Der einzige und damit eigentliche „Knackpunkt“ und damit inhaltlich berechtigte Kritikpunkt an der gegenwärtigen Ausgestaltung der Gesetzgebung ist die unterschiedliche regionale Versorgungsdichte beziehungsweise Versorgungssicherheit. Ansonsten ist die Gesetzgebung insgesamt gelungen und tragfähig. Das Verbot mit Ausnahmen ist rechtlich kohärent und verfassungsrechtlich legitim.
„Die deutschen Abtreibungszahlen liegen im europäischen Vergleich im unteren Drittel“
Die Spannung zwischen dem Schutz des ungeborenen Lebens und die Selbstbestimmung der Frau ist mit Paragraf 218a StGB aufgefangen. Auch gibt es mit der Beratungs- und Wartezeitpflicht eine plausible Lösung zur Reflexionsförderung, wenngleich es aus meiner Sicht keine ausreichende Analyse zur Zielerreichung gibt. Wichtig ist zudem, dass es ein ärztliches Trennungsgebot gibt, dass also der beratende Arzt nicht die Abtreibung durchführen darf.
Seien Sie ehrlich: Die Abtreibungsregelung in Deutschland ist aber für den gewöhnlichen Bürger nicht nachvollziehbar.
Die Materie ist, wie wir gesehen haben, hochkomplex. Das Hauptproblem ist nicht der Ablauf, sondern die Begrifflichkeit, zum Beispiel die Doppellogik von Strafrecht (StGB) und Beratungsrecht (Schwangerschaftskonfliktgesetz): Der Gegensatz „rechtswidrig, aber straflos“ (Beratungsregel) versus „nicht rechtswidrig“ (Indikationen) ist für Nicht-Juristen schwer zu fassen. Ein weiterer Kernaspekt hierbei ist die juristische Feinunterscheidung in den einzelnen Gesetzesabschnitten (vergleiche Wortwahl § 218a (1) „Tatbestand nicht erfüllt“ vs. § 218a (2,3) „nicht rechtswidrig“). Kurz gesagt: Die Regelung ist „teilweise verständlich, aber insgesamt für Laien nur mäßig klar“.
Würden Sie sagen, die deutsche Regelung ist angesichts der konstant hohen Abtreibungszahlen effektiv?
Das ist eine Frage der Perspektive: Die deutschen Zahlen liegen im europäischen Vergleich im unteren Drittel. In Deutschland werden seit Jahrzehnten rund zwölf Prozent der Schwangerschaften nach der Beratungsregel abgebrochen. In anderen Ländern wie Großbritannien, Frankreich oder Schweden sind es fast doppelt so viele. Auch die Pro-Choice-Bewegung käme bei unvoreingenommener, rational-analytischer Herangehensweise nicht an folgenden Tatsachen vorbei: Es gibt, gemessen an den harten Qualitätsindikatoren der jährlichen absoluten wie relativen Abbruchszahlen mit ihrer bemerkenswert robusten Konstanz während der vergangenen 15 Jahre, in einer landesweiten Makro-Betrachtung keine Hinweise auf eine sich grundsätzlich verschlechternde Versorgungslage. Regionale Unterschiede gibt es. Aber das ist ein anderer Punkt, der mit dem generellen Strukturwandel unseres Gesundheitssystems zu tun hat und welcher für sich ebenso genau betrachtet und aufgearbeitet gehört. Die Pro-Choice-Bewegung wäre weitaus authentischer in ihrer Argumentation, wenn sie diese beiden unterschiedlichen Ebenen nicht fortwährend erkenntnistheoretisch-logisch, also wissenschaftlich unzulässigerweise vermischen und von ihrer moralisch ausgrenzenden, zunehmend bellizistischen Rhetorik Abstand nehmen würde.
Mittlerweile wird der emotional geführte Kulturkampf auch aktiv in medizinische Fachgremien hineingetragen und entfaltet dort eine destruktive Wirkung, indem ein wechselseitig wertschätzender achtungsvoller Sachdiskurs zunehmend erschwert wird. Auch in der Wissenschaft, wie sonst auch in einer demokratischen Gesellschaft, macht der Ton die Musik. Daher wäre mein genereller Appell an alle an diesem Punkt: Legt die Waffen nieder und sprecht miteinander – in Achtung und vor allem: in Vernunft!
Was die generelle Verlässlichkeit der Zahlen angeht: Hier wurden wiederholt Zweifel im Sinne eines Underreportings angemeldet. Das Statistische Bundesamt hat noch vor 25 Jahren gewarnt, die gemeldeten Abtreibungszahlen seien mit Vorsicht zu genießen. Es meldeten sich Fachleute, von einer beträchtlichen Dunkelziffer ausgehen. Der Sozialwissenschaftler Manfred Spieker sah im Jahr 2000 nur gut die Hälfte der Abbrüche erfasst. Auch der deutsch-österreichische Gynäkologe und Abtreibungsaktivist Christian Fiala, der mehrere Abtreibungsambulanzen betreibt, sagte 2017, die Zahlen in Deutschland seien in Wirklichkeit mindestens doppelt so hoch. Er begründete das damit, dass der beobachtete Rückgang an Abbrüchen ab 2004 doppelt so stark ausgefallen sei wie der Rückgang der Frauen im gebärfähigen Alter, nämlich 24 versus 12 Prozent.

Aspekte, die in der beobachteten Zeit eigentlich eine Zunahme an Abbrüchen erwarten ließen, sei zum Beispiel die zunehmende Angst vor hormonellen Verhütungsmitteln: In Frankreich und Großbritannien etwa sei ein Zusammenhang zwischen der Pillen-Angst und Anstieg von Schwangerschaftsabbrüchen zu beobachten. Da in Frankreich die Krankenkassen die Kosten für alle Abbrüche übernehmen und diese Daten sowie die Krankenhausstatistiken mit den Meldungen der Ärzte abgeglichen werden, gilt die dortige Statistik als sehr zuverlässig.
Das bundesdeutsche Gesundheitsministerium widersprach seinerzeit Fialas Darstellung vehement mit dem Verweis: Aufgrund der bestehenden Auskunftspflicht und des seit Jahren in weiten Bereichen konstanten Berichtskreises sei die Qualität der Schwangerschaftsabbruchstatistik hoch und Abweichungen in dem behaupteten Umfang von mehr als 100.000 Fällen nicht realistisch.
Mit der Möglichkeit, Abtreibungen unter bestimmten Voraussetzungen straffrei durchführen lassen zu können, hat der Gesetzgeber eine vermeintliche Entscheidungsfreiheit für Schwangere ermöglicht, die renommierte Beratungsorganisationen eher als Scheinfreiheit bezeichnen würden. Denn Frauen im Schwangerschaftskonflikt werden nicht selten durch die wirtschaftlichen oder biografischen Umstände oder gar durch den Partner unter Druck gesetzt und sind somit alles andere als „frei“. Versagt der Staat, versagt die Gesellschaft an dieser Stelle?
Tatsächlich gibt es mittlerweile robuste Daten – zum Beispiel bei Reardon – zu der hier alles entscheidenden Frage nach der Motivation, weswegen in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft nach der Beratungsregel Abbrüche durchgeführt werden. Wie bereits zuvor erörtert, spielt die Ursachengruppe „Druck durch Dritte – soziales Umfeld, Familie, Partner“ in immerhin bis zu 30 Prozent der Fälle eine maßgebliche Rolle beim Entschluss gegen die Fortführung der Schwangerschaft.
„Bei einer von zehn Frauen beruht ihr Schwangerschaftsabbruch auf offenem Zwang“
Sogar zwei Drittel aller Frauen geben bei entsprechender Fragestellung an, den Schwangerschaftsabbruch durchgeführt zu haben, obgleich dieser ihren persönlichen Werten und eigentlichem Wunsch widersprach und dies zu einer Verschlechterung ihres psychischen Gesundheitszustands geführt habe. Nur ein Drittel der befragten Frauen gab an, dass der Schwangerschaftsabbruch in voller Übereinstimmung mit ihren persönlichen Überzeugungen und Werten erfolgte. Bei einer von zehn Frauen beruht ihr Schwangerschaftsabbruch auf offenem Zwang.
Wenn man sich ideologiefrei und ernsthaft bemühen möchte, eine echte, wirkungsvolle Verbesserung der medizinischen Versorgung von Frauen im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen herbeizuführen, muss dieser Tatsache unbedingt Rechnung getragen werden. Ob man hier von einem offenen Versagen sprechen kann, bleibt jedem selbst überlassen. Aus einer medizinisch-analytischen Sicht ist es jedoch sicherlich nicht zu weit gegriffen, klar festzustellen, dass Staat und Gesellschaft die Realität nicht vollumfänglich erfassen und diskutieren.
Wenn wir davon ausgehen, dass sich ein effektiver Lebensschutz am besten in niedrigen Abtreibungszahlen ausdrückt: Wie könnten wir dahin kommen, dass speziell im Zusammenhang mit pränatalen Befunden wie Trisomie 21 nicht länger 90 Prozent der Betroffenen eine Abtreibung als das Naheliegendste erscheint?
Lassen Sie uns hier zunächst begrifflich sortieren: Der „Motor“ der Abtreibungen sind die 96 Prozent, die unbesehen irgendeiner Fragestellung nach kindlicher Gesundheit auf Basis der sogenannten Beratungs- beziehungsweise Fristenregel durchgeführt werden. Das sind etwa 100.000 Fälle pro Jahr. Hier wäre im Bemühen, eine effektive, nachhaltige Senkung der Abbruchszahlen zu erreichen, der eigentliche Hebel anzusetzen. Dieser ist mittlerweile identifiziert: Es sind die 30 Prozent Schwangeren, die primär aufgrund des auf sie ausgeübten sozialen Drucks ihrer Peergroup wie Partner oder Familie und gegen ihre innere Überzeugung abbrechen.
Die medizinisch indizierten Abbrüche machen in einer Aufwand-Wirkung-Betrachtung eine eher marginale Gruppe aus: Die natürliche Frequenz fetaler Erkrankung jenseits der 12. Schwangerschaftswoche beträgt circa 4 Prozent. Bei 700.000 zur Geburt kommenden Schwangerschaften pro Jahr und unter der Annahme einer 90-prozentigen vorgeburtlichen Erfassung sind das rund 25.000 Fälle pränatal diagnostizierter Fehlbildungen pro Jahr. Von diesen werden jährlich 3.000 bis 4.000, also rund 16 Prozent, abgebrochen. Hierbei handelt es sich typischerweise um schwere, komplexe und prognostisch extrem ungünstige rein körperliche Fehlbildungen oder ebenfalls prognostisch sehr ungünstige genetische Erkrankungen, zum Beispiel Trisomie 18, 13 oder auch Mikrodeletionen.
Was ist mit Trisomie 21?
In der Gruppe der genetischen Erkrankungen kommt der Trisomie 21 eine Sonderrolle zu, die hiervon getrennt betrachtet werden sollte: Sie geht typischerweise mit einem bedeutsamen, aber im Einzelfall durchaus variablen neurologischen Defizit einher, auf welches sich im Alter häufiger als bei Menschen ohne Trisomie 21 eine Altersdemenz aufsetzt. Sie ist trotz erhöhter Rate an damit verbundenen angeborenen körperlichen Fehlbildungen und systemischen Neubildungen im weiteren Lebensverlauf, zum Beispiel Tumorerkrankungen, üblicherweise – nicht zuletzt dank der modernen medizinischen Therapieoptionen – mit einem Langzeitüberleben von über 60 Jahren verbunden.
„Abbrüche wegen Down-Syndrom machen einen Anteil von 0,7 Prozent aus“
Aus den eben genannten biologischen und kognitiven Kenndaten der von dieser genetischen Variante betroffenen Menschen ergibt sich eine besondere Situation, die in der Wertung dieses Zustandes durch die schwangere Mutter dazu führt, dass Schwangerschaften mit diesen Kindern, die vorgeburtlich als Merkmalsträger einer Trisomie 21 identifiziert werden, realistischen Schätzungen zufolge – leider gibt es hierzu keine validen Daten – in Deutschland in 90 Prozent der Fälle abgebrochen werden.
Natürlicherweise tritt das Down-Syndrom mit einer Häufigkeit von 1 zu 700 Geburten auf. Dies entspricht bei 700.000 Geburten einer jährlich absoluten Auftretenshäufigkeit von 1.000 pro Jahr. Durch die Struktur unseres Gesundheitssystems und seine Inanspruchnahme durch die Schwangeren werden etwa 80 Prozent der Menschen mit Down-Syndrom, mithin 800 pro Jahr, vorgeburtlich über entsprechende Suchstrategien als solche identifiziert und diagnostiziert.

Von diesen 800 vorgeburtlich gesicherten Fällen werden 90 Prozent abgebrochen, das entspricht 720 Schwangerschaften mit fetalem Down-Syndrom pro Jahr. Damit macht der Abbruch wegen fetalen Down-Syndroms in der Gruppe aller medizinischer Abbrüche pro Jahr einen Anteil von 18 Prozent aus. Ihrerseits sind die jährlich 4.000 medizinisch indizierten Abbrüche Ergebnis dessen, dass 16 Prozent aller jährlich auftretenden vorgeburtlich diagnostizierten fetalen Fehlbildungen (ca. 28.000 Fälle) abgebrochen werden. Diese Zahl ist deshalb bedeutsam, weil sie illustriert, dass die mütterliche Fehlbildungstoleranz an sich hoch ist. Dieses Geschehen vollzieht sich vor dem Hintergrund der jährlich rund 100.000 Abbruchsfälle auf Basis der Fristenregelung. Damit machen die Abbrüche wegen fetalen Down-Syndroms am Gesamtaufkommen aller Abbrüche einen Anteil von 0,7 Prozent aus.
Das ist sehr wenig. Aber ist nicht auch das Leben dieser Menschen schützenswert?
Grundsätzlich zählt jedes einzelne dieser Leben: Im Babylonischen Talmud heißt es sinngemäß: „Wer ein Leben rettet, hat die ganze Welt gerettet.“ Dem entspricht das Konzept von Artikel 1, Satz 1 Grundgesetz und der in Achtung vor der Schwangeren, aber auch vor dem Fetus fein austarierte rechtliche Kompromiss aus dem Jahr 1995, bei welcher der Schwangeren in den ersten drei Monaten die Letztentscheidung über das Leben des Kindes vom Staat eingeräumt wurde, aber das sich aus dem Menschenwürdekonzept (Art. 1 (1) GG) ergebende grundsätzliche Lebensrecht des Fetus (Art. 2(2) GG) dennoch betont wird. Die ernüchternde Bilanz ist, dass wir uns um jeden Einzelfall durch ein breites, ehrliches Angebot an valider Information bemühen müssen, die Erwartungen aber, hier Fundamentaländerungen in den Abbruchszahlen erreichen zu können, nicht zu hoch stecken dürfen.
Nehmen wir an, dieses Interview wird von einer jungen Frau gelesen, die im kommenden Wintersemester ihr Medizinstudium aufnehmen wird. Sie ist fasziniert von der Pränatalmedizin, möchte sich aber aus ethischen Gründen weder direkt noch indirekt an einer Abtreibung beteiligen. Sollte sie sich besser in einem anderen Fachbereich spezialisieren?
Grundsätzlich ist kein Arzt – außer im absoluten medizinischen Notfall – gezwungen, an einem Abbruch direkt teilzunehmen. Auch keine in der Pränatalmedizin tätige ärztliche Person. Die Frage nach der indirekten Beteiligung ist demgegenüber deutlich schwieriger zu beantworten: Hier kommt es auf die Definition an, was hierunter allgemein zu verstehen ist beziehungsweise von einer angehenden Medizinstudentin konkret hierunter verstanden würde.
„Medizin hat immer mit Menschen zu tun, die hineingeworfen sind in eine komplexe Welt“
Pränatalmedizin beschäftigt sich mit Fragen der kindlichen Gesundheit und findet aus biologischen und damit diagnostischen Gründen in aller Regel nicht vor der 11., 12. SSW statt. Damit hat die Pränatalmedizin keine Schnittmengen zur medizinischen Versorgung vor dieser Zeit und hat insoweit nichts mit der Organisation, Planung und Durchführung der jährlich etwa 100.000 Schwangerschaftsabbrüche auf Basis der Fristenregelung mit Beratungspflicht zu tun.
Die etwa 4.000 medizinisch indizierten Abbrüche jährlich werden üblicherweise in universitären und nichtuniversitären Perinatalzentren der höchsten Versorgungsstufe vorgenommen. Insoweit – und hier müssen wir alle ehrlich sein – arbeiten alle Pränatalmediziner, selbst wenn sie nicht selbst Abbrüche durchführen, in einem Versorgungsnetz auch solchen Einrichtungen zu, in welchen diese jährlich 4.000 Abbrüche durchgeführt werden.
Ob und inwieweit diese Tätigkeit für eine junge angehende Medizinstudentin vor dem Hintergrund ihrer persönlichen kulturellen, religiösen und ethischen Verfasstheit damit in den Bereich einer indirekten Beteiligung an Abtreibungen fällt oder nicht, müsste sie dann für sich selbst entscheiden. Grundsätzlich sind wir als Pränatalmediziner dem Leben verpflichtet, und wir helfen, so gut wir können.
Medizin hat immer mit Menschen zu tun, die hineingeworfen sind in eine komplexe Welt, so wie sie ist. Die Geschehnisse in ihr folgen einer höheren Logik jenseits unseres Begriffsvermögens. Dies zu akzeptieren ist unsere Aufgabe und Pflicht. Dazu gehört auch die Demut vor diesem Werk und Anerkennung dessen, dass nichts perfekt ist und immer nur gut. Das gilt auch für das Wunder des neuen Lebens, dem Beginn eines neuen Abschnitts und einer neuen Chance im ewigen Zyklus des Werdens und Vergehens.
Teil 1 des großen Interviews mit Alexander Scharf-Jahns lesen Sie hier.


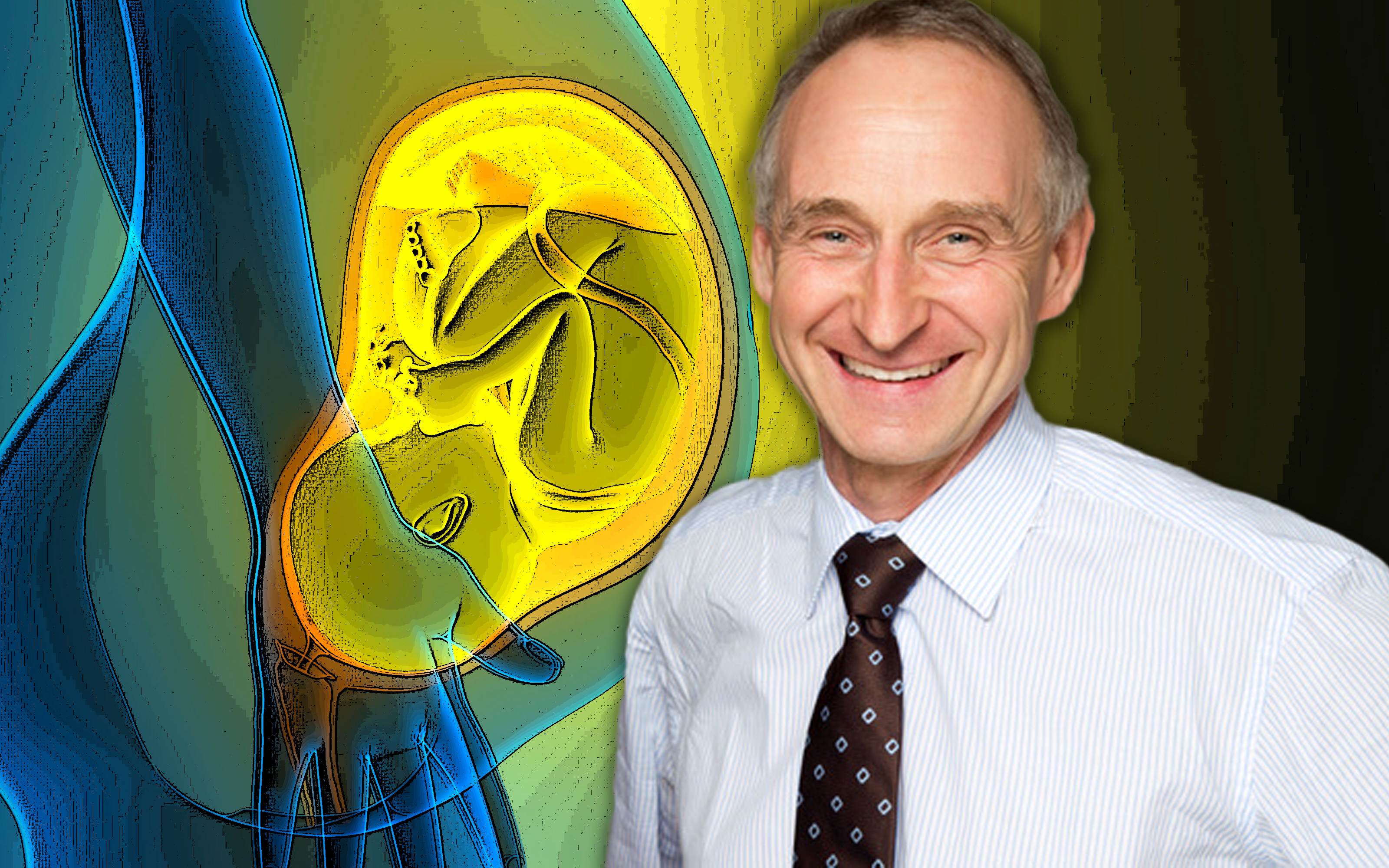



Kommentare
Dieser Satz ist aus katholischer Sicht nicht haltbar.
„Auch in einer normativ-ethischen Bewertung stellt die aktuelle Gesetzeslage einen tragfähigen Kompromiss dar, der sich den Realitäten der menschlichen Natur in einer existenziellen Konfliktlage stellt und hier Wege aufweist, wie mit Konflikten, die ihrer Natur nach nicht lösbar sind, handlungs- beziehungsweise zielorientiert umgegangen werden kann, ohne dabei die Einzigartigkeit und Würde aller Beteiligten aus dem Auge zu verlieren.“
Die 100000 Seelen, die alleine in Deutschland jährlich ermordet werden, sprechen eine deutliche Sprache.
@NicklasDie 100000 Seelen, die alleine in Deutschland jährlich ermordet werden, sprechen eine deutliche Sprache.
Unbestritten.
Aber: Der Herr hat halt nun mal nicht aus einer katholischen Perspektive heraus argumentiert, so bedauerlich Ihnen das erscheinen mag. Er spricht von einem „tragfähigen Kompromiss“ – nicht mehr, aber auch nicht weniger – in einer Gesellschaft, in der sich Positionen vom ‚konservativen‘ Katholiken bis zur ‚progressiven‘ Pro-Choice-Aktivistin ausgleichen müssen, wobei viele Menschen – seien wir realistisch – irgendwo in ziemlich einer indifferenten Position dazwischen verharren.
Weil wir gefallene Menschen sind, wird es vermutlich niemals eine Gesellschaft ohne Übel geben, also auch nicht ohne das Übel der Abtreibung. Aber Herr Scharf-Jahns sieht und benennt einen Hebel, an denen man ansetzen kann, um die Situation zu verbessern. Das kann man anerkennen; man muss nicht gleich daran herummäkeln, dass ein Mediziner und Wissenschaftler manchmal etwas abgewogener argumentiert, als dies manche von uns in einer Sache, bei der das Herz brennt, für richtig halten.
"Sogar zwei Drittel aller Frauen geben bei entsprechender Fragestellung an, den Schwangerschaftsabbruch durchgeführt zu haben, obgleich dieser ihren persönlichen Werten und eigentlichem Wunsch widersprach und dies zu einer Verschlechterung ihres psychischen Gesundheitszustands geführt habe."
Das ist wirklich erschreckend! Und es verwundert mich, warum Frauen hier nicht zusammenhalten, sondern es vor allem oft sie es sind, die den linken Lügen auf den Leim gehen.
Auch wenn es zweifellos ein Skandal ist, dass es immer noch Männer gibt, die glauben, gegenüber ihren Frauen gewalttätig werden zu dürfen, ist der Begriff "männliche Gewalt" sexistisch, weil er eine Geschlechtsidendität pauschal negativ konnotiert!
Die Folge ist, dass Männer auch in demokratischen Gesellschaft immer noch als billiges Kanonenfutter betrachtet werden, euphemistisch als "allgemeine Wehrpflicht" verschleiert - die allerdings nicht so "allgemein" wie das Wahlrecht ist und den Töchtern des Volkes nicht zugemutet wird. Provozierend gesagt: Männlichen Küken darf man nicht mehr schreddern, männliche Menschenkinder schon!
Nicht besser ist es bei einer dreifach so hohen Suizidzahl bei Männern, ein "Gender-Gap", den so gar niemand berührt. Kein Wunder, dass sich in so einem Klima Eltern lieber Töchter als Söhne wünschen. Auch ein Aspekt des Themas Lebensschutz ... 😢
@Ambrosius Das ist aber jetzt schon etwas weinerlich?
Und können Sie mir mal bitte genauer erklären, in welcher westlichen Gesellschaft Männer als "billiges Kanonenfutter" missbraucht werden? Da fällt mir gerade so mancher Staat ein, vorneweg Russland, aber ganz bestimmt nicht der unsrige.
Dies wie @Braunmüller weiter unten schrieb. Herr Prof. Dr. med. Scharf-Jahns scheint mir hier einen guten Lösungsansatz zu haben. In einer Welt ohne Religion kann man bei einem einzelnen Sujet nicht mit Religion argumentieren. Solange nicht eine relevante Zahl religiös ist, muss man deren Sprache sprechen, und die trifft der Interviewpartner meiner bescheidenen Meinung nach gut.
"Grundsätzlich ist kein Arzt – außer im absoluten medizinischen Notfall – gezwungen, an einem Abbruch direkt teilzunehmen."
"Grundsätzlich" glaube ich auch an dem Weihnachtsmann und den Osterhasen! 😢 In der Realität dürfte, nach allem, was ich von medizinischem Personal, Ärztinnen wie Krankenschwestern, höre, die Ausnahme, also der faktische soziale Zwang zur Teilnahme an Abtreibungen, der weitaus häufigere Fall sein.
Der Herr Professor will uns hoffentlich auch nicht erzählen, dass in der Stellenausschreibung seiner früheren Krankenhausstellen nie etwas von Schwangerschaftsabbrüchen stand!?
Und selbst wenn die aktuelle rechtliche Lage Ärzte noch vor unfreiwilligen Schwangerschaftsabbrüchen schützen mag, die politische Linke ist unter dem verdrehten Narrativ der Unterversorgung kräftig dabei, an der Gewissensfreiheit zu sägen. Wer es nicht glaubt, mag einen Blick in den vom EU-Parlament abgesegneten post-kommunistischen Matić-Report werfen ... 😢
@Ambrosius Mal im Ernst: Haben Sie dieses Interview überhaupt gelesen?