Opferfest!

Als ich am Freitag vor dem Palmsonntag des Jahres 2018 mit etwa dreißig Männern in der Nähe meiner Pfarrkirche einen kleinen Berg hinaufging, um dabei die deutsch-niederländische Grenze nach Kerkrade zu überschreiten und in der romanischen Krypta der ehemaligen Abteikirche von Rolduc im Rahmen einer jahrzehntelangen Tradition des hiesigen „Bußgangs der Männer“ die heilige Messe zu feiern, ereignete sich zur selben Zeit im 1.171 km entfernten südfranzösischen Trèbes etwas Dramatisches.
Während ich das heilige Messopfer mit den Männern feierte, gab es dort einen ebenso realen, allerdings nicht unblutigen Opfertod. Arnaud Beltrame, ein Offizier der französischen Gendarmerie nationale, hatte sich bei einer islamistisch motivierten Geiselnahme freiwillig gegen eine Geisel austauschen lassen und wurde anschließend vom Attentäter getötet. Das Geschehen erlangte internationale Aufmerksamkeit.
Für uns als Teilnehmer der kleinen grenzübergreifenden Wallfahrt war es später bedenkenswert, dass sich das Drama von Trèbes genau zu dem Zeitpunkt ereignete, an dem wir die katholische Messliturgie gefeiert hatten, also das, was man die unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfer Jesu Christi nennt. Dieses Opfer, so hat es Jesus selbst einmal formuliert, versteht sich als der Gipfelpunkt der Liebe.
„Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt“
Denn: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt“, sagt Jesus im Johannesevangelium beim Letzten Abendmahl, bevor er in die Nacht Seiner Verhaftung geht, die mit Seinem gewaltsamen Tod endet. Er will durch Seine Bemerkung bei niemand einen Zweifel daran aufkommen lassen, dass Sein Tod kein Unfall sein wird, sondern ein freiwilliger Tod und der Gipfelpunkt der Hingabe.
Nachdem das zeitliche Zusammentreffen unserer Pilgermesse und der Hinrichtung des freiwillig in die Todesgefahr gegangenen Offiziers mich noch eine Zeit lang beschäftigte, fielen mir wenig später einige Zeilen von Marielle, der Verlobten von Arnaud Beltrame, in die Hände.
Sie schrieb: „Dank der sorgfältigen Begleitung der Mönche von Lagrasse haben wir uns lange auf die kirchliche Trauung vorbereitet. Die Feier sollte in der Bretagne stattfinden, denn dort hat Arnaud seine Wurzeln. Darüber hinaus stand er der Abtei von Timadeuc sehr nahe, wo er an zahlreichen Exerzitien teilnahm. Das Begräbnis meines Ehemannes wird in der Karwoche stattfinden – nach seinem Tod an einem Freitag kurz vor Palmsonntag, was in meinen Augen nicht ohne Bedeutung ist. Mit großer Hoffnung erwarte ich an Ostern die Feier der Auferstehung mit ihm.“
Was der französische Staatspräsident unerwähnt ließ
Zur kirchlichen Hochzeit von Marielle und Arnaud ist es nicht mehr gekommen, denn der Oberstleutnant erlag seinen Verletzungen. Bei dem Trauerzug vor seiner Beisetzung drängten sich die Menschen in Paris zu Tausenden am Straßenrand und nahmen in strömendem Regen Abschied von ihm. Das unausgesprochene Gefühl der meisten Teilnehmer: Er war nicht nur ein Opfer eines Anschlages. Er war ein freiwilliges Opfer. Denn der Gendarm hatte sich bei der Terrorattacke von Trèbes aus freien Stücken anstelle einer Geisel in die Gewalt des islamistischen Attentäters begeben und sich zum Austausch gegen eine junge Frau angeboten.
Staatspräsident Emmanuel Macron nannte ihn „Held der Nation“. In seiner Trauerrede legte er dar, wie Beltrame den vom Islamisten angegriffenen Supermarkt betreten, seine Waffe niedergelegt, mit erhobenen Händen den Platz einer als Geisel festgehaltenen Angestellten eingenommen habe. „Für Beltrame“, so der Präsident, „zählte deren Leben mehr als alles andere.“ Den Tod hinzunehmen, damit Unschuldige leben, das zeichne einen Gendarmen aus.
Was Präsident Macron dabei unerwähnt ließ, ist, dass Arnaud Beltrame diesen Akt der Hingabe nicht zufällig setzte und auch wohl nur in zweiter Linie aus Liebe zu Frankreich, sondern vielmehr aus einer von ihm sehr bewusst gelebten christlichen Haltung heraus. Dabei war er eigentlich in einer dem Glauben fernstehenden Familie aufgewachsen, bis er etwa im Jahr 2008, mit fast dreiunddreißig Jahren, eine echte Bekehrung erlebte. Er empfing 2010 die erste heilige Kommunion und die Firmung nach zwei Jahren Katechumenat.
„Sein Akt der Aufopferung stimmte mit dem überein, woran er glaubte“
Bei einer Wallfahrt nach Sainte-Anne-d’Auray im Jahre 2015 bat er die Gottesmutter um Fürsprache, dass er die Frau seines Lebens treffe. Kurz darauf schloss er Freundschaft mit Marielle, einer jungen Katholikin mit einem tiefen und gleichzeitig dezenten Glauben. Die Verlobung wurde Ostern 2016 in der bretonischen Abtei Timadeuc gefeiert. Pater Jean-Baptiste, Regularkanoniker der Abtei Lagrasse, der Arnaud und Marielle am 9. Juni 2018 trauen sollte, sagte später über den Gendarm das, was Präsident Macron in seiner Heldenrede nicht erwähnte:
„Es scheint mir, dass einzig sein Glaube den Wahnwitz dieser Aufopferung erklären kann, die heute die Bewunderung aller auf sich zieht. Er wusste, wie Jesus uns sagte: ‘Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.’ Er wusste, dass sein Leben auch Gott, Frankreich und seinen Brüdern in Todesgefahr gehörte. Ich glaube, dass einzig ein von der Nächstenliebe beseelter christlicher Glaube von ihm dieses übermenschliche Opfer fordern konnte.“
Und der Polizeiseelsorger Pater Dominique Arz bestätigt dies:
„Oberstleutnant Beltrame war ein praktizierender Katholik. Tatsache ist, dass er seinen Glauben nicht verheimlichte und dass er ihn auch ausstrahlte, von ihm Zeugnis ablegte. Man kann sagen, dass sein Akt der Aufopferung mit dem übereinstimmt, woran er glaubte. Er ist bis ans Ende seiner Aufopferung für das Vaterland gegangen und bis ans Ende seines Glaubenszeugnisses. Glauben bedeutet nicht nur, einer Lehre anzuhängen, es bedeutet zunächst Gott und seinen Nächsten zu lieben und seinen Glauben im Alltagsleben konkret zu bezeugen.“
Vor dem Hintergrund seiner freiwilligen Lebenshingabe kurz vor der Karwoche im Jahre 2018 überlasse ich die diesjährige Osterkolumne deswegen dem christlichen Polizisten Arnaud Beltrame. Denn er hatte auf eine nicht zu überbietende Weise begriffen, was Ostern bedeutet. Er hat mit seinem Blut unterschrieben, was es heißt, ein Christ zu sein, der den Tod und die Auferstehung Jesu Christi nicht nur äußerlich bekennt, sondern sich auch innerlich ganz und gar mit dem Erlöser eins weiß. Er lebte aus dem Glauben, dass aus dem Tod neues Leben wird, wenn er aus Liebe gestorben wird. Er hatte verstanden, dass die Lebenshingabe zwar zum Sterben, aber niemals zum Tod, sondern in die Ewigkeit führt.
Der Schlauberger Brecht und die teutonische „Aufgeklärtheit“
Die Botschaft der Liebe, die dieser Polizist gelebt hat, darf einen allerdings zunächst beschämen, bevor sie einen rührselig macht. Sie darf daran erinnern, dass wir Christen mit Ostern etwas feiern, dass nicht nur aller Bewunderung wert, sondern das alltagsentscheidend ist. Dort, wo das Weizenkorn in den kleinsten Winkeln unseres Lebens – und auch in den verborgenen – stirbt (aus Liebe!), erst da bringt es reiche Frucht.
Man wünscht sich, dass viele in unseren gegenwärtigen Zeiten der religiösen und kulturellen Verwirrung das Zeugnis dieses hingebungsvollen Gendarmen erreichte, besonders dort, wo das Christentum Design geworden ist und seine reale Bedeutung verloren hat, wo Christus allenfalls noch ein Impulsgeber ist, aber schon lange kein Erlöser mehr, weil man sich schließlich seine Erlösungen selbst zurechtgelegt hat.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Oder wo – besonders in der Tradition teutonischer Aufgeklärtheit – ein ernsthaftes Christsein in den Ressentiments der Majoritäten als eine Form gefährlicher Verdummung empfunden wird. So wie es Bertold Brecht, der Doyen aller literarischen Kämpfer gegen die Vorstellung eines Himmels jenseits der Erde, bereits 1925 zum Ausdruck brachte, als er in seinem Gedicht „Gegen Verführung“ schrieb:
„Lasst Euch nicht verführen!
Es gibt keine Wiederkehr.
Der Tag steht in den Türen,
ihr könnt schon Nachtwind spüren:
Es kommt kein Morgen mehr.Lasst Euch nicht betrügen!
Das Leben wenig ist.
Schlürft es in vollen Zügen!
Es wird Euch nicht genügen,
wenn Ihr es lassen müsst!Lasst Euch nicht vertrösten!
Ihr habt nicht zu viel Zeit!
Lasst Moder den Erlösten!
Das Leben ist am größten:
Es steht nicht mehr bereit.Lasst Euch nicht verführen
zu Fron und Ausgezehr!
Was kann Euch Angst noch rühren?
Ihr sterbt mit allen Tieren
und es kommt nichts nachher.“
Diese Form der Häme ist uns aus der Bibel wohlbekannt. Sie kommt aus dem Mund des hadernden Schächers, der neben dem gekreuzigten Christus ebenfalls an einem Kreuz auf seinen Tod wartet und der die Kapitulation vor dem Leben und dem Sterben in den Vorwurf presst, der Messias sei ein machtloser Erlöser und deswegen eben kein Erlöser.
Dem gegenüber steht der Todgeweihte, der auf der anderen Seite neben Jesus hängt und der in Ihm denjenigen zu entdecken vermag, von dem er offenbar sicher ist, dass Er gleich siegreich durch das Tor des Lebens gehen wird. Nicht um es hinter sich wieder zu verschließen, sondern um alle mitzunehmen, die an Ihn glauben.
Ins Paradies führt keine Automatiktür
Wohlgemerkt: die an Ihn glauben. Diese entscheidende Nuance in dem ultimativen Dialog der todgeweihten Gekreuzigten auf Golgotha wird in unseren Tagen gern mehrheitlich und geflissentlich übersehen. Dass es zum Erreichen des Zieles den Glauben braucht und dass das Paradies, das Christus verspricht, nicht wie durch eine Automatiktür betreten werden kann, der man sich einfach nur nähert, egal, was man in seinem Herzen trägt, und die dann aufspringt, ohne dass man dazu einen anderen Beitrag zu leisten hätte, als einfach nur am Ende seines Lebens angekommen zu sein.
Nein, das Tor, das der Erlöser am Kreuz aufschließt, wird nur denen zum Eingang in das Leben in Fülle, die im irdischen Leben bereit und in der Lage waren, ihre Sünden und Fehler zu erkennen und zu bereuen – und sei es im letzten Augenblick. Die Allerlösungstheorien neuzeitlicher Theologen, die davon ausgehen, dass alle Menschen voraussetzungslos gerettet werden und dass folglich das Lebensziel nicht verfehlbar ist, haben dies erfolgreich verschleiert. Ein Schaden, der die Kirche nicht nur den Kern ihrer Moral gekostet hat, sondern auch den Impetus für ihre Mission, die über Jahrhunderte unter großen Mühen dafür sorgte, dass Menschen die Bedingung der Möglichkeit zum Eingang in das Paradies erwerben konnten: den Glauben.
Zu Ostern sollte dieser Aspekt der christlichen Offenbarung nicht im allgemeinen Jubel untergehen, nämlich dass die Erlösung zwar ein Angebot für alle Menschen ist, dass sie aber dennoch nicht voraussetzungslos ist. Es ist eben nur einer der beiden Schächer, dem die Gewissheit geschenkt wird, mit Jesus in Seinem Reich leben zu dürfen – und zwar als Lohn für seine Entscheidung zum Glauben.
Es braucht ein Ja zu Jesus Christus, egal wann und egal wie laut
Dazu den Menschen zu helfen, ist die Aufgabe der Kirche. Und es ist nicht ihre Aufgabe, die Menschen in ihrer Selbstbezüglichkeit, ihren Zweifeln und Abgründen zu bestätigen, wie es sich hier und da als Trend unter unteren und oberen Hirten herausbildet.
„Alle, alle, alle“ (Papst Franziskus) sind zwar willkommen, aber nicht „alle, alle, alle“ werden nach einem Wort Jesu selbst durch den Eingang zu Seinem Reich passen, den Er zwar geöffnet hat, der aber immer noch eine schmale Pforte bleibt. Nein, es braucht ein „Ja“ zu Jesus Christus – egal wann und egal wie laut –, aber es muss von Herzen gesprochen werden, damit der Mensch eine Zukunft nach der Zukunft hat.
Zumal es ja auch in der Vorstellung von der Erlösung liegt, dass Jesus Christus nicht nur zum Zeichen oder womöglich aus reiner Solidarität mit den Menschen gestorben ist, sondern zur Sühne für die Last der Sünden der Menschen. Ein Gedanke, der fast völlig aus dem Vokabular zeitgeistlicher Erwägungen zu Kreuz und Auferstehung gestrichen ist.
Ein Opfer ohne ein dankbares Ziel ginge ins Leere
Just in dem Augenblick, als ich diese Zeilen schreibe, berichtet die FAZ – ganz dazu passend – von einer Aktion in der evangelischen Salzburger Christuskirche, bei der in einer Performance die Sühnopfervorstellung vom Tod Jesu als Wiedergutmachung für die Sünden der Menschen rituell beerdigt wurde. Beim letzten Palmsonntagsgottesdienst wurde in der Kirche ein Spiegel herumgereicht, in dem jeder sich selbst betrachten und lernen sollte: Ich bin gut so, wie ich bin! Heißt übersetzt: Es muss meinetwegen niemand sterben!
Die FAZ stellt dazu die berechtigte Frage: „Ist das nicht eine Glaubenspraxis des buchstäblichen Narzissmus, der wirklich keines Opfers und keiner Vergebung mehr bedarf?“ Die christliche Tradition hingegen sagt – noch bevor sie wie in Salzburg vom Bachchoral bis zur Bibel herauspurifiziert wurde: Jesus stirbt für die von Menschen falsch und nicht für Ihn und Seine Wahrheit gefällten Entscheidungen.
Schon von daher ist die Vorstellung von der quasiautomatisierten Erlösung aller Menschen absurd. Denn der Umkehrschluss vom Opfergang Jesu zu den Verfehlungen der Menschen, derentwegen Er ihn geht, verlangt den Glauben, die Reue und den Dank derer, für die Er gestorben ist. Ein Opfer ohne ein dankbares Ziel würde ins Leere gehen.
Der Himmel – geschenkt und erworben zugleich
Und so versteht sich der Himmel als etwas Geschenktes und Erworbenes zugleich – erworben durch das Sühneopfer Jesu Christi und weitergeschenkt durch die Gnade Gottes an alle Menschen, die sich demgegenüber dankbar zeigen.
Die Hingabe des Arnaud Beltram zeigt diesen inneren Zusammenhang von Opfer und Erlösung. Denn ohne Liebe hätte er seinen Schritt nicht tun können. Marielle, seiner Verlobten, blieb deswegen nach seinem Tod nicht nur Trauer, sondern auch Hoffnung, die sie nach dem Tod ihres Mannes im Wissen um seinen Glauben aussprechen konnte: „Mit großer Hoffnung erwarte ich an Ostern die Feier der Auferstehung mit ihm.“
Das ist es, was wir jetzt Ostern feiern: das Fest des Opfers Jesu, aus dem die Auferstehung hervorgeht und in dem der Tod aller seinen Tod gefunden hat, die mit Ihm zur Hingabe bereit sind.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?



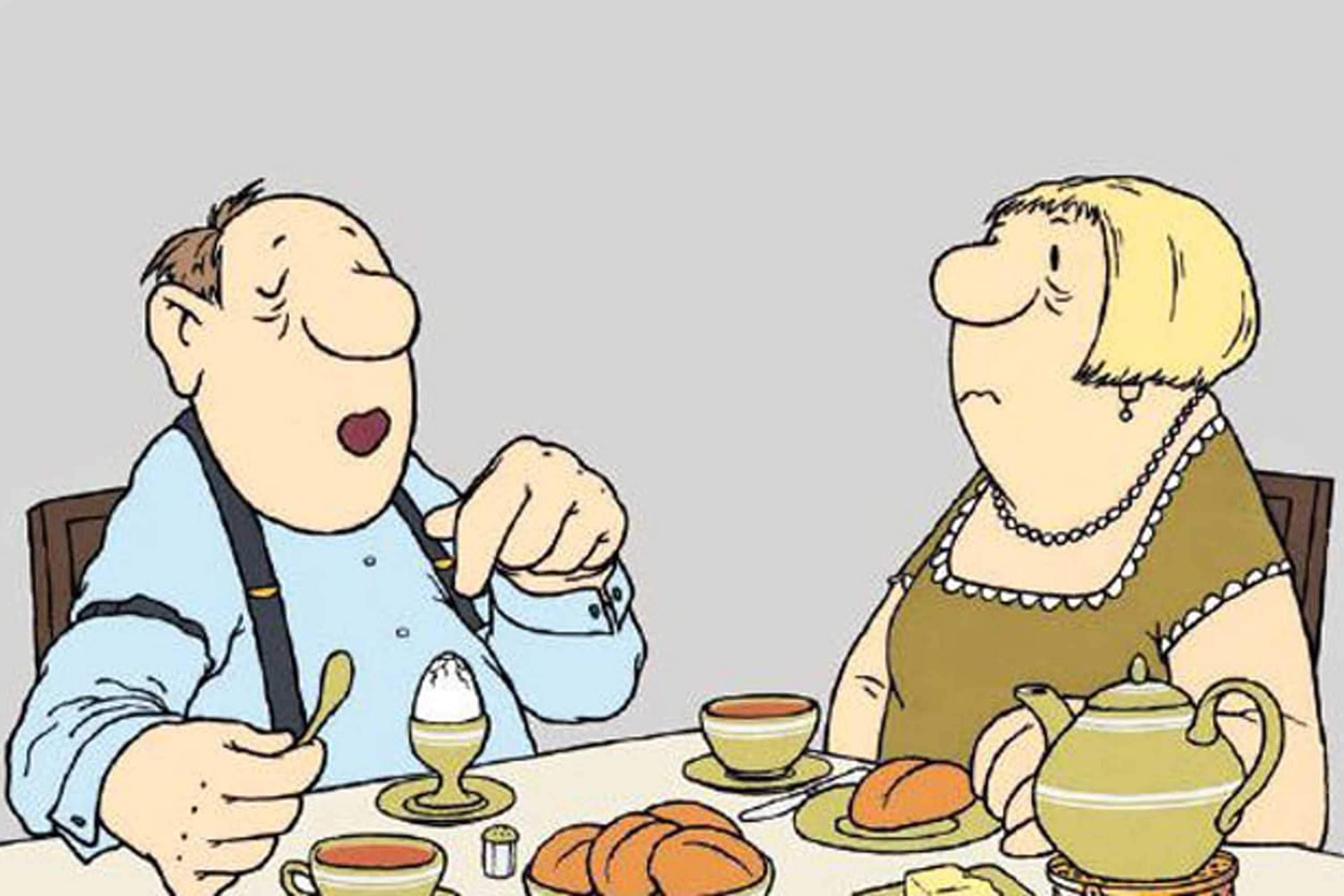

Kommentare