Sieben kurze Weihnachtsgeschichten

Ein Weihnachtswunder auf der Bank
Von Joyce Küng
In der hektischen Vorweihnachtszeit, in der oft andere Dinge im Vordergrund stehen als das Fest der Liebe und Besinnlichkeit, möchte ich Ihnen eine besondere Geschichte erzählen, die sich vor vielen Jahren in einer kleinen Filiale einer Schweizer Bank zugetragen hat.

Als junge Banklehrtochter durfte ich am 24. Dezember 2001 meinen Schalterdienst in der Nachbarfiliale verrichten – an einer Kasse ohne das automatische Geldzählsystem, an dem ich ausgebildet worden war. Normalerweise arbeitete ich in einer Filiale mit moderner Technik. Doch an diesem besonderen Tag, kurz vor Weihnachten, wurde ich in eine kleinere Filiale versetzt.
Die Aufgabe schien einfach: Kunden bedienen und Geld auszahlen. Doch es sollte anders kommen. Ein älterer Herr betrat die Filiale und wollte für seine Enkel je 1.000 Franken vom Konto abheben. Routine, dachte ich, bis mir ein folgenschwerer Fehler unterlief. Bei einer Kontobuchung übergab ich dem Herrn versehentlich ein ganzes Zehnerbündel Tausender-Noten – ein Flüchtigkeitsfehler, der 9.000 Franken zu viel bedeutete.
Es war Heiligabend und alle Mitarbeiter wollten nach Hause. Doch es galt die Regel, dass bei einem Fehlbetrag von mehr als 2.000 Franken die Polizei eingeschaltet werden muss. Ich ließ es mir nicht anmerken, aber ich betete Sturm um ein Wunder.
Doch dann nahm das Schicksal eine unerwartete Wendung: Der ältere Herr, wohl der ehrlichste Mensch der Welt, rief gegen 17.30 Uhr an, um einen Termin für die Rückgabe des Fehlbetrags zu vereinbaren. Er war überrascht von dem Fund. Der Kunde wurde für seine Ehrlichkeit belohnt, und ich konnte erleichtert in ein besonders schönes Weihnachtsfest gehen.
In den dunklen Stunden der Verzweiflung leuchtete das Weihnachtslicht in meinem Herzen – eine Erinnerung daran, dass es inmitten von Fehlern und Herausforderungen auch Raum für Menschlichkeit und Großzügigkeit gibt.
Möge diese Geschichte uns alle daran erinnern, dass die wahren Weihnachtswunder oft in den einfachen Taten der Güte und des Vertrauens verborgen sind.
Das Christkind im Doppelpack
Von Christian Rudolf
Ein Blick auf die Uhr: Der Heiligabend rückt näher. Was tun in der großen Stadt im Ausland? Ein Freund besucht mich im Warschauer Studentenwohnheim, ein paar wenige andere Deutsche sind auch über Weihnachten nicht nach Hause gefahren. Und nun? Wir fahren mit dem Bus ins Zentrum, ein Restaurant für uns alle zu suchen. Laufen durch die Hauptstraßen, stapfen durch Schneeverwehungen, spähen durch trübes Lampenlicht. Doch die Innenstadt ist wie ausgestorben. Keine Speisewirtschaft weit und breit, nicht einmal eine Bar hat auf, und überhaupt ist kein Mensch zu sehen. Ja klar, fangen wir an zu begreifen, alle sind bei ihren Familien, sitzen miteinander zu Tisch bei rotem Barszcz, Mohnklößchen, Hering in Öl und Karpfen an geschmortem Gemüse. Und wir bekommen langsam Hunger.
Es ist bitterkalt, und wie von selbst führen uns unsere Schritte zum Zentralbahnhof. Es wird doch wohl hier etwas geöffnet haben? Wir suchen die Gänge und Winkel ab. Und landen schließlich beim hellerleuchteten McDonald’s, das scheinbar 24/7 die Pforten offenhält. Unser Festessen ist minutenschnell serviert und besteht aus Cheeseburger, Cola und Pommes frites. Wir unterhalten uns auf Deutsch, sind lustig und nicht zu überhören.

Im Restaurant nur wenige Gäste, ein paar Tische weiter zwei Mädchen in dicken Anoraks. Man guckt rüber, wie man halt rüberguckt, nichts weiter. Nach einer Weile wenden wir uns zum Gehen, sind schon in der Tür, da spricht uns die Jüngere von beiden auf Deutsch an.
Später versuchen mein Freund und ich zu rekonstruieren, wie das eigentlich genau abgelaufen war, wer zuerst was zu wem gesagt hat. Wahrscheinlich war es so, dass sie einfach fragte, ob wir aus Deutschland kämen, was wir ganz sicher bejaht und zurückgefragt haben, woher sie denn seien. Oh, von so weit, aus Riga, schön! „Und was macht ihr hier?“ „Wir sind hierher getrampt, die Stadt anzugucken“, lächelt sie verschmitzt.
„Und wo seid ihr untergekommen? In der Jugendherberge?“ „Tja, also“, und jetzt muss sie lachen, „nee, wir laufen hier schon seit zwei Tagen rum, am Tag waren wir im Museum und spazieren, abends haben wir ein bisschen im Wartesaal geschlafen, bis uns die Security weggeschickt hat … und so gingen wir zu McDonald’s. Hier ist es warm.“ Mein Freund und ich gucken uns an. Darauf ich: „Also, wir wohnen im Studentenwohnheim nicht weit weg. Wenn ihr mögt, könnt ihr gern mitkommen!“ Die beiden greifen nach ihren Rucksäcken, und da wir nicht aussehen wie Menschenfresser, kommen sie mit.
Die beiden Schwestern, so stellt sich heraus, sind schon drei Tage auf den Beinen und ziemlich übernächtigt und verfroren. Daiga ist gerade im Abi-Jahr, Ilma ist 20 und studiert. Beide haben lange Haare und sind voll nett. Von der Schule her sprechen beide sehr passabel Deutsch. Ich gebe ihnen Handtücher und zeige den Weg zu den Duschen über den Flur. Sie sind sichtbar froh. In unserem Wohnheimzimmer ist in der Mitte genug Platz. Wir legen derweil ein Tuch hin und holen unsere Essvorräte hervor, kochen Tee.
Wir setzen uns. Neugierig beschnuppern wir uns, fragen, erzählen, rauchen. Wie feiert ihr Weihnachten, wie ist es bei euch? Später singen wir Lieder, jeder in seiner Sprache. Sie bringen uns ein lettisches Volkslied bei, und da Smartphones noch nicht erfunden sind, schreibt Daiga es uns auf. Es handelt von einem Insekt, das auf dem Meer schwimmt und nicht auf den Grund sinkt. Es hält sich tapfer an der Oberfläche. Erst am Abend des dritten Tages sinkt es auf den Meeresboden. Daigas lettische Handschrift ist ganz anders als die deutsche Art zu schreiben, und sie malt Insekten und Käferchen zur Erklärung auf das Blatt. Uns ist warm und behaglich, und wir sind alle ziemlich vergnügt. Vor Mitternacht brechen wir noch auf und gehen zusammen in die Christmette. Die Erlöserkirche ist gerappelt voll. Stille Nacht, heilige Nacht. Sehr spät schlafen wir alle sehr glücklich ein, und ich begreife so langsam, dass dieses Weihnachten das Christkind gleich im Doppelpack zu uns gekommen ist.
Wenn das Blaulicht zuckt und die Weihnachtsmänner anrauschen
Von Kristian Beara
Jedes Jahr in der Adventszeit und zu besonderen Anlässen sind die Weihnachtsmänner der „Biker for Kids Cologne“ auf Motorrädern unterwegs, um Spenden zu sammeln und Geschenke zu übergeben. Diese werden auch in Kinderkrankenhäusern und Kinderheimen verteilt. Seit 1997 erfreuen sich Kinderherzen immer wieder aufs Neue ob dieser tollen Aktionen.

Und auch während der Durchreise der „schweren Jungs“ winken zahlreiche Passanten am Wegesrand voller Begeisterung den Männern und Frauen zu. Die Mitglieder des Vereins „Biker for Kids Cologne“ sind ein beliebtes Fotomotiv. Kein Wunder, schließlich wirkt es beeindruckend, wenn viele Weihnachtsmänner mit weißen Rauschebärten und roten Anzügen auf großen Maschinen durch die Straßen Kölns und des Kölner Umlands fahren.
Und so begab es sich, dass auch ich mit diesen tollen Menschen unterwegs sein durfte und wir am 3. Dezember 2023 schwerkranken Kindern (und deren Angehörigen) mit einem Besuch der „Biker for Kids Cologne“ und der Motorradpolizisten der Kölner Polizei ein paar Minuten Ablenkung schenken konnten.
Es ist schwer vorstellbar, wie der Alltag einer Familie unter derart schicksalsträchtigen Umständen durch die lebensbedrohliche Krankheit eines Kindes aussehen muss. Mit dabei auch mein guter Freund Don, der sich seit Jahren in der Patientenhilfe engagiert. Er selbst erkrankte vor Jahren an Krebs und gilt inzwischen glücklicherweise als geheilt.

„Wir wollen, dass die kleinen Patienten einfach mal für einen kurzen Moment all ihre Schmerzen und ihr großes Leiden vergessen. Wir wissen, dass die Kleinen total auf Polizei stehen. Wenn das Blaulicht zuckt und wir vorfahren, dann ist das für sie ein spannender Moment. Wenn es dann noch einen Teddy und Geschenke gibt, dann ist die Welt für einen Augenblick viel besser“, erzählt Don.
Ich selbst habe damals den Sohn meines Trauzeugen ein Jahr lang fast täglich auf der Kinderkrebsstation besucht und begleitet. Mein Gleichaltriger durfte in der Zeit gesund zu Hause spielen. Nichts hat mein Leben mehr geprägt als dieser starke und stets gutgelaunte Kämpfer, der den Kampf gegen den Krebs auch meisterlich gewonnen hat. Diese Erfahrung macht mich maximal demütig und lässt mich anders auf viele angebliche Probleme blicken.
Weihnachten auf dem Dorf in der Slowakei
Von Kristina Ballova
Leuchtende Kinderaugen, Schnee und jede Menge Essen: Weihnachten auf dem slowakischen Land ist immer das schönste Fest des Jahres. Und es bleibt immer gleich: die gleiche CD mit slowakischen Weihnachtsliedern, der gleiche Kartoffelsalat, den Papa macht, die gleichen Lebkuchen, die gemeinsam gebacken und verziert werden.
Nur wir verändern uns – von meinen sieben jüngeren Geschwistern sind fast alle erwachsen, einige haben bereits eigene Familien und Kinder. Zur gemeinsamen Zusammenkunft wird diesmal das Wohnzimmer nicht reichen, ein Saal im Dorfzentrum muss gemietet werden.
Die slowakischen Traditionen variieren von Familie zu Familie. In meiner Familie verläuft der Heiligabend seit Jahren exakt gleich. Der Papa liest aus der Bibel und segnet das Wohnzimmer mit einem Tannenzweig, daraufhin wünschen wir uns frohe und gesegnete Weihnachten. Beim Kerzenlicht wird ein Lindenblütentee getrunken und Honigwaffeln, Früchte und Nüsse gegessen.

Da der Heiligabend als Vorabend des Festes und somit noch als Fastenzeit gilt, wird auf Fleisch verzichtet. Es gibt eine Krautsuppe und Fischfilet mit Kartoffelsalat. Erst nach dem Essen darf man zu den Geschenken blicken – sie sollen auch nicht im Fokus stehen, sondern die Weihnachtsfreude bereichern.
Ein unverzichtbarer Teil des Abends war immer der Besuch bei meinen Großeltern. Beim Eintritt ins Haus sangen wir Weihnachtslieder und wünschten uns ein gesegnetes Weihnachtsfest. Auch dort gab es Geschenke und ganz viele Kuchen der Oma – der „Babka“, wie wir sie nannten. Besonders der Weihnachtskuchen mit Mohn, Nüssen und Quark. Den mochte ich als Kind nicht. Heutzutage, wo solche aufwendigen Desserts selten geworden sind und meine Oma nicht mehr lebt, würde ich viel dafür geben, den Kuchen wieder zu essen.
Überhaupt ist alles anders, seit sie nicht mehr am Leben ist. Es gibt Menschen, die die Seele der Familie ausmachen. Mit ihnen geht auch der Zauber solcher Feste und der eigenen Kindheit. Meine Oma zeigte ihre Liebe immer durchs Kochen. An nichts mangelte es bei ihr. Während wir um Mitternacht die Christmette in der Dorfkirche am Berg besuchten, hat sie bereits Schnitzel gebraten. Die schmeckten dann auch mitten in der Nacht ganz besonders.
Kinder glaubten bei uns, dass nicht nur die Geschenke, sondern auch der Weihnachtsbaum vom Christkind gebracht werden. Die älteren Geschwister hatten die Aufgabe, gemeinsam mit den Eltern alles vorzubereiten und es vor den jüngeren Geschwistern geheim zu halten. Wir fühlten uns in das Geheimnis eingeweiht und genossen es, die Augen der kleinen Geschwister leuchten zu sehen, als sie den Baum und die vielen bunten Geschenke darunter sahen.
Weihnachten ist immer zauberhaft. Ob am Land oder in der Stadt, es sind die Menschen, die es besonders machen. Und dennoch freue ich mich ganz besonders auf die leuchtenden Augen meiner Kinder, wenn sie bei ihren slowakischen Großeltern die Geschenke auspacken und die Schnitzel ihrer Oma genüsslich aufessen.
Heiliger Rauch
Von Lukas Steinwandter
Dieser kleine Text beginnt mit einer kleinen Beichte: Als Kind habe ich an Weihnachten meist nicht gern gebetet. Wie auch, wenn die Erwartung schon seit Wochen im Kopf ist, wonach die Kinder beschenkt werden, im Idealfall mit dem, was sie dem Christkind auf einem Zettel liebevoll notiert hatten. Wann kommt das Christkind endlich und bringt das neue Lego-Set, oder wird es doch das ferngesteuerte Auto? Doch ein Brauch meiner Hochpustertaler Heimat ließ mich seit jeher über die damals empfundene Ödnis des Gebets hinwegsehen: das Räuchern.

Es ist Heiligabend, die Sonne schon längst verschwunden. Draußen liegt Schnee, drinnen steigt ein wohltuend würziger Geruch in die Nase. Der Hausvater hat gerade Weihrauch auf die heiße Kohle im Räucherfass oder die Räucherpfanne gestreut. Was so hervorsticht, ist die Meisterwurz. Wie aufregend es war, als ich das erste Mal mit meinem Onkel im Sommer mit in den Wald auf die Suche nach der Heilpflanze gehen durfte.
Oma nimmt den Rosenkranz und beginnt jene Verse anzustimmen, die schon ihre Großmutter sprach, immer an Heiligabend, zu Silvester und am Fest der heiligen drei Könige. Der Rosenkranz wird so lange gebetet, bis die Hausgemeinschaft – in unserem Fall mehrere – alle Räume der Häuser mit dem Weihrauch durchzogen und mit Weihwasser gesegnet hat.
Der bayerische Theologe und Chronist Sebastian Franck notierte1534: „Die zwolff naecht zwischen Weihnacht und Heyligen drey Künig tag ist kein hauß das nit all tag weiroch rauch in yr herberg mache für alle teüfel gespenst vnd zauberey.“ Die zwölf heiligen Nächte zwischen Christtag und Dreikönigstag werden auch Raunächte genannt. In vielen europäischen Regionen wird ihnen seit jeher eine besondere Bedeutung zugemessen.
Wie im Katholischen üblich – et-et –, hat der Brauch nicht nur einen spirituellen Effekt, nämlich böse Geister und Dämonen abzuwehren, sondern auch einen rationalen: Etwas großzügiger eingesetzt, treibt der Rauch das Ungeziefer aus. In den früher landwirtschaftlich dominierten Zeiten ein nicht zu unterschätzender Aspekt.
Und heute? Liebe Landsleute, setzt den Brauch fort oder führt ihn wieder ein, denn er fasziniert die Kinder, bis sie schließlich älter werden und erkennen, dass es an Weihnachten nicht nur um Geschenke geht.
Mehr Himmel auf Erden geht nicht
Von Josef Jung
Dezember 2010: Weit weg von zu Hause, in Chicago. Thanksgiving verbrachte ich bei einer befreundeten Familie in Detroit. Jetzt stand Weihnachten vor der Tür. Nach Hause fliegen konnte ich nicht, viel zu teuer und enorm umständlich. Also war ich war auf die Gastfreundschaft meiner Chicagoer Kontakte angewiesen, um Weihnachten nicht allein im anonymen Hochhaus verbringen zu müssen.
Man kann über die Amerikaner sagen, was man will, aber eines habe ich während meiner USA-Reisen immer erfahren und es hinterlässt in mir eine tiefe Dankbarkeit und innere Verbundenheit: Gastfreundschaft.
Ein Kommilitone aus Rhode Island in Neuengland lud mich über die Festtage zu sich ein. Ich sei ganz herzlich willkommen, solle mich einfach entspannen und wie zu Hause fühlen, und er zeige mir gern auch gleich das zu jeder Jahreszeit herrliche New England. So verbrachte ich wunderschöne Weihnachten bei einer amerikanischen Familie an der Ostküste mit allem, was dazugehört.

Drei amerikanische Generationen saßen an einem Tisch. Der Großvater, der seine Frau verloren hatte und von Präsident George W. Bush enttäuscht war, der Vater mit seinem viel zu großen Pickup, der nicht in die Garage passte, und die Kinder, welche, ganz amerikanisch, die buntesten Weihnachtspullover trugen, die man sich vorstellen konnte.
Die Mutter hatte den Weihnachtsbaum phänomenal geschmückt und es gab typisch amerikanische Speisen: Truthahn und White Cake. Für einen Tag war ich Mr. Red White and Blue.
Mit „Silent Night“ endete die feierliche Weihnachtsmesse in der St. Thomas More Parish in Narragansett. Mehr Himmel auf Erden geht nicht.
Wenn aus „Waise-Weihnacht“ „Ihr Kinderlein kommet!“ wird
Von Chris Becker
Meine Cousine singt deutlich besser als ich, so wie meine Schwester, meine Tante, im Grunde sämtliche meiner Verwandten, die sich zum weihnachtlichen Singen am zweiten Feiertag versammelt haben. „Halleluja!“ singen sie zu den Worten von Leonard Cohen, die, in unvergleichlich talentierter, hingebungsvoller Stimmgewalt vorgetragen, das Wohnzimmer meiner Großeltern ausfüllen.
Das Wohnzimmer unserer Großeltern auszufüllen ist die älteste und beharrlichste Weihnachtstradition, die mir einfällt und über die es sich zu berichten lohnt. Das liegt zum einen daran, dass dieses Wohnzimmer sich scheinbar zum Ausfüllen qualifiziert, wenn man den Schwarm an Engelsfiguren, Familienfotos und Dekorationen betrachtet, den unsere Großmutter zu Lebzeiten (wohlgemerkt unabhängig von Weihnachten) dort andächtig einquartierte.

Zum anderen scheint das weihnachtliche Singen am 26. Dezember eine ihm eigene Resistenz herausgebildet zu haben, die allem trotzt. Scheidungen, Geburten- und Sterbefälle sowie Corona-Auflagen prallen daran ab. Ohne das „Tochter Zion“ aus Opas Klang- und Genpool ist die Menschwerdung Gottes scheinbar aufgeschoben. In dieser Familie hießen vier Kinder und zehn Enkelkinder ihren Heiland willkommen
Dann erst kann es Weihnachten werden, denn dem Kind in der Krippe verdanken wir alles, was wir sind und was wir haben. Das Weihnachtsfest in der Spätphase des Zweiten Weltkriegs verläuft weniger ausgefüllt. Ein neunjähriger Waisenjunge bittet das Kind in der Krippe um seine Fürsprache; seine Schwestern hat er schon lange nicht mehr gesehen, die Erinnerung an die Eltern verblasst allmählich. Die Schwestern im Waisenhaus sind streng, um die Kleinsten müssen sich die älteren Schuljungen kümmern, Ausgang gibt es nur an Sonntagen für zwei Stunden. Der kleine Junge, den ich heute ehrfürchtig und liebevoll „Opa“ nennen darf, erinnert sich ungern an seine Kindheit und die Jahre im Waisenhaus.
Eine eigene Familie ist sein größter Wunsch, den ihm Oma und deren Verwandtschaft nach dem Kennenlernen erfüllen. Noch vor der Hochzeit wird er von seinen zukünftigen Schwiegereltern aufgenommen (obschon er ordnungsgemäß im Zimmer der Jungen zu nächtigen hat), indes hatte ein strenger Lehrmeister den werdenden Gesellen zum Besuch der Sonntagsmesse angehalten.
Das Krippenkind lässt das Waisenkind nicht hängen. Es entsteht ein immerwährendes Bündnis. Auf die Hochzeit folgt der erste Weihnachtsbaum, die Geburt meines Onkels und schließlich eine Schar an Nachkommen, deren Namen sich beim besten Willen niemand auf Anhieb merken könnte.
Unser Gott ist immer für Überraschungen gut. Niemand hätte erwartet, dass der „Schöpfer aller Ding“ sich die Blöße gibt, einem unbedeutenden Waisenjungen zu der Familie zu verhelfen, die er niemals hatte und sich ehern erträumte. Gleichwohl hat doch niemand von ihm verlangt, geliebte Menschen aus unserer Mitte zu entfernen, sei es durch Trennung, Krankheit oder das Grab. Die allergrößte Überraschung aber bleibt seine Menschwerdung selbst, seine vollständige, selbstgewählte Anteilnahme an Ohnmacht und Allmacht. Wie können wir den empfangen, der uns nicht einfach nur gemacht hat, sondern auch mit uns leben und sterben will, als Teil dieser Welt? Seit uns Weihnachten gegenwärtig ist, suchen wir dafür Wege. So viele Traditionen haben sich herausgebildet, um diesem Wunder Raum zu geben. Sie alle sind herrlich und auf ihre Weise wunderbar.
In dieser Familie singen wir, traditionell. Aus voller Kehle. Manche klanggewaltig, andere etwas schüchtern, aber mit derselben Überzeugung. Wir singen andächtig „Adeste Fideles“ und „O Tannenbaum“. Am liebsten singen wir „Ihr Kinderlein kommet“ und denken dabei an diese zauberhaften kleinen Wesen, in denen Gott uns am ehesten begegnet.
Wenn der Großvater in seinem Sessel sitzt, umgeben von seiner Familie, dann werde ich auch dieses Jahr wieder an das verzweifelte Waisenkind denken, welches er einst gewesen ist. Wie gut, dass unser Gott nicht in seinem Himmel geblieben ist, wie wundervoll, dass er unser Sein von der Schwachheit und Verletzlichkeit eines Kindes an allen Widrigkeiten zum Trotz durchlebt hat. Wir singen, weil wir beim Kind in der Krippe in den allerbesten Händen sind.
Die Redaktion wünscht frohe und besinnliche Weihnachten!
Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?
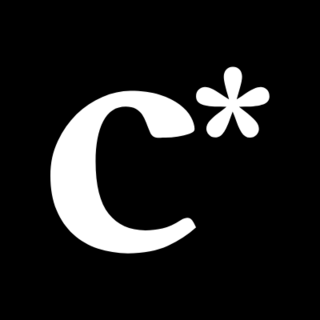




Kommentare
Tolle Geschichten. Gesegnete Weihnachtstage.
Danke sehr für diese kurzweiligen Geschichten. Da freut man sich gleich noch mehr auf morgen!
Frohes Fest!