Das Zeitgeistgericht

Das Bundesverfassungsgericht gehört zu den Staatsorganen, denen die Deutschen am meisten vertrauen. Die zwischenzeitlich geplante Nominierung von Lars Brocker – bisher Präsident des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofes und bekannt für seine Forderung nach einer Corona-Impfpflicht sowie „Verständnis“ für die fundamentalistischen „Klimaaktivisten“ der „Letzten Generation“ – als Nachfolger der Richterin Gabriele Britz ist im Februar zur Herbeiführung einer paritätischen Besetzung der Richterposten abgelehnt worden. Diese absurden Vorgänge stehen gewissermaßen symptomatisch für den Zustand des Gerichts.
Das Bundesverfassungsgericht besitzt heute eine – auch im internationalen Vergleich – beträchtliche Machtfülle. Das war allerdings nicht immer so: Nachdem das Gericht 1952 eingerichtet worden ist, musste es zunächst einen Emanzipationsprozess durchlaufen. Der Bundesgerichtshof stellte sich in die Tradition des alten Reichsgerichts und erhob dementsprechend einen Hegemonialanspruch, und die Politik war wenig begeistert von der Störung ihres Betriebs durch ein Verfassungsgericht. Am Ende hat „Karlsruhe“ die Auseinandersetzung mit beiden gewonnen und seine Position im Gefüge der Staatsorgane stetig ausgebaut.
Ein Streitschlichter, der keiner ist
Anders als der Name es vermuten lässt, ist Karlsruhe kein genuines Gericht. Materiell nimmt es als politisches Organ an der Staatsleitung teil. Seine Selbstdarstellung lebt gleichwohl davon, sich mit dem Schleier des Unpolitischen zu umgeben. Es inszeniert sich als apolitischer „Streitschlichter“, als eine Art pouvoir neutre.
Das liegt zum einen an der geringen Direktionskraft des Verfassungstexts, ist er doch naturgemäß fragmentarisch und interpretationsoffen. Zum anderen setzt das Gericht eigene politische Agenden und reagiert gleichzeitig auf außerhalb seiner selbst liegende Vorgänge, es ist Teil eines wechselbezüglichen Prozesses aus Proaktion und Reaktion.

Dabei treten – anders als im angloamerikanischen seriatim-Verfahren – im kontinentaleuropäischen per curiam-Modell die individuellen Richterpersönlichkeiten hinter die Institution „Bundesverfassungsgericht“ zurück. Die Arbeitsweise des Bundesverfassungsgerichts wird so effektiv camoufliert und die Institution mystifiziert.
Die Machtfülle des Gerichts kann sich jedenfalls nicht direkt auf eine unmittelbare Determination durch das Grundgesetz stützen, sie ist erklärungsbedürftig. Die Verfassung konstituiert Karlsruhe lediglich als reguläres Gericht mit speziellem sachlichem Zuständigkeitsbereich. Die beiden Senate operieren gleichwohl mit einer Entscheidungstechnik, die den Tatsachenstoff des jeweiligen Sachverhalts, der es eigentlich überhaupt erst zur Verfassungsinterpretation ermächtigt, in den Hintergrund drängt. Es arbeitet nach außen hin kontextunabhängig und hüllt das oft bereits feststehende Ergebnis in einen juristischen Duktus.
Die deutsche Sehnsucht nach dem Unpolitischen
Der Laie erhält so den Eindruck, die „Experten“ in roten Roben bedienten sich einer von außerrechtlichen, diskursiven Prozessen innerhalb der Gesellschaft oder persönlichen Prägungen der Richter unabhängigen wissenschaftlichen Arbeitsweise. Sein Ansehen profitiert von dieser Strategie maßgeblich, weil es seine Interpretationsleistung damit als Ergebnis einer zeitgeistlosen und fallübergreifenden Rechtserkenntnis präsentieren kann, sie gewissermaßen pseudo-technisiert.

Dieser operative Rationalitätsschein befriedigt dabei die Sehnsüchte der Deutschen. Sie stehen dem politischen Prozess eher distanziert gegenüber und sehnen sich nach Konsens. Die Deutschen haben nach einem Akteur gesucht, der diesen Zustand herzustellen vermag, und ihn im Bundesverfassungsgericht gefunden. Das Gericht wiederum hat sich nahezu perfekt in die Rolle einer pazifizierenden und integrativen Figur eingefügt.
Es profitierte dabei maßgeblich von einer vordemokratischen und autoritätsgläubigen politischen Kultur. Seine akontextuelle und ahistorische Verfassungsinterpretation erweckt den Eindruck, Karlsruhe greife auf ein neutrales und unpolitisches Verfassungsverständnis zurück. Das entspricht jedoch nicht der Realität. Das Bundesverfassungsgericht ist ein originär politischer Akteur, seine Richter sind der Sache nach also Politiker.
Politiker in roten Roben
Entsprechend lang ist die Reihe problematischer Entscheidungen. Susanne Baer, Richterin von 2011 bis 20. Februar 2023, Anhängerin von Gender Studies und Befürworterin eines aggressiven Gleichstellungsfeminismus, äußerte sich rückblickend über den sogenannten Klimabeschluss von März 2021: „Wir haben gedacht: Jugendliche haben Rechte, und es ist die Aufgabe des Gerichts, dem Gesetzgeber klarzumachen, dass er diese Rechte angemessen berücksichtigt.“
Kaum ein Satz demonstriert mehr die Art und Weise, wie das Gericht in der Realität arbeitet. Es ging nicht um die Verfassung, sondern darum, sich ideologisch in einen gesellschaftlichen Mehrheitsdiskurs einzureihen und diese Praxis in eine pseudo-juristische Erscheinungsform zu gießen. Die Kassation des „Bundes-Klimaschutzgesetzes“ am 24. März 2021 und die Verpflichtung des Gesetzgebers ist damit weniger das Produkt rechtswissenschaftlicher Erkenntnis, sondern vielmehr eine politisierte Verarbeitung soziokultureller Phänomene.

Auch die beiden Entscheidungen zur „Bundesnotbremse“ stehen ganz vorn in einer Reihe unsäglicher Verfassungsjudikate, stellen sie sich weniger als Ergebnis ehrlicher Verfassungsauslegung dar, sondern eher als Schutzmaßnahme, um eine politische Beschädigung Angela Merkels zu vermeiden. Die „Notbremse“ zählte doch zu ihren Pilotprojekten in der Hochphase der Pandemie. So reiht sich auch die Haltung von Stephan Harbarth (gegenwärtiger Präsident) ein, der 2019 als „Ziehsohn“ der damaligen Bundeskanzlerin direkt von der Abgeordnetenbank nach Karlsruhe wechselte. Das gesellschaftliche Narrativ befürwortete zum damaligen Zeitpunkt restriktive Maßnahmen; dementsprechend wagten es die Verfassungsrichter nicht, im Angesicht drohender Skandalisierung dem Zeitgeist entgegenzutreten.
Das Grundgesetz wird zur Disposition des Mainstreams gestellt
So zerbarst eine der großen Lebenslügen der Bundesrepublik. Karlsruhe ist kein Gericht und war auch nie eines. Das Bundesverfassungsgericht ist ein genuin politischer Akteur, steht aber nicht zu dieser Rolle, sondern versteckt sich hinter einem intransparenten Umhang aus Scheintechnizität. Man mag Karlsruhe zugutehalten, dass es nicht allein dafür verantwortlich ist. Verfassungsjurisprudenz enthält notwendigerweise ein dominantes Element nicht der Rechtserkenntnis, sondern der Rechtsschöpfung.
Gleichwohl lässt sich das verfassungsrichterliche Kreativitätsmoment methodisch domestizieren; hier zeigte Karlsruhe sich jedoch wenig einsichtig und rekurriert zumeist auf ergebnisorientierte Argumentation. Das Gericht bewegt sich in einem Korridor aus soziokultureller Akzeptanz, es kanalisiert also eher Standpunkte (vermeintlich) dominierender sozialer Mehrheiten.
Das Grundgesetz büßt damit einen Großteil seiner normativen Geltungskraft ein, indem es praktisch zur Disposition eines gesellschaftlichen Mainstreams gestellt wird. Es ist nicht per se verwerflich, dass das Gericht ein Akteur im Fluss des Zeitgeistes ist. Das Problem liegt vielmehr im unehrlichen Umgang Karlsruhes mit seiner Rolle.
Wer wird die Wächter bewachen?
Anspruchsvoller als die Problemdiagnose gestaltet sich indes die Suche nach Lösungen. Eine effektive methodische Domestizierung der im Rahmen der Verfassungsinterpretation besonders großen richterlichen Freiheit ist praktisch schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Quis custodiet ipsos custodes?, „wer wird die Wächter selbst bewachen?“ Über Karlsruhe befindet sich, wie sein ehemaliger Präsident Andreas Voßkuhle zutreffend feststellte, „nur noch der blaue Himmel“.

Auf der einen Seite ließe sich die Richterwahl aber auch entpolitisieren, doch ist der Prozess bereits als Folge der zur Ernennung notwendigen Zweidrittelmehrheit in Bundestag bzw. Bundesrat und der Entscheidungsfindung im jeweiligen Richterwahlausschuss in hohem Maße konsensorientiert. Andererseits könnten die jeweiligen Amtsinhaber ihren tatsächlichen modus operandi deutlicher zutage treten lassen und die historisch-kontextuelle Relativität ihrer Entscheidungen aufzeigen. Dies erfordert jedoch eine großflächige Umwälzung der gegenwärtigen Arbeitsweise des Gerichts und ist mithin eher unwahrscheinlich.
Einen Schritt in die richtige Richtung markierte jedenfalls die Einführung von Sondervoten, die Schlüsse auf das Abstimmungsverhalten sowie die Meinungsbildung innerhalb des Richterplenums zulassen. Befriedigend ist keine Lösungsvariante, sofern sich eine solche überhaupt identifizieren lässt. Die mächtige und zugleich unkontrollierbare Stellung des Gerichts mag man daher mit Recht jedenfalls teilweise als Konstruktionsfehler des Grundgesetzes bezeichnen.
Nichts ist in Stein gemeißelt
Vor diesem Hintergrund überrascht also auch die – mittlerweile abgelehnte – Nominierung Lars Brockers nicht; die SPD hat ihren personellen Vorschlag zurückgezogen. Doch Migration, Klima, Wirtschaft – es bleibt zu erwarten, dass das Gericht sich auch weiterhin in den Dienst einer gesamtgesellschaftlich dominierenden linken politischen Agenda stellt und diese auch mitgestaltet. Von methodengerechter Arbeit mit der Verfassung hat man sich dort jedenfalls längst verabschiedet.
Das Bundesverfassungsgericht ist eine „vierte Gewalt“, die ihre Funktion so geschickt ausführt, dass man bei Kritik an seiner Arbeitsweise schnell Gefahr läuft, mit dem Vorwurf der „Verfassungsfeindlichkeit“ konfrontiert zu werden. Doch trotz der schwierigen Perspektive auf mögliche Lösungen ist nichts in Stein gemeißelt. Daran kann auch der autoritäre Nimbus des Gerichts nichts ändern.

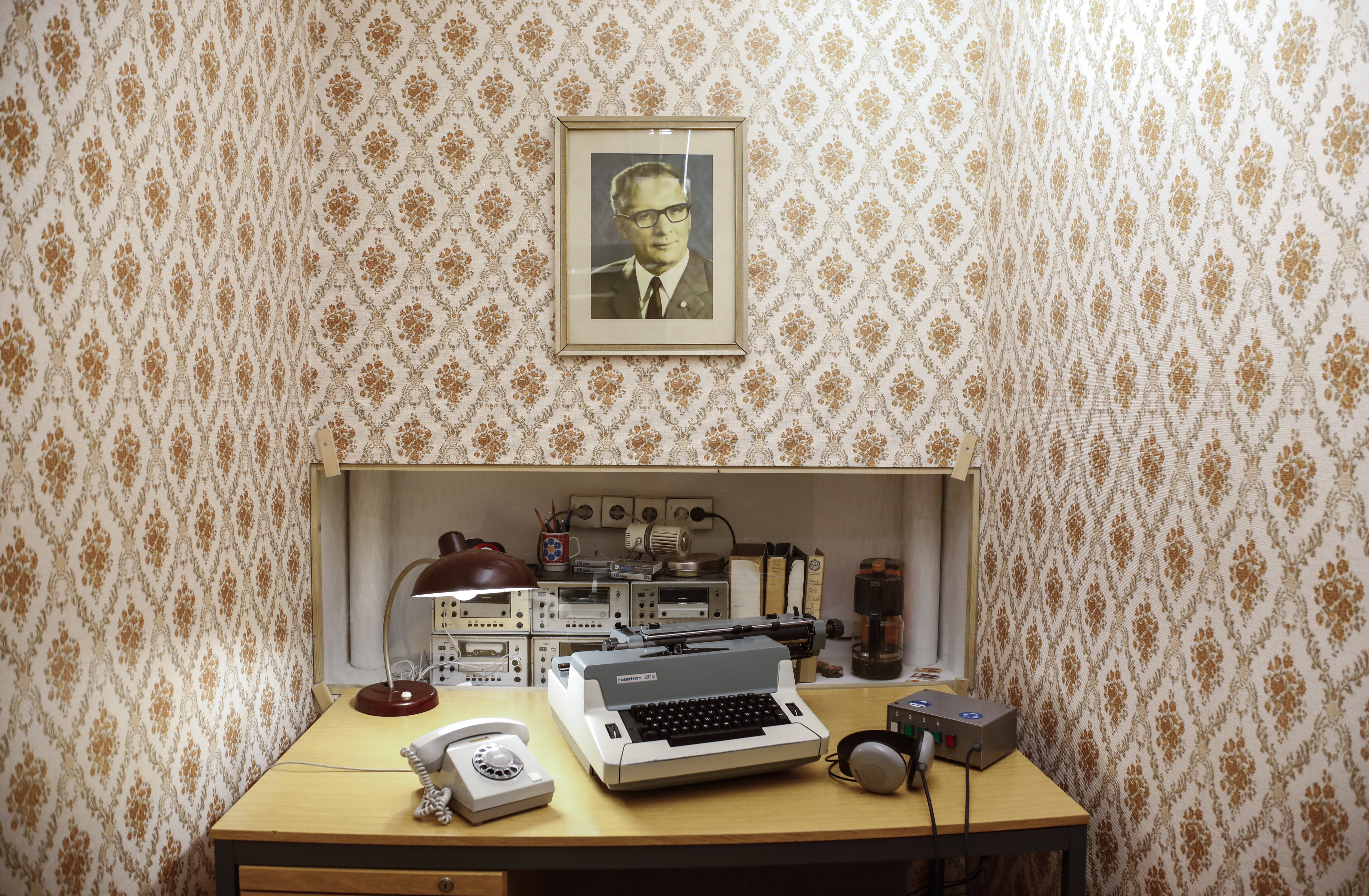



Kommentare
Vielen Dank für diesen interessanten und sehr klugen Kommentar. Die Konsequenzen und die ganze Tragweite dieser Entwicklung bzw. dieses Selbstverständnisses von „Karlsruhe“ sind freilich beängstigend. Die Ampelkoalition hat noch so manches Projekt in Petto, dass offensichtlich verfassungswidrig ist. Allein wenn die Verfassung selbst keine Rolle mehr spielt, ist auch der Begriff „verfassungswidrig“ obsolet und irrelevant. Autoritärer Willkür sind dann Tür und Tor geöffnet, nichts mehr gilt als „unantastbar“ und die Delegitimation des politischen Systems schreitet weiter voran. Es wir ungemütlich in Deutschland für alle, die nicht auf dem Gender-Klimakleber-Wokeness-Tripp sind.