Aspergeriana

Als ich mich niederlasse, um diese Zeilen zu schreiben, sind es noch exakt 19 Stunden, 32 Minuten und 43 Sekunden, bis es beginnt: das Oktoberfest. Wenn diese Kolumne erscheint, ist es bereits in vollem Gange. Bis zum 5. Oktober wird es wie in jedem Jahr mit seinen über knapp sieben Millionen Litern Bier eine Masse an Menschen anlocken. Es gilt als ein Volksfest. Wobei es nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass das, was das Fest ursprünglich ausgemacht hat, gar nicht mehr wirklich da ist.
Kein bayerischer König, keine wirklichen Trachten im Alltag, keine hart arbeitenden Menschen, die den Rest ihres Lebens wie im 19. Jahrhundert ohne Fernsehen und Freizeitangebote leben müssen und für die die Wiesn das einzige Highlight im Jahr ist. Es ist heute eher ein zusätzliches Event für ballermannfreudige Touristen. Insofern ist das Oktoberfest etwas Typisches und doch eben auch wieder nicht.
Die Feierkultur einer schwindenden Epoche
Denn die Zeit ist über die Wiesn hinweggeschritten. Das alte Oktoberfest mutiert Stück für Stück in eine Art folkloristische Love-Parade für die gutbürgerlich Besserverdienenden und die Schwergewichtigen, die sich hier noch bar jeder Häme seitens vegan orientierter säkularer Calvinisten versammeln dürfen. Es ist das Reservat der Feierkultur einer schwindenden Epoche, nach deren Untergang möglicherweise auch so etwas wie Feierlaune verschwunden sein wird – oder bestenfalls in der Bubble krachlederner Retrofans kaserniert.
Zusätzlich vernimmt man immer häufiger, dass es auch andernorts beim Feiern und Schwofen einen Schwund zu verzeichnen gibt. Kürzlich titelte die Frankfurter Rundschau: „‘Epoche geht zu Ende’: Wie die Gen Z eine Kult-Branche abschafft und sogar deutsche Städte verändert“ und schildert das Einbrechen der Club- und Discobranche. Man geht nicht mehr so gerne aus dem Haus, um Kommunikation zu haben. „Die Konkurrenz kommt heute aus dem Smartphone (...) Streamingdienste wie Spotify und Dating-Apps wie Tinder decken ab, was früher Alleinstellungsmerkmale von Diskotheken waren: Musik hören und neue Menschen kennenlernen.“ Die Digitalisierung hat also ganze Arbeit geleistet.
Feiern ist nur noch eine Option von vielen
Organisches und Analoges verschwindet mehr und mehr im Nebel von Daten und Algorithmen, die den real existierenden Menschen zu einem Digitalschatten machen, den man benutzen, kontaktieren, lieben und wieder wegwischen kann. Die Frankfurter Rundschau stellt fest: „Die Kernzielgruppe der 18- bis 25-Jährigen hat andere Prioritäten. Die Generation Z trinkt weniger Alkohol, schläft früher und meidet Stress. Feiern ist keine Wochenendpflicht mehr, sondern nur noch eine Option unter vielen.“
Ich kann es aus meinem Bereich bestätigen, nicht einmal ohne positive Implikationen. Während noch vor Jahren fromme Veranstaltungen mit Jugendlichen am Wochenende eher schwer zu realisieren waren, halte ich heute Katechesen oder Gottesdienste mühelos freitags- oder samstagsabends ab. Eine Zeit, zu der einst viele – auch die Braven – „auf die Piste“ gingen. Allein diese Formulierung kommt einem heute retro-klebrig vor und lässt vor dem geistigen Auge John Travolta erscheinen.
Dennoch verdient – abgesehen vom beschriebenen Niedergang der Partyszene – die grundsätzliche Entwicklung der menschlichen Fähigkeit zu real-analoger Kommunikation ein besonderes Augenmerk. Denn nicht nur in der Nachtclubwelt, sondern an jeder Ecke verspüren wir den Rückzug von Menschen im 3-D-Format zugunsten ihrer Digitaloberfläche, konstruiert und kommuniziert über das Smartphone. Mit verstöpselten Ohren und stierem Blick bewegen sich mehr und mehr Menschen am Ende hauptsächlich mit ihrem „Handydaumen“, um sich daddelnd und wischend in die unendlichen Weiten des Elektrokosmos zu vertiefen, in dem die anderen wie Stubenfliegen umherschwirren, um sie nach Belieben zu betrachten, einzufangen oder auch wieder zu verjagen.
Ängste und Unsicherheit in der realen Welt
Der Blick wird unsicher, wenn er sich vom Touchscreen abwendet und in die reale Welt geht. Dann entwickelt der Betrachter schnell Ängste und Phobien, wie die „Speisekartenangst“, die heute viele befällt, wenn sie bedenken, dass gleich der Kellner nach der Bestellung fragen könnte und man sich dann unter Umständen stotternd als noch unentschieden outen muss. Ein hilfreicher QR-Code versetzt die Betroffenen dann rechtzeitig in die Lage, am Tisch online zu ordern und der organischen Servicekraft erst zu begegnen, wenn sie wortkarg das digital bestellte Essen auf den Tisch knallt. Sicherheitsabstände sind seit Corona internalisierte Standards.

Man wird den Eindruck nicht los, dass mit der Inszenierung von Greta Thunberg als der Jeanne d’Arc im Kampf gegen den Klimawandel zugleich ihre neuropsychiatrische Entwicklungsstörung des Asperger-Syndroms zu so etwas wie einer Volkskrankheit avanciert ist. Denn die damit einhergehenden Merkwürdigkeiten im Interaktions- und Kommunikationsverhalten sind gegenwärtig der Grundton im Weltverhältnis der „Generation Z“, wie man die Vertreter der fünfzehn- bis dreißigjährigen Digital Natives nennt.
Es ist eine Mischung aus selbstbezüglich-eigenbrötlerischen Verhaltensweisen und einem Tunnelblick, der nur auf das trifft, was die Informationswelt aufbereitet und der sich in der Regel einem universalen Erkenntnisspektrum strikt verweigert, weil sich das nicht zweckdienlich vermarkten lässt.
Eine antrainierte Distanz
Es verwundert also nicht, dass man in schwindendem Maße Orte der analog-menschlichen Kommunikation aufsucht und das, was die Engländer Pub nennen, also eine Stätte des Zusammenseins unterschiedlichster Menschen, die jenseits ihrer Echokammern essen, trinken, lachen oder sich streiten, mehr und mehr ausstirbt. Die Krise der Gastronomie liegt ganz offensichtlich nicht nur an der preistreibenden Wirtschaftspolitik, sondern auch an dem abtrainierten Bedürfnis zum distanzreduzierten Zusammenkommen.
Selbst in der katholischen Kirche haben die verordneten Abstandsreglements der Coronakrise und dabei besonders die fetischhafte Behandlung der digitalen Kommunikation einen mächtigen Kahlschlag im vorpandemischen sakramentalen Raum der Gottesbeziehung hinterlassen.
Man ist – ähnlich wie im Protestantismus – gerne auch mit dem „reinen Wort“ zufrieden, das durch Arbeit am Bewusstsein hebt und heilt. Leibhaftige Vollzüge heiliger Handlungen – sie gelten im katholischen Glauben als unverzichtbar – werden zunehmend als überflüssig angesehen. Doch das traditionelle Bekenntnis katholischer und orthodoxer Christen benötigt zu seiner Feier Räume, Materialien wie Brot, Wein, Öl, Gewänder, Geräte, bildende und anfassbare Kunst. Und schließlich Menschen aus Fleisch und Blut, die die Sakramente spenden und empfangen.
Digitale Verstümmelung
Wohlgemerkt empfangen und nicht herunterladen! Denn so wenig wie Jesus Christus als menschenfreundliches Programm, sondern als organischer Mensch in die Welt gekommen ist, so erscheint die damit verbundene Erlösung schließlich nicht als KI-Kopfgeburt eines Tages irgendwelchen Hirten vor deren geistigem Auge, sondern liegt höchst fleischlich und real in Bethlehem in einer Futterkrippe.
Die Inkarnation ist ein Wunder, ja, aber sie ist keine Einbildung! Sie holt den Menschen dort ab, wo er als das Wesen steht, das als einziges unter den Lebewesen die Fähigkeit zur Selbstreflexion besitzt. Es hat eine leib-geistige Verfassung, die es in die Lage versetzt, die Welt mit Händen zu ergreifen und mit dem Verstand zu verstehen. Zumindest das, was dieser Verfassung zugänglich ist.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Genau hier versickert gegenwärtig die Ganzheit des Menschen zugunsten einer digital-virtuellen Verstümmelung. Am Ende der Nahrungskette dieser Entwicklung stehen leere Kirchenbänke leeren Restaurants gegenüber. Hatte man einst gedacht, der Säkularismus würde in den Dörfern nur die Kirche entbehrlich machen, den Rest des Dorflebens aber in profanierter Form weiterleben lassen, so muss man jetzt feststellen, dass auch der Gasthof seine Zeit gehabt hat. Er kann mitsamt den anderen Kulissen von Kirchen, Tante-Emma-Läden und Bauernhöfen weggeräumt werden. Weil sich hinter diesen Kulissen kein Leben mehr verbirgt.
Analog zu diesen kommunikativen Entwicklungen erfasst die modische Aspergeriana nicht nur das Fühlen, sondern auch das Denken. Denn auch Erkenntnisprozesse werden Stück für Stück der Offenheit ihrer Welterfassung beraubt und in den gelenkten, nutzungsorientierten Chatraum vereinseitigter Muster überführt, die am Ende den Menschen womöglich vergessen lassen, was er ist: das Wesen mit der Fähigkeit zum Ganzen.
Das Menschsein steht auf dem Spiel
Das aber – so scheint es – ist einer an Nutzungszusammenhängen und am Profit orientierten Welt zutiefst suspekt. Denn ein Mensch, der seinen Blick auf das Reale heften kann, ohne dabei den Blick für das, was über dem vor Augen Liegenden ist, zu verlieren, entzieht sich der Lenkbarkeit moderner Sklaverei. Er ist nicht nur eine Bremse innerhalb der Maschinerie wirtschaftlicher Vollzüge, sondern auch untauglich, um der Entmenschlichung entgegenzumarschieren, die man unter dem Tarnbegriff „Autonomie“ – auch in den Kirchen – verordnet hat.
Während ich diese Zeilen nun beschließe, rüsten sich Mutige in Berlin und Köln zum „Marsch für das Leben“, um davon zu künden, dass das Menschsein gegenwärtig auf dem Spiel steht – nicht nur vor der Geburt. Sie bezeugen dies nicht nur „vor aller Welt“, sondern auch in steigendem Maße vor einer aggressiven Meute, zu der sich diejenigen zusammengerottet haben, die den Blick auf das Ganze vollständig verloren zu haben scheinen.
Und es zeigt sich, dass die Betrachtung der Aspergeriana, mit der unsere Gesellschaft infiziert ist, am 20. September 2025 zum richtigen Zeitpunkt geschrieben wurde. Am Tag der diesjährigen Eröffnung des nostalgisch geduldeten Oktoberfestes und des aggressiv bekämpften Marschs für das Leben in Berlin und Köln. Warum? Weil sich an diesem Tag auf unterschiedliche Weise zeigt, wohin es führt, wenn der Mensch sich um sich selbst dreht und dies für ein Leben hält.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?


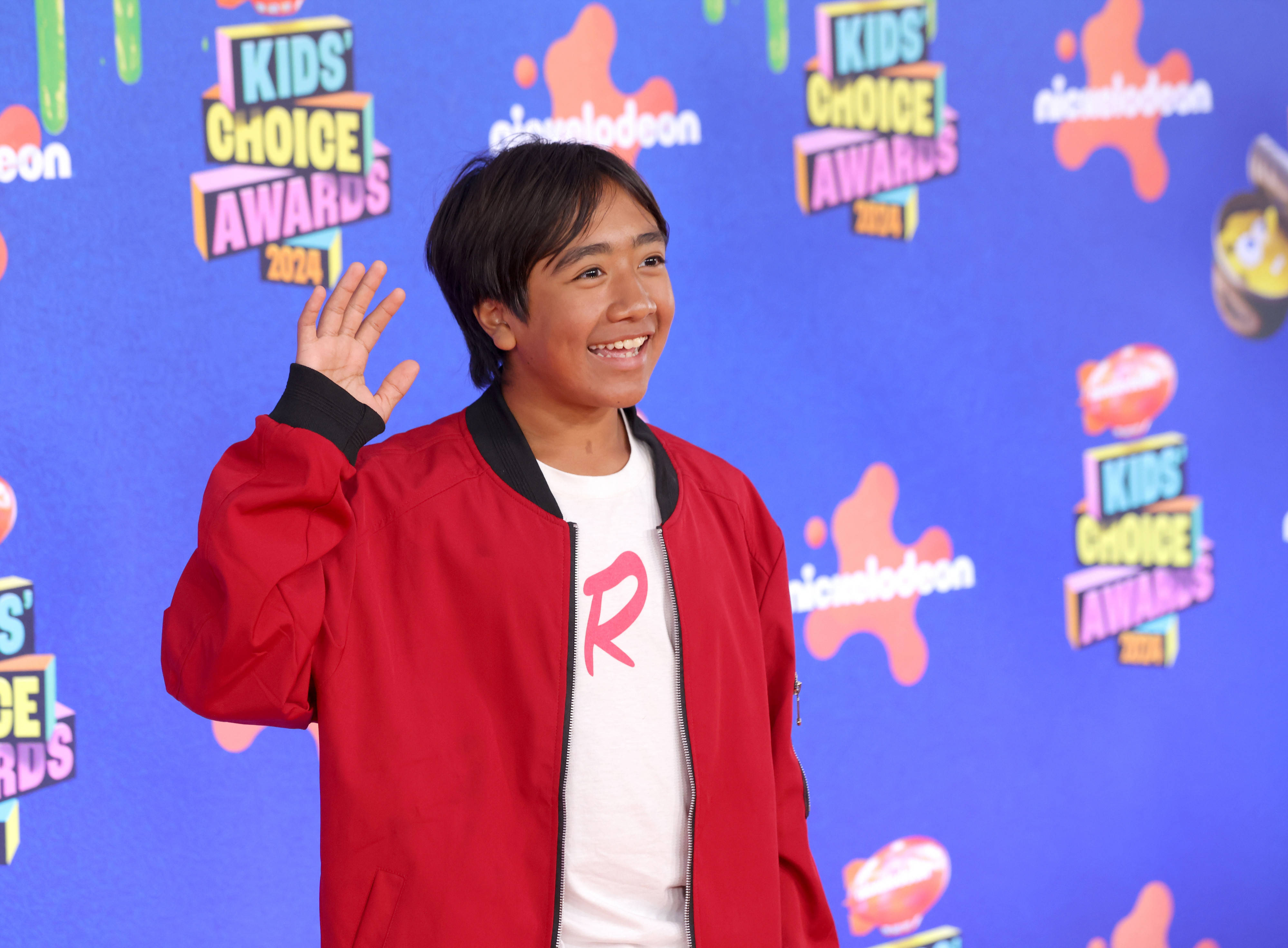


Kommentare
Kein bayerischer König, keine wirklichen Trachten im Alltag, keine hart arbeitenden Menschen, ...
Den König vermisse ich auch. Es gibt aber noch genügend hart arbeitende Menschen.
Aber eines hat es nie wirklich gegeben: die wirklichen Trachten. Kronprinz Ludwig hat sie selbst schon zu seiner Hochzeit eklektizistisch zusammenstellen lassen.
Man sollte keine 'Vergangenheiten' beschwören, die es nie gegeben hat, und die man vielleicht gar nicht wiederhaben will, wenn man sich anschaut, was so alles geschehen ist und was die Jugend früherer Zeiten an Monströsitäten so verbrochen hat.
Letztlich träumt der Autor nur von seiner eigenen Jugend, die für die damaligen Alten genauso unverständlich war wie für die heutigen Alten die GenZ.
@Braunmüller Die Frage ist, ob es zwischen den Generationen eine Konstante gibt, tradierte Werte, die von Dauer sind.
Das änderte sich aufgrund der technologischen Entwicklung, aber nicht nur deshalb. Insofern sehe ich schon einen weit größeren Bruch zwischen den heutigen Alten und der GenZ als zwischen den damaligen Alten und den heutigen Alten.
Während ich diese Zeilen schreibe, wird in der Hauskapelle von Missio-Österreich in Wien gerade die tägliche "Mittagsmesse" gelesen ... und online in alle Welt übertragen: https://m.youtube.com/channel/UClSP2rQSIxrWY3b44Jms-sA. Auch ein Kind der Corona-Zeit!
Wenn nun der sonntägliche Kirchgang genauso wie der Tante-Emma-Laden ausstirbt, so liegt das nicht an diesem dankenswerten Online-Angebot von Pater Karl Wallner, sondern gelegentlich am schlechten Angebot vor Ort. Wenn dort die Heilige Messe bis hin zum Hochgebet mehr "verstümmelt" wird als im Online-Angebot mit seiner naturgemäß nur geistlichen Kommunion, wird letzteres zum (auch theologisch) sicheren Rückzugsort - für ältere mobilitätseingeschränkte Menschen ohnehin. Und das soll definitiv kein Aufruf zum virtuellen Rückzug sein!
Ich war kürzlich bei der Verabschiedung eines äußerst liebenswerten und sehr engagierten Pfarrvikars. Als ein Mitglied des Kirchenrats bei den Dankesworten bemerkte, dem Pfarrvikar würde man die Freude an seinem Dienst anmerken, brandete langanhaltender Beifall auf - weil es (leider zum Teil) so etwas Besonderes ist!
Der H.Pfr. hat recht die Jugend ist heute anders ich lebe seit einigem Monaten in einem Wohnprojekt dass für schwerbehinderte es ist bewußt Generations übergreifen der älteste 62 der jüngste 17 es wird abends ein Abendessen angeboten ,(es ist kein Heim sondern jeder hat seine eigene Wohnung) das istum spätestens 19 uhr obwohl am Wochenende Personal vorhanden ist damit man eben feiern gehn könnte ist praktisch täglich nach dem >Essen um 8 Uhr Ruhe jeder ist in seiner Wohnung manche haben über Nacht die Freundin oder den Freund zu Besuchaber das ist auch schon alles es hat sich das Bedürfnis der heutigen Jugend völlig verändert
@Thomas Kovacs Ja, und letztlich ist daran nix auszusetzen. Ich habe auch mit 20 schon nicht verstanden, was am zwanghaften Ausgehen von Donnerstag bis Sonntag (heute sagt man ja "feiern") so reizvoll gewesen sein soll.
"Man wird den Eindruck nicht los, dass zugleich mit der Inszenierung von Greta Thunberg als der Jeanne d‘Arc im Kampf gegen den Klimawandel ihre neuropsychiatrische Entwicklungsstörung des Asperger-Syndroms zu so etwas wie einer Volkskrankheit avanciert ist."
Volltreffer. 😉
Von mir auch noch zu dem Absatz: dass das, was das Fest ursprünglich ausgemacht hat, gar nicht mehr wirklich da ist. Kein bayerischer König, keine wirklichen Trachten im Alltag, keine hart arbeitenden Menschen, die den Rest ihres Lebens wie im 19. Jahrhundert ohne Fernsehen und Freizeitangebote leben müssen und für die die Wiesn das einzige Highlight im Jahr ist.
Na so ganz, denke ich, stimmt das nicht.
Den bayrischen König: das Oktoberfest, zum Verständnis für Landshuter könnte man es "Münchener Hochzeit" nennen, feiert ja eigentlich die Hochzeit des späteren Ludwig I. mit Therese von Sachsen-Hildburghausen - gibt es zwar nicht mehr, aber die Ehe besteht insofern fort, als sie (Wikipedia zufolge) mittelbar 44 heute lebende Nachfahren hervorgebracht hat. Übrigens wird dem Oberhaupt des Hauses (von allen Seiten - es gibt die schöne Wendung "königlich bayrischer Sozialdemokrat") von seiten der Gesellschaft und auch der Staatsorgane so ungefähr jede Ehre erwiesen, die man ihm erweisen kann, ohne ihn König zu nennen, was in einem Gliedstaat einer Bundesrepublik halt nicht geht. (Und bisweilen ist auch die Rede davon, daß der Titel, den er jetzt führt, "Herzog von Bayern", eigentlich eh der edlere, weil althergebracht tradierte und nicht napoleonisch neukreierte, ist.)
Trachten im Alltag: Die ganz ursprüngliche Tradition wäre ja eigentlich, auf das Oktoberfest in Festbekleidung, also Anzug und quasi Abendkleid, zu gehen; gut, das macht keiner ... Aber die bayrische Tracht ist durchaus eine mögliche Festbekleidung, die halt gut aussieht, deswegen zieht man sie an. Auch wenn durchaus sehr betont gehört, daß man da durchaus in der Jeans hingehen darf ... - Bei den Leuten, die wohl nach wie vor den größeren Teil der Oktoberfestbesucher ausmachen, als Leute von direkt aus München, sind Trachten aus dem Oberland meines Wissens ohnehin nie im Alltag getragen worden, auch zu König Ludwigs Zeiten nicht.
Hart arbeiten: ist eine Definitionsfrage. Belassen wir’s dabei, daß die Leute schon noch arbeiten und jede Arbeit auch Unannehmlichkeiten an sich hat. Rankings von wegen "wie hart genau" sind naturgemäß schwieriger, aber genaugenommen doch auch nicht ganz so wichtig.
ohne Fernsehen und Freizeitangebote: Fernsehen gab’s damals natürlich noch nicht, aus technischen Gründen. Sehr wohl aber gab es, speziell in der Stadt, Freizeitangebote, z. B. Wirtshäuser - und Livemusik, aus ähnlichen technischen Gründen, vielleicht sogar mehr.
So ganz untraditionell ist die Wiesn also nicht.