Das Recht ist auf unserer Seite

Die Moral ist ein mächtiges Mittel im Meinungskampf. Wer öffentlichkeitswirksam unter dem Banner des Guten aufzutreten vermag, hat gegenüber seinem Gegner einen kaum aufzuwiegenden Vorteil. Denn wer möchte schon nicht zu den Guten gehören? Die Moral aber reklamieren in den letzten Jahren in erster Linie die Linken für sich. Zu beobachten ist das vor allem auch in der Migrationsdebatte: Als moralisch gilt, wer von Anfang an „Refugees welcome“ unterstützte, als besonders moralisch, wer es heute noch tut. Als unmoralisch, weil herzlos und egoistisch, erscheinen im Kontrast dazu all jene, die sich in irgendeiner Weise kritisch zur Massenmigration seit 2015 äußern.
Konservative und Rechte reagieren auf diesen scheinbaren Moralvorteil der Linken oft damit, dass sie den moralischen Diskurs als solchen zu einem falschen Spiel erklären: Moral, so heißt es nicht selten, habe in der Politik oder im Bereich der persönlichen Lebensführung nichts verloren. Die philosophisch Halbgebildeten berufen sich dabei gerne auf Friedrich Nietzsche und den Begriff der „Sklavenmoral“, den die „Schwachen“ erfunden hätten, um die „Starken“ zu unterdrücken. Meist wird damit der Gedanke eines Guten an sich, einer objektiven und für alle gültigen Moral, gänzlich preisgegeben.
Moral und das Glück des Menschen zusammendenken
Es gibt gleich zwei schwerwiegende Probleme mit einer solchen Einstellung. Erstens existiert eine objektive Moral, auf die sich auch ihre vermeintlichen Gegner unter der Hand berufen, selbst wenn sie es nicht merken: Wer einen anderen einer „Sklavenmoral“ oder des „Moralismus“ bezichtigt, tut doch schließlich nichts anderes, als ihm einen normativen, ja letztlich moralischen Vorwurf zu machen: Was der andere da veranstaltet, gilt ihm als unlauter, ungerecht, hintertrieben, eben falsch – er soll es nicht tun.
Das zweite Problem besteht darin, dass, wer eine objektive Moral leugnet, sich nicht nur gegen die Wirklichkeit stellt, sondern zugleich auch unnötigerweise den diskursiven Trumpf aus der Hand gibt, den die Moral bietet. Denn wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass die Moral von Linken zwar gerne für sich behauptet wird, sie faktisch aber nur selten auf ihrer Seite ist. Im Fall der Migrationsproblematik ist dies besonders auffällig. Denkt man die Dinge gründlich zu Ende, zeigt sich, dass es gute, und zwar moralische Gründe gibt, sich gegen die unkontrollierte Massenmigration zu stellen, wie sie sich in Deutschland und Europa seit 2015 vollzieht.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Allerdings bedarf es dazu der richtigen Auffassung von Moral, das heißt der richtigen ethischen Theorie. Während sich die moderne Moralphilosophie vor allem auf moralische Pflichten und Gebote fokussiert und das Glück des Menschen ausblendet, vermag die antike und mittelalterliche Ethik, Moral und das Glück des Menschen (das Gelingen des menschlichen Lebens) zusammenzudenken. In der Traditionslinie von Aristoteles und Thomas von Aquin geht es darum, die Moral als etwas zu begreifen, was den Menschen hilft, das seiner Lebensform angemessenste, erfüllendste und damit beste Leben zu führen.
Was meint das „Naturrecht“ in der Ethik?
Zwei Aspekte müssen hier in ihrem Zusammenhang bedacht werden: Tugend und Natur. Der Begriff der Natur des Menschen verweist auf die körperlichen wie seelischen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Eigenheiten des Menschen, die ihn zu dem besonderen leiblich-geistigen Lebewesen machen, das er ist. Der Begriff der Tugend wiederum ist als innerlich-seelische Tauglichkeit zu verstehen: Tugenden sind dauerhafte, durch Gewöhnung entstandene innere Haltungen, die den Menschen dazu befähigen, sein Wesen als „rationales Tier“ (animal rationale) in konkreten Situationen auf bestmögliche – glücksträchtige – Weise zu verwirklichen.
› Lesen Sie auch: Moral statt Moralismus
Wenn der Mensch einen tugendhaften Charakter ausbildet und diesem entsprechend handelt, tut er das seiner Natur Angemessene; er folgt dem, was Thomas von Aquin als das „natürliche Gesetz“ (lex naturalis) bezeichnet hat. Dies ist gemeint, wenn vom „Naturrecht“ in der Ethik die Rede ist. Weder geht es dabei um Anspruchsrechte noch um das „Recht des Stärkeren“, sondern um das Gute, das der Mensch um seiner eigenen Natur willen zu tun hat.
Ethische Aufgabe des Staates ist es, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten
Zur Natur des Menschen gehört nun aber auch die Tatsache, dass er ein soziales Lebewesen ist. Der Mensch entwickelt sich von einem Kind zu einem tugendhaften Individuum nur im Rahmen einer Familie, die wiederum Teil einer größeren Gemeinschaft und letztlich eines politischen Gemeinwesens – modern gesprochen: eines Staates – ist. Zum guten, gelingenden Leben des Menschen gehört die Politik daher ganz wesentlich dazu: Ethik und Politik sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen.
Vor dem Hintergrund der sozialen, politischen Natur des Menschen gilt es nun auch Fragen wie die der Migration zu beurteilen. Auf der individuellen Ebene ist klar: Wer einem Unfallopfer zu Hilfe eilt, darf nicht erst nach seinem Aufenthaltsstatus fragen. Die Tugenden der Hilfsbereitschaft und der Gerechtigkeit fordern, hier und jetzt Hilfe zu leisten, ohne Ansehen der Person.
› Lesen Sie auch: Dürfen Christen eine restriktive Migrationspolitik wollen?
Eine andere Sache aber ist, wie der Staat sich angesichts von Migrationswilligen verhalten sollte. Denn die ethische Aufgabe des Staates und seiner Institutionen besteht vor allem darin, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, ohne die ein gelingendes menschliches Leben nicht möglich ist. Daher ist es die naturrechtliche, sprich: moralische Pflicht des Staates, seine Bürger vor möglichen negativen Konsequenzen der Einwanderung zu schützen.
Nicht die Destabilisierung des eigenen Gemeinwesens riskieren
Drei solcher schädlichen Folgen seien in diesem Zusammenhang exemplarisch genannt:
Erstens ist, wie etwa Rolf Peter Sieferle argumentiert hat, die Aufrechterhaltung des modernen Sozialstaates mit Masseneinwanderung kaum vereinbar. Zweitens belegen die polizeilichen Kriminalitätsstatistiken der letzten Jahre eine Überrepräsentation gewisser Ausländergruppen bei schweren Gewalt- und Sexualdelikten. Drittens zeigen etwa die Forschungen des Soziologen Robert D. Putnam, dass ethnische und kulturelle „Diversität“ in den USA unter anderem mit geringerem Vertrauen in die Mitbürger und verminderter nachbarschaftlicher Kooperation einhergeht.
All diese Punkte müsste man für eine belastbare moralische Argumentation natürlich weiter vertiefen, aber bereits diese kurze Skizze sollte deutlich machen: Eine antimoralische Haltung ist eine Sackgasse. Gerade Konservative müssen sich in Sachen Migrationspolitik nicht vor der Moral fürchten, denn vor allem in der Politik bedeutet die Tugend der Hilfsbereitschaft nicht, die Destabilisierung des eigenen Gemeinwesens zu riskieren und sich selbst aufzugeben.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?




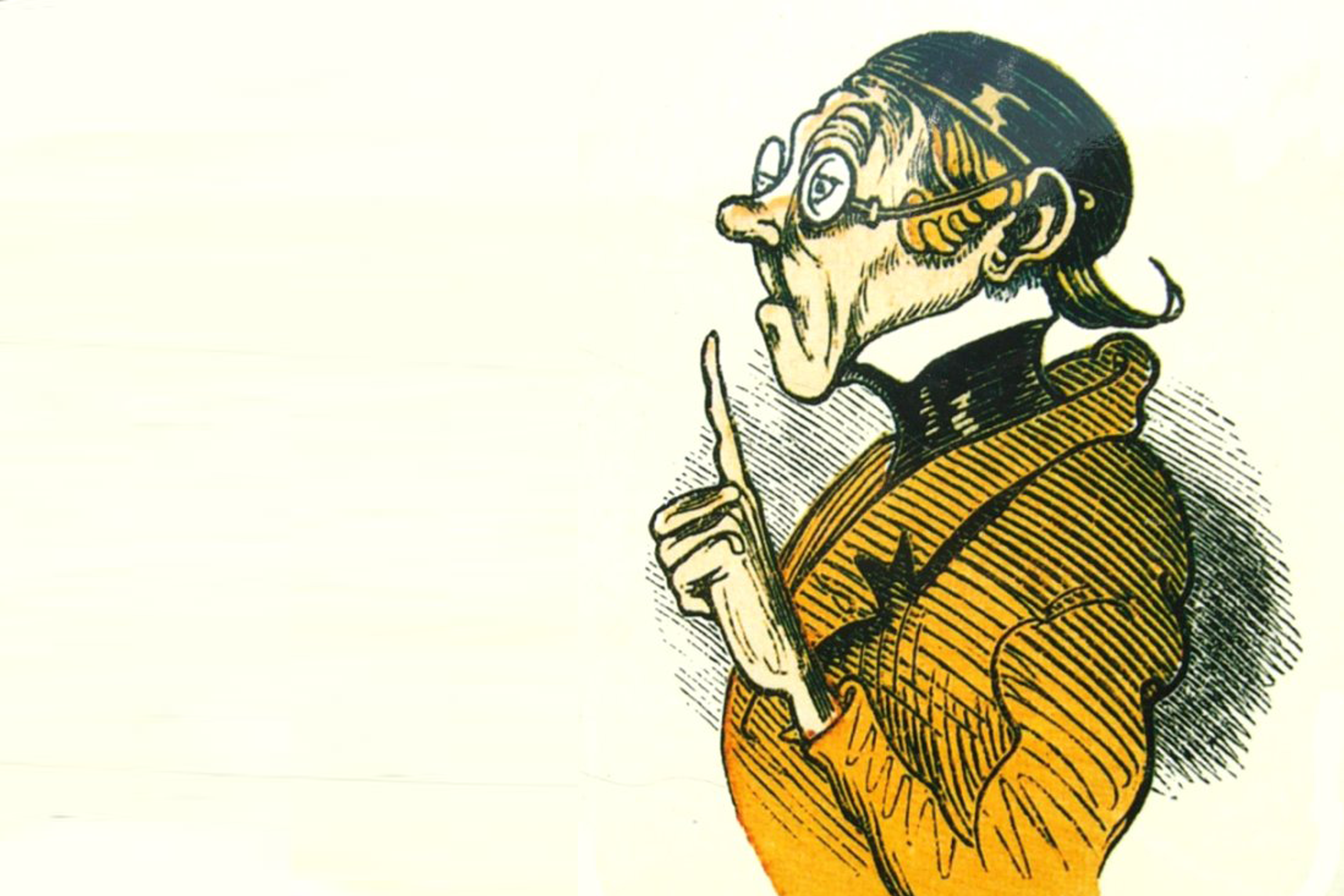
Kommentare
Die Linken haben lange vom Image des "Kümmerers" und "Robin Hood" profitiert. Das war sozusagen ihr moralisches Kapital. Ich möchte gar nicht bestreiten, dass es unter den Linken tatsächlich Menschen gab, die ehrlicherweise mit diesem Anspruch in die Politik gegangen sind. Das verdient auch Anerkennung. Aber die allgemeine Realität war doch immer eine andere. Denn linke Politik bleibt letztlich an ihre marxistischen Grundlagen gebunden. Es wird aber niemand bestreiten können, dass der Marxismus von Anfang an folgende Grundziele vertreten hat: Abschaffung nationaler Ordnung, Abschaffung von Familie, Abschaffung von Religion. Das ist jedoch etwas, das arme und einfache Menschen niemals von sich aus fordern würden. Im Gegenteil: Gerade diese Werte sind es doch, die den Armen in schwierigen Zeiten Trost spenden. Die strohtrockene Ideologie des Marxismus vermag das nicht. In diesem Sinn muss man den Kommunismus als den größten Räuber bezeichnen: Er raubt den Armen, was ihnen am wertvollsten ist. Im Gegenzug liefert er nur Trugbilder. Es ist, wie jemand einmal sagte: Der Kommunismus ist ein Brunnen ohne Wasser.
@EUM
Erstaunlich, wie verblendet man sein kann. Wenn den Armen Trost am wertvollsten ist, warum spenden die Tafeln stattdessen Lebensmittel?