Don Camillos Humor als Waffe gegen den Ungeist

An einem Vorweihnachtsabend des Jahres 1946 erblickt Don Camillo die Welt. Seinem Schöpfer, Giovannino Guareschi, sitzen zwei Jahre Haft in den Lagern der Nazis im Nacken. Er ist geprägt von der Verachtung für den Totalitarismus. Kaum ist er nach der Kriegsgefangenschaft in seine oberitalienische Heimat zurückgekehrt, muss er jedoch feststellen, dass sich mit dem Kommunismus die nächste ideologische Pest über das Land gelegt hat.
Das Italien der Nachkriegszeit zeichnet eine der stärksten kommunistischen Bewegungen Westeuropas, und nicht nur Guareschi, sondern zahlreiche andere konservative Italiener – darunter auch der Papst in Rom – sind zutiefst besorgt darüber, dass die „Roten“ die nächste Wahl gewinnen könnten.
Guareschi ist aber nicht nur Journalist, sondern auch Humorist. Ihm ist klar, dass Propaganda mit dem Vorschlaghammer die Sache des politischen Gegners ist – aber nicht seine. Im Candido, der satirischen Wochenzeitung, deren Chefredakteur er ist – und deren Karikaturen auch weit über die Reichweite von 200.000 Auflagen bekannt sind – erscheinen die Geschichten um den fauststarken Landpfarrer Don Camillo, den kommunistischen Bürgermeister Peppone und den Christus am Kreuz in einer eigenen Rubrik: Mondo Piccolo (Kleine Welt).
Viele Italiener erblicken darin den Spiegel ihrer Zeit – und auch ein Stück weit sich selbst. Die Heiterkeit hilft, die täglichen Attentate und Morde, die Zerstörung, die Not und die Zerrissenheit des vom Krieg gebeutelten Landes zu verarbeiten. Guareschi belehrt nicht; er unterhält, aber mit Hintersinn.
Geburt einer Buch- und Film-Legende
Das geteilte Dorf als Symbol des Kalten Krieges führt dazu, dass die Geschichten, die pünktlich zum Wahlkampf 1948 als Buch erscheinen, nicht nur in der Heimat ein großer Erfolg werden – gerade im geteilten Deutschland finden die Erzählungen fruchtbaren Humus; denn während Guareschi noch glaubte, ein Lokalmärchen zu schreiben, deren Konstanten nur auf die bassa parmense zuträfen, stehen spätestens die 1950er mit den „Don Camillo“-Filmen ganz im Zeichen des Mannes aus der Padana, der mit der antikommunistischen Feder mehr Erfolg als jeder US-Propagandastreifen hat.

Die „Kleine Bibliothek des Abendlandes“, betreut von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz und Gudrun Trausmuth, hat nunmehr einen neuen Sammelband vorgelegt, der einige der bekanntesten Geschichten aus den ersten drei Bänden der Don-Camillo-Bücher zusammengestellt; einzig der Band 4, das posthum erschienene „Don Camillo und Don Chichì“ („Don Camillo und die Rothaarige“), fehlt. Viele davon sind ikonische Erzählungen, die aufgrund der Filme große Bekanntheit erhalten haben.
Dazu zählen Geschichten wie die Beichte, die Taufe, das Fußballspiel, die Prozession oder „Ein trauriger Sonntag“ – letzterer von Regisseur Julien Duvivier nur teilweise in Szene gesetzt, aber für Guareschi selbst eine wichtige Erzählung, weil sie autobiografische Fußspuren enthält.
Lobenswert ist auch, dass die Redaktion viele der eher unbekannteren Geschichten aus „Genosse Don Camillo“ aufgenommen hat, deren Verfilmung auf besondere Ablehnung durch den Autor stieß. Dazu gehört auch die „Gebrauchsanweisung“, ein Vorwort, in dem Guareschi sehr deutlich den materiellen Reichtum Europas ab dem Wirtschaftswunder, aber die gleichzeitige geistige Armut beklagt.
Freilich stellt sich die zwingende Frage sofort: Braucht die Welt noch die Geschichten eines listigen Pfaffen und eines kommunistischen Bürgermeisters aus den 1940ern? Ja, sogar dringender denn je! Das Sowjetimperium mag Vergangenheit sein, aber der totalitäre Ungeist, den Guareschi am eigenen Leib gespürt hat, treibt in anderer Kleidung dasselbe Unwesen.
Der Peppone Guareschis war nie ein holzschnittartiger Kommunist. Er steht zwischen den Fronten: Er muss seiner Verantwortung als politischer Führer, als Familienvater und als Bürgermeister nachkommen. Guareschis Kunstgriff besteht darin, seine Figuren nicht eindimensional aus dem Lehm der Bassa zu formen; deshalb sind seine Geschichten auch keine Propaganda, sondern Kunst.
Geschichten mit Herz und Widerhaken
Don Camillo andererseits ist nicht der vorbildliche Geistliche nach strengem spanischem Vorbild, sondern erinnert vielmehr an die italienischen Volksheiligen – die auch sündigen und irren, bevor sie sich bekehren. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die nie in den Filmen vorkam, aber glücklicherweise Einzug in diese Sammlung gefunden hat.
Es handelt sich um die Geschichte der Madonna brutta, der hässlichen Madonna. Diese Marienfigur in der Kirche ist alt wie abstoßend – und Don Camillo verachtet sie. Er würde viel lieber eine neue Gottesmutter ins Gotteshaus stellen. Guareschi bemüht sich wirklich, die Madonna brutta so abschreckend wie möglich zu beschreiben.
Aber die Kunsthistoriker sagen, es handele sich um eine wichtige Figur aus dem 17. Jahrhundert, und die Bevölkerung hängt an dem Stück. Don Camillo debattiert mit Jesus über die Figur, doch der gibt zu bedenken: es kommt auf die inneren Werte an. So fasst der bauernschlaue Pfarrer einen diabolischen Entschluss.
Bei der Prozession soll die Madonna auf einem Fahrzeug durchs Dorf gefahren werden. Natürlich pumpt der Pfarrer die Reifen extra hart auf, wählt außerdem die holprigste Strecke. Dann geschieht es: Die hässliche Marienfigur zerbröselt noch auf dem Wagen. Unter der „hässlichen“ Madonna kommt aber eine „schöne Madonna“ hervor, eine aus Silber.
Im 17. Jahrhundert musste jemand die schöne Madonna vor dem Krieg und den Plünderungen geschützt haben, indem er sie absichtlich unter dem Gemisch aus Ton und hässlichen Farben versteckte, damit niemand sie stahl. Don Camillo verspricht, sie wieder Stück für Stück zusammenzusetzen – denn er begreift, dass die Madonna einen Auftrag hatte, den er bisher nicht verstehen konnte.
Das Gewissen als Guareschis zeitloses Vermächtnis
Die Rechtfertigung Don Camillo und Peppones besteht nicht aus der richtigen Ideologie; sie besteht aus dem richtigen Gewissen und dem Niederknien vor der Wahrheit. Wenn Guareschi moralisieren wollte – wie es heute leider in fast allen Kulturbereichen geschieht – würde Peppone am Ende gegen die Kommunisten kämpfen. Damit würde ihm aber Unrecht getan.
Viel wichtiger ist, dass Peppone immer wieder sein persönliches Gewissen entdeckt – ähnlich wie Don Camillo. Der eigentliche Feind ist nicht das Individuum, es ist der kommunistische Apparat und die Masse. Denn in der Anonymität der Masse kann der Mensch aufgehen, er kann untertauchen, und er muss sich nicht mehr den unangenehmen Fragen stellen; er marschiert mit. Ein Kommunist, der zu denken beginnt, ist kein Kommunist mehr.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Deswegen geht es auch bei Guareschi nie gegen die Kommunisten, sondern gegen den Kommunismus. Er hasst die Sünde, nicht den Sünder. Häufig ist es der kommunistische Apparat, etwa aus der Stadt, der das Leben im Dorf durcheinanderbringt. Manchmal ist es auch der blinde, aufgewiegelte Mob.
Auffällig ist, dass am Ende der Einzelne entscheidet – ob nun Don Camillo oder Peppone. Der Christus am Kreuz indoktriniert nicht, sondern spricht in die Seele.
Es gilt demnach: man darf nicht mit der Ideologie verhandeln. Mit den Menschen, die ihren gesunden Menschenverstand bewahrt haben – auch, wenn man den manchmal mit ein paar Faustschlägen geraderücken muss – sollte man aber verhandeln, wenn es um das Ganze geht.
Der Mondo Piccolo hat nie die Verhandlung oder gar das Appeasement mit dem Kommunismus gesucht, er war stets erklärter Feind der Gedankenlosigkeit und des aushöhlenden Marxismus.
Aber das Individuum greift Guareschi nie an; es kann sich rechtfertigen, wenn es seinem Gewissen folgt und sich aus der gedankenlosen Masse und Ideologie wie ein Pflasterstein aus der Straße löst. Das ist ein aktueller Gedanke, auch ganz ohne Kommunismus – weil er zutiefst katholisch ist.
Giovannino Guareschi: „Don Camillo und Peppone. Ausgewählte Geschichten“, 10. Band der „Kleinen Bibliothek des Abendlandes“, Be&Be-Verlag, Heiligenkreuz 2025, Hardcover, 304 Seiten, 24,90 Euro.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?
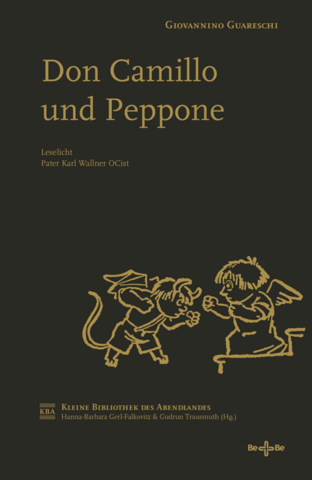





Kommentare
Es ist bedauerlich, dass der letzte Band nicht enthalten ist, denn darin kämpft Don Camillo gegen die Liturgiereform auch sehr humorvoll.
Dass man Ideologie immer nur bei den anderen verortet, ist, denke ich, nicht angemessen. Es geht doch letztlich um die Frage der Wahrheit, wie auch der Text sagt. Dann geht es darum, welche Ideologie, also letztlich Idee, Vorstellung, Überzeugung, wahr ist.
@Theo Es stand hier neulich auch schon was anderes: https://www.corrigenda.online/kultur/moderner-kulturkampf-mehr-ideologi…
Immer spannend, über Guareschi zu lesen. Immer unterhaltsam, von Gallina zu lesen. Eine gute Kombination!