Was heißt philosophieren?
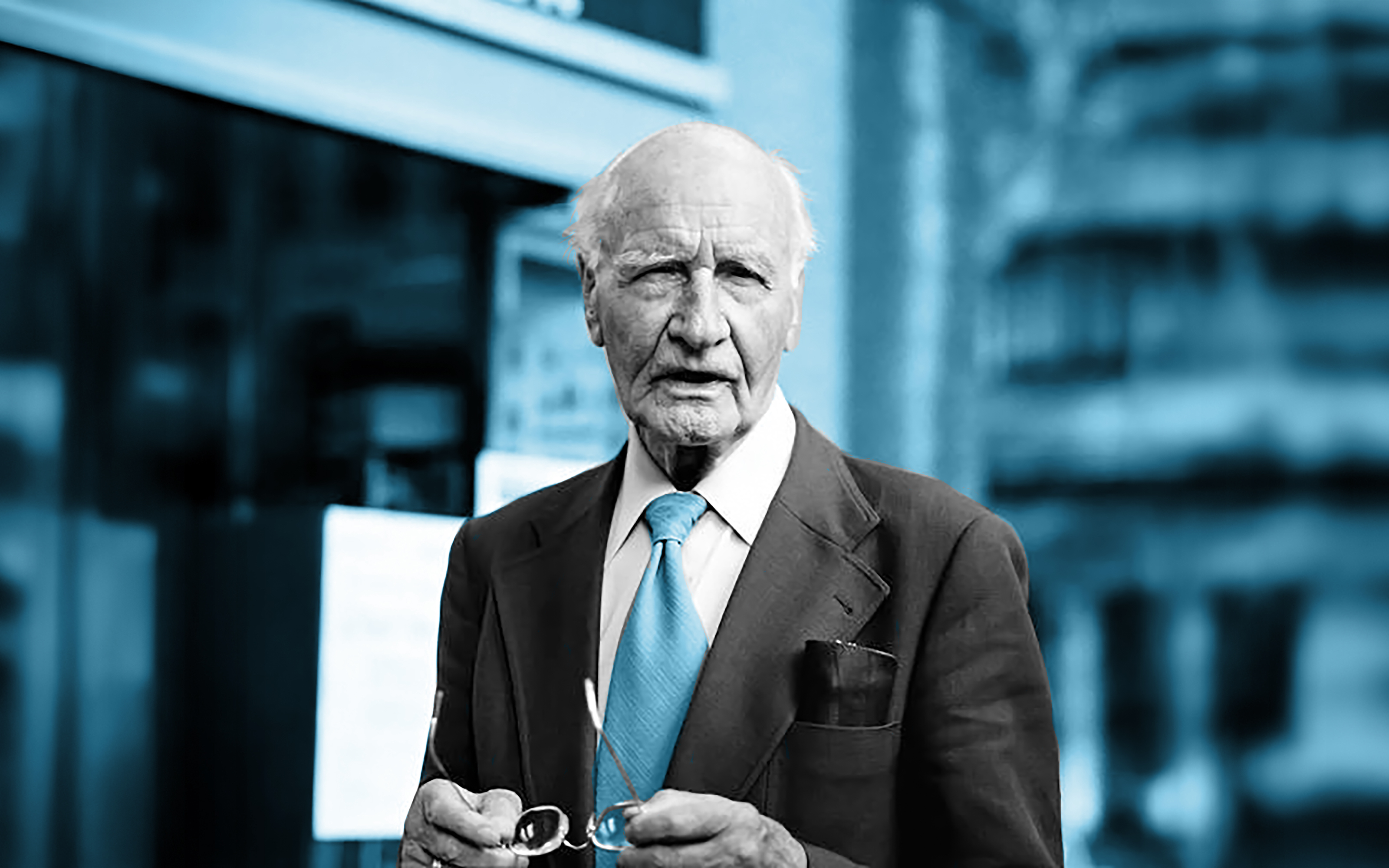
Lange bevor unsere Fernsehmacher Sendereihen über Pleiten, Pech und Pannen anderer Menschen erfanden und in ihnen die Schadenfreude der Zuschauer bedienten, die sich bekanntlich als die schönste Freude hält, wird schon in der Antike das Gelächter über das Missgeschick eines Menschen zum literarischen Dokument der Schadenfreude. Vor zweitausend Jahren wurde bereits berichtet, wie der Philosoph Thales bei seinen intensiven Himmelsbeobachtungen in eine Zisterne fiel und ihn dabei eine Magd aus Thrakien beobachtete und auslachte.
Der Vorfall ging in die Geistesgeschichte ein, denn an ihm offenbart sich das Wesen der Philosophie. Es geht um das Entdecken dessen, was zur Wirklichkeit gehört – und zwar in einer zunächst gänzlich absichtslosen Weise mit Ausnahme der Absicht, dass es um Erkenntnisgewinn geht, das heißt, es geht ohne jeden Hintergedanken nicht um die Verwertbarkeit dessen, was zu erkennen ist, sondern um die Erkenntnis an sich, in der sich die Wirklichkeit abbildet.
Über dieses Nachdenken oder – wie im Fall des Thales – über das Beobachten dessen, was ist, kann man schon einmal über die Fußangeln des Alltäglichen fallen und das sonst so scheinbar Wichtige, aber oft auch Betriebsblinde übersehen, was – so sieht es Josef Pieper – keineswegs dramatisch ist. Denn – so die Grundeinstellung seines Denkens – es geht um das vorbehaltlose Fragen nach dem, was ist, und zwar in seiner Gänze.
Die grundsätzliche „Inkommensurabilität von Philosophie und Arbeitswelt“
Das Gelächter der thrakischen Magd über den bei seinen Himmelsbetrachtungen in die Zisterne gefallenen, scheinbar weltfremden Thales, dessen Erschallen die gesamte Geistesgeschichte durchzieht, ist für Pieper ein Beispiel für die vordergründige Verurteilung des Philosophierens als unpraktisch und untüchtig. Aber der stürzende Astronom ist keineswegs in sich selbst verkapselt und beschäftigt mit seinem Denken, sondern er ist ganz geöffnet für die über ihm sich befindliche Wirklichkeit, die er möglichst unmittelbar in sich aufzunehmen versucht. Dass er dabei das „Naheliegende“ übersieht, ist nicht das Ergebnis seiner Verschlossenheit oder Unfähigkeit für das Praktische, sondern das Ergebnis einer grundsätzlichen „Inkommensurabilität von Philosophie und Arbeitswelt“, wie Pieper es nennt, „einer unaufhebbaren Unstimmigkeit zu aller Tüchtigkeit des praktischen Menschen“.
Diese Unstimmigkeit ist das Anzeichen dafür, dass der philosophische Akt nicht der Arbeitswelt, der Welt des Praktischen, zugeordnet ist, sondern sie übersteigt. Damit unterscheidet Pieper die Philosophie der Antike, in der sich das Denken ganz und gar der Einholung des Wirklichen widmet, vom Denken der Neuzeit, die sie durch das innersubjektive Reflektieren auf sich selbst ablöst.
Im Gegensatz zum weniger versponnenen als vielmehr gänzlich wirklichkeitsoffenen Thales, der weitab jeder Weltfremdheit lediglich im Zuge seiner Beobachtungen des Himmels über das Erdhafte stolpert, ist es die Philosophenzunft der Aufklärung, die in der Versklavung an die um sich selbst kreisende Vernunft blind ist nicht nur für das Naheliegende, sondern auch für die Wahrheit der Dinge insgesamt.
Etablierung des Subjektivismus im Zuge der Aufklärung
Diese Karikatur von Philosophie findet Pieper in „Gullivers Reisen“ von Jonathan Swift beschrieben, der dort genau jene Zunft an Stubengelehrten beschreibt, die seit Etablierung des Subjektivismus im Zuge der Aufklärung die Philosophie zur Fachwissenschaft erhoben und sie damit zugleich in ihrem Wesenskern – in der Offenheit der philosophischen Frage – desavouiert hat. Swift schildert in seinem Roman eine fiktiven Reise in das Land Laputa mit folgenden Beobachtungen bei dortigen Gelehrten:
„Hier und da standen Leute (es waren offenbar Diener) mit einer Art Dreschflegel in der Hand. An diesen Dreschflegeln waren aufgepumpte Blasen befestigt, in denen sich, wie man mir später erzählte, getrocknete Erbsen oder Kiesel befanden. Diese Blasen schlugen sie dann und wann den Nächststehenden auf den Mund oder um die Ohren; eine Sitte, deren Sinn mir im Anfang nicht einleuchten wollte. Später ging mir auf: diese Leute sind dermaßen in philosophische Spekulationen versunken, dass sie weder reden noch zuhören können, ohne dass sie ständig durch solche Schläge an die äußere Welt erinnert werden.“
In seiner literarischen Karikatur schildert Swift hier zutreffend die Verstrickungen der Wissenschaften seiner Zeit und – darüber hinaus – die strukturelle Krise, in die die Philosophie der Neuzeit geraten ist. Pieper hält dem die Suche nach Wirklichkeit entgegen. Es ist der rote Faden seiner Philosophie. Er wird nicht müde, den Verlust des einst für die Philosophie kennzeichnenden Blickes für das Ganze zu benennen.
Piepers Begriff von Philosophie ist ein klares Nein zur System-Theorie
Statt das Ganze zu sehen, kompensiert die neuzeitliche Philosophie diesen Verlust durch das System, in dem es sich ungestört von existenziellen Fragen denken lässt. Hier entsteht durch Systematisierung und Spezialisierung eine Distanz zur Wirklichkeit, in der Pieper eines der Hauptmerkmale der gegenwärtigen Philosophiekrise entdeckt – eine Form der Selbstlähmung, die die Philosophie untauglich macht, das zu leisten, was ihre Aufgabe ist: das Ganze in den Blick zu nehmen und so das Denken vor der Blindheit der Systeme zu bewahren.
Die Frage, was Philosophie und Philosophieren eigentlich sei, steht deswegen noch vor der Beantwortung der Frage „Wozu Philosophie?“, die den Selbstlähmungsprozess der Neuzeit und die vielfältigen Selbstzerstörungserscheinungen der Philosophie in der Moderne ausgelöst hat, in denen ihr der Blick auf das Wesen abhanden gegangen ist.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Die Taubheit und Blindheit eines Denkens, dem offensichtlich jeder Wirklichkeitsbezug fehlt, weil es sich in die Verstrickungen der Subjektivität verloren hat, kann nach Pieper nur aufgebrochen werden durch eine unmittelbare Zuwendung zur Wirklichkeit, und zwar in ihrer Ganzheit. Wenn die Philosophie sich ähnlich ausschnitthaft mit der Wirklichkeit beschäftigt wie es die Einzelwissenschaften tun, gerät das Ganze aus dem Blick – ein Grund für die Isolation der Philosophie in der Gegenwart.
Durch die Verstellung des Blickwinkels des Philosophen und durch die Mittelbarkeit der Frage, wozu Philosophie gut und nützlich sei, die sie unweigerlich in ein Systemdenken führt, wird der unmittelbare Blick auf die Wirklichkeit verhindert und damit der theoretische Charakter der Philosophie zerstört. Josef Piepers Begriff von Philosophie als ein von praktischen Erwägungen freies Bedenken der Wirklichkeit bedeutet damit ein klares Nein zur Vorstellung von einer sich an der herstellenden Praxis ausrichtenden System-Theorie.
Noch bevor die Philosophie praktisch werden kann, muss sie theoretisch sein!
„Theorie“ ist für Pieper hingegen ganz im Wortsinne das schauende Erfassen der Wirklichkeit in ihrer Ganzheit. Darin liegt das Wesen des philosophischen Aktes. Der Blick auf das, was ist – unter jeder denkbaren Hinsicht –, lenkt nicht von der Bewältigung der Alltagsprobleme ab, verschließt sich gerade nicht im Elfenbeinturm des Stubengelehrten, sondern eröffnet durch den Zugang zur Wirklichkeit zuallererst die Möglichkeit eines wirklichkeitsgemäßen, das heißt eines guten Lebens.
Noch bevor die Philosophie praktisch werden kann, muss sie theoretisch sein, das heißt sie muss nach der Wahrheit der Dinge in ihrem Gesamt fragen und darf nicht die Wirklichkeit zum gestaltbaren Material für die Aktivität der Vernunft machen. Durch eine Beschränkung auf das kritisch Nachprüfbare würde sie sich selbst die Möglichkeit nehmen, das Ganze zu bedenken. Die Philosophie gibt sich in ihrem Wesen auf, wenn sie sich als eine akademische Fachdisziplin in den Kanon der Einzelwissenschaften einordnet.
› Josef-Pieper-Reihe I: Gruß aus der Küche: Der Chefkoch und seine Rezepte
In der in jedem Philosophieunterricht beschworenen Definition der Aufklärung als Auszug der Vernunft aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit besteht für Pieper in Wahrheit die Selbstversklavung der Vernunft. In seinem Essay über „Philosophie und Gemeinwohl“ schreibt Pieper sehr pointiert:
„Wenn Philosophieren bedeutet, dass der Mensch die Wurzeln der Dinge, die äußerste Bedeutung des Seins, den eigentlichen Sinn von ‘diesem Ganzen da’ bedenkt, dann muss der Bacon-Descartessche Ansatz, also der Ansatz der neuzeitlichen Philosophie, in der Tat als Selbstzerstörung der Philosophie verstanden werden. Wer die Wirklichkeit vor allem als Rohstoff menschlicher Aktivität betrachtet, der kann die Frage nach den Wurzeln der Dinge, die eigentlich philosophische Frage, gar nicht echt vollziehen – […].“
Denn die Wissenschaft endet an der Grenze des Wissens, während die Philosophie an dieser Grenze beginnt.
Starker Tobak in einer Zeit der Subjektivismus
In diesen Aussagen offenbart sich Josef Piepers Bemühen um das Wachhalten der notwendigen und beunruhigenden Fragen nach der Wirklichkeit und der Wahrheit der Dinge. In seinem Aufsatz „Was heißt akademisch?“ bringt er es auf den Punkt:
„In den alten Bestimmungen des Philosophierens als eines rein theoretischen Verhaltens zur Welt ist also ausdrücklich abgesehen von dem, was den Ansatz gerade der neuzeitlichen Philosophie mit ausmacht. […] Gemeint ist die Richtung auf Praktizierbarkeit, Anwendbarkeit, Verwertbarkeit; gemeint ist die Abzweckung auf eine praktische Philosophie, die uns in den Stand setzen soll, zu maitres et possesseurs de la nature zu werden. Vom alten Begriff von Philosophie aus gesehen, ist der Bacon-Descartessche Ansatz unphilosophisch, weil er die Reinheit der theoria antastet, ja zerstört.“
Starker Tobak in einer Zeit, in der der Subjektivismus in seinen sämtlichen Spielarten das Denken und Handeln fest im Griff hat. Aber das Unzeitgemäße, das dem Pieperschen Philosophiebegriff anzuhaften scheint, ist so etwas wie sein Gütesiegel, insofern darin die zeitlose Gültigkeit der philosophischen Frage zum Ausdruck gebracht ist.
Nicht das sich selbst erfassende Denken, sondern die Wahrheit der Dinge
In seiner berühmten „Verteidigungsrede für die Philosophie“ fasst Pieper dies noch einmal zusammen:
„Philosophieren heißt, die Gesamtheit dessen, was begegnet, auf ihre letztgründige Bedeutung hin bedenken [...].“
Die Frage nach der Philosophie ist also die philosophische Frage schlechthin. Jedoch erhebt sich in dieser Frage nicht das Denken selbst zum Gegenstand, sondern der Bezug zur Wirklichkeit offenbart das Wesen dieses Zugangs als Frage. Nicht das sich selbst erfassende Denken, sondern die Wahrheit der Dinge prägt das Wesen des philosophischen Aktes – dies ist das Zentrum des Denkansatzes Josef Piepers.
Wenn Philosophieren bedeutet, die Wirklichkeit zu erfassen, dann ist es auch die Wirklichkeit, von der es seine wesentliche Prägung erhält. Die Suche nach dem Wesen des philosophischen Fragens kann sich nicht anders vollziehen als im Blick auf seinen Gegenstand, die Wirklichkeit der Dinge. Insofern handelt es sich nach Pieper bei der Frage nach dem Philosophieren um ein Zugehen auf die Dinge, das in seinem Vollzug seinen Fragecharakter offenbart. Die Gesamtheit dessen, was begegnet – hier schließt sich Pieper Thomas von Aquin an –, wird auf seine letztgründige Bedeutung hin befragt. Dieser Dialog mit einer Sache und einer Person bedeutet für Pieper die Anwendung philosophierender Offenheit für die Wirklichkeit.
Und hier wird die Philosophie als Grundlage allen Wirklichkeitszugangs auf ihre Weise – wenn man so will – „nützlich“. Denn gerade die Beschäftigung mit dem Wirklichkeitsganzen durch die Philosophie ermöglicht eine wirklichkeitsgemäße Nützlichkeit der Einzelwissenschaften, die ohne die über allem gegenwärtige philosophische Frage zwar ihre Ergebnisse erreichen würden, diese aber nicht mehr ins Wirklichkeitsganze einordnen könnten, womit sie ihrerseits letztlich nutzlos würden. Die Praxis würde sozusagen blind, würde nicht die Philosophie daneben ständig nach der Bedeutung des Ganzen fragen.
Die Zuwendung zur Gesamtwirklichkeit wachhalten ist der „Nutzen“ der Philosophie
Die Philosophie besitzt also insofern doch einen „Nutzen“, als sie die Zuwendung zur Gesamtwirklichkeit wachhält, ohne die es auch keinen wirklichkeitsgemäßen Nutzen der Einzelwissenschaften geben kann. Dem Charakter des sokratischen „wissenden Nichtwissen“ als Wesensmerkmal des philosophischen Aktes stellt Pieper seine „nützliche Nutzlosigkeit“ analog an die Seite.
Diese Sicht Piepers vom Begriff der philosophischen Frage schließt den Begriff einer diese Frage begründenden, von ihr unabhängigen, objektiven Wirklichkeit ein. Die Ur-Frage „Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr Nichts?“, die Pieper als die eigentlich philosophische Frage gegen die Angriffe der auf sich fixierten Arbeitswelt verteidigt, weist in ihrem Fragen bereits auf eine Wirklichkeit hin, die auf sie maßgebend einwirkt, sonst würde sie ja nicht „nach etwas“ fragen.
› Der Philosoph Josef Pieper: Appetit auf Wahrheit
Es wird also auf erkenntnistheoretischem Wege über die Wirklichkeit ausgesagt, dass sie deswegen wirklich ist, weil sie erkennbar ist. „Wahr“ und „seiend“ sind mithin identisch und begrifflich konvertibel, ein Umstand, der für Piepers Denken enorm folgenreich ist. Identität von Geist und Sein wird nämlich grundsätzlich nur erreicht „in“ der Selbstverwirklichung des Geistes. Die Erkenntnis ist auf die Wirklichkeit hingeordnet und offenbart umgekehrt die Existenz der Wirklichkeit in ihrer Erkennbarkeit.
„Wie verhält es sich mit dem, was ist?“
Hier beschreibt Pieper eine Grundstruktur des Denkens, die sich vom Subjektivismus radikal unterscheidet, ja, die den Subjektivismus in seinem inneren Bauplan als untauglich enttarnt, den Menschen zu sich selbst zu bringen. Denn in der Verfehlung der objektiven Wirklichkeit verfehlt der Mensch auch sich selbst in seinem Wesen, das darin besteht, durch Erkenntnis zu seiner Vollendung zu gelangen. Das Wirkliche ist das Wahrheit Enthaltende, insofern es erkennbar ist, und empfängt nicht, wie im Kantschen Sinne, seine Wahrheit aus der Vernunft, die es gestaltend „bearbeitet“. Indem sich das Wesen der Erkenntnis nur in der Begegnung mit den Dingen offenbart, lässt es einen Blick auf eben diese Dinge zu, auf deren Wesen und auf deren Sein.
Erkennen und objektive Welt sind also einander zugeordnet. In dieser Hinsicht ist der Mensch, lange bevor er ein „Homo faber“ werden kann, zunächst ein Schauender, Hörender und Staunender. Mit anderen Worten: er ist der ganz und gar Aufnehmende – und darin er selbst, was Pieper mit einem Goethe-Zitat unterstreicht:
„Der Mensch kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt.“
Das menschliche Erkennen erfasst immer das objektiv vor ihm Liegende, um es in sich aufzunehmen, zu betrachten oder zur Praxis umzuformen. Daher ist die grundlegende Frage für Pieper, die Frage nach der Wirklichkeit: „Wie verhält es sich mit dem, was ist?“ Darin liegt das Wesen der menschlichen Vernunft, das sich im Akt der Theorie offenbart. Nur im Schauen auf das, was ist, ist die Vernunft ganz sie selbst.
Das, was zu tun ist, muss sich nach dem richten, was ist
Darum ist jedes „Einreden“ oder von Zwecken gelenkte „Fragen“ eine Zerstörung des Vernünftigen und damit letztlich auch eine Zerstörung des Praktischen, soll dieses „wahr“ sein. Hier deutet sich bereits die große Bedeutung des Pieperschen Denkens für die Gegenwart an. Denn das, was zu tun ist, muss sich nach dem richten, was ist und wie das ist, was ist.
Das staunende Vernehmen des Wirklichen ist geradezu das Gegenteil von methodischem Zweifel, wie ihn Descartes zum Ausgangspunkt nimmt. Nicht nur die thrakische Magd in ihrem Gelächter über den Brunnenfall des Thales, sondern auch die empirisch orientierte Philosophie der Neuzeit, die dem Blick auf die Dinge das Experiment der Vernunft vorzieht, haben dem Staunen immer wieder den Vorwurf der Entfernung von der Wirklichkeit gemacht.
› Josef Pieper und die Einheit von Denken und Glauben: Alles Nichts, oder?
Das Gegenteil aber ist der Fall: Staunen bekundet die unmittelbare Verwurzelung in dem, was ist. Es ist keine Entrückung von der Wirklichkeit, sondern ein tieferes Eindringen. Wenn der Staunende im besten Sinne als untüchtig erscheint, dann gerade nicht durch Entfremdung von der Wirklichkeit, sondern dadurch, dass ihn sein Blick auf die Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit über die Lebenszwecke hinaushebt.
„Der Philosoph aber kommt aus dem Staunen nicht heraus“
„Es liegt im Wesen der Einzelwissenschaft, dass sie aus dem Staunen herauskommt, in dem Maße, in dem sie zu ‘Ergebnissen’ gelangt. Der Philosoph aber kommt aus dem Staunen nicht heraus.“
Wirkliches Wissen über das, was ist, kann also niemals der Inhalt der Philosophie sein. Ihr „Ergebnis“ ist die Weisheit, das heißt ein zwar unvollständiges, aber zutreffendes Erfassen des im Philosophieren Erfragten, denn es gehört zur „Natur der Wesensfrage, also der philosophischen Frage […]“, sagt Pieper, „dass sie nicht in dem gleichen Sinn beantwortet werden kann, in dem sie gestellt ist“.
Dennoch hält das Verständnis von Erkenntnis als schweigendes, schauendes Staunen dem Menschen die grundsätzliche Möglichkeit offen, ein die Wirklichkeit in der Weisheit Suchender sein zu können, der am Ende auf das trifft, was er sucht und der sich darin zu Recht „Philosoph“ nennen darf.
Der dritte Teil des Josef-Pieper-Menüs erscheint im August, die nächsten Gänge servieren wir Ihnen weiterhin im Monatsrhythmus.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?
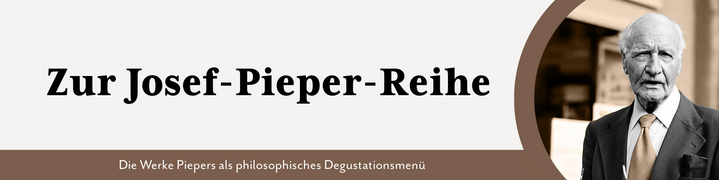

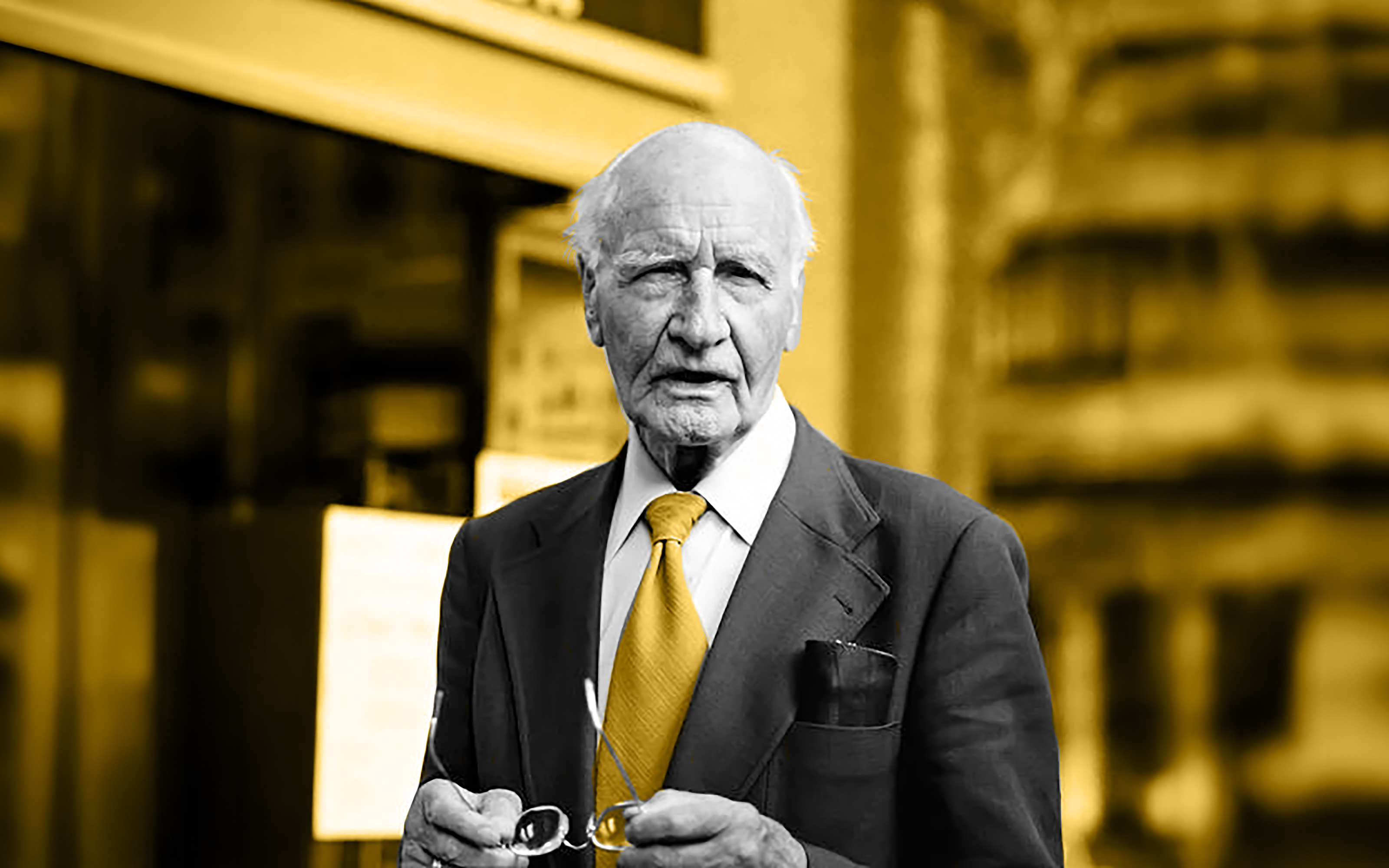
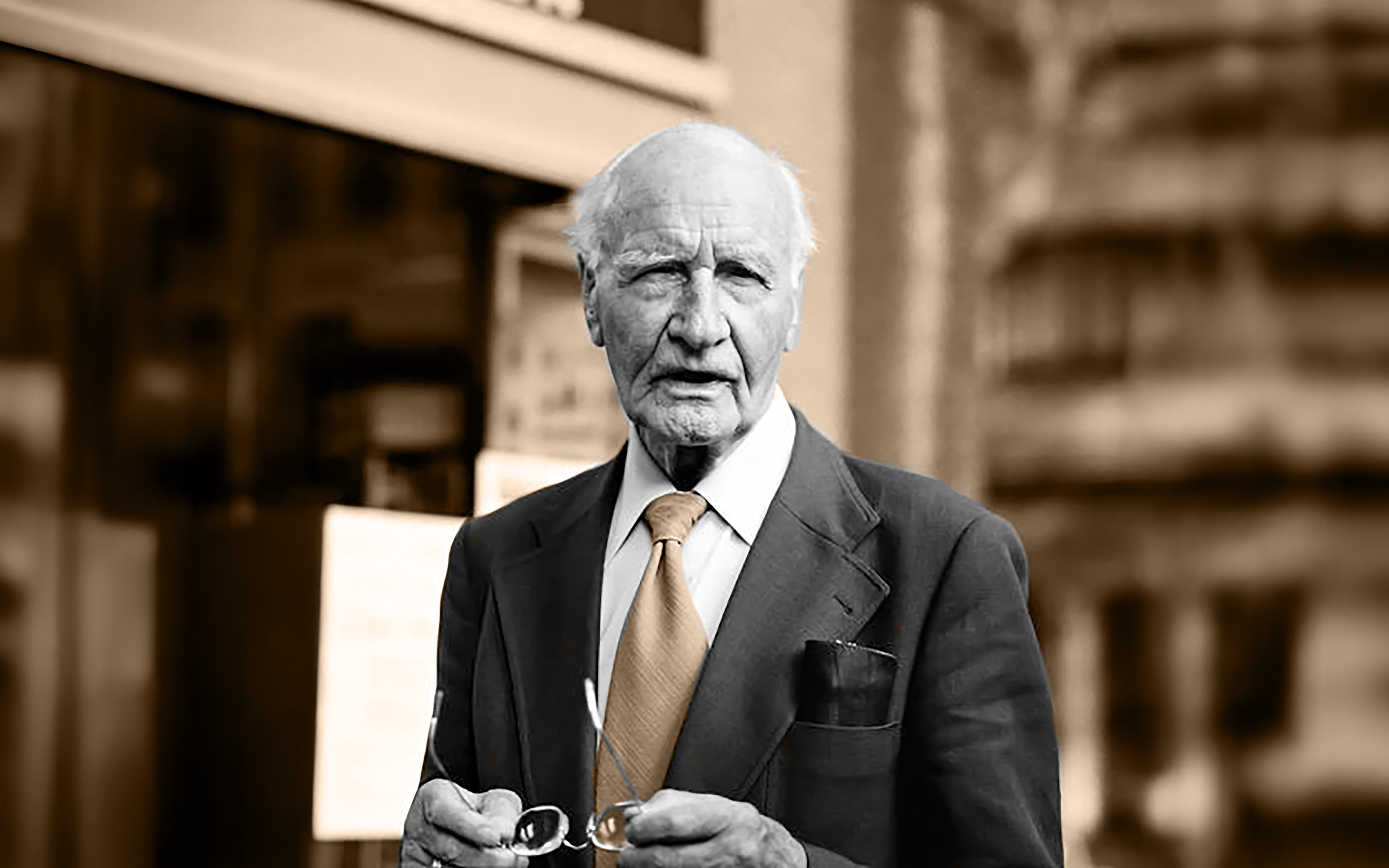


Kommentare
Ei, du liebes bisschen ;-). Die Magd lacht ja, weil der Philosoph in seinem Hochmut sich vermeintlich "Höherem" zuwendet und dabei umso tiefer stürzt. Natürlich lacht sie über den eingebildeten Philosophen, der sich auf verkehrte Weise dem Himmel zuwendet und zur Strafe von unten aus der Zisterne sich nach oben auf die Welt sehnen darf. Hat sie ihm eigentlich aus seiner misslichen Lage herausgeholfen?
Es sollte einen Button „Ich weiß nicht“ geben.
@Agnorisis Eine wahrlich philosophische Antwort. 😁
Ich nenne, ein Erbe meines römisch-katholischen Vaters, die bei Meiner verlegte Gesamtausgabe Piepers mein Eigen. Seine Werke sind mir daher vertraut, und die zitierten Stellen konnte ich nachlesen. Einverstanden bin ich mit den Anmerkungen, die in Erinnerung rufen, dass wirkliches Philosophieren nicht nach Verwertbarkeit strebt, sondern - frei von Zwecken und Zielen - gerade dadurch offen wird für die Wirklichkeit. Hinsichtlich letzterer wäre im Gesamtwerk Piepers besonders auf die Abhandlung über die Wahrheit der Dinge zu verweisen. Nicht einverstanden bin ich mit den bei Rodheudt mitschwingenden Angriffen auf den neuzeitlichen Subjektivismus, rührt dieser doch gerade aus der Erkenntnis her, dass der Begriff der Objektivität seinerseits problematisch ist. Thomas von Aquin, auf den sich Pieper in seiner Abhandlung bezieht, konnte noch eine einzige Wahrheit, und, mehr noch, ein einziges Lehramt voraussetzen. Diese Gewissheit ist unwiderruflich vergangen und wird nicht mehr neu zu begründen sein. Henrich Steffens, Universalgenie der Romantik, Mitbegründer der Mineralogie in Deutschland, Dichter, Philosoph und lutherischer Theologe, berichtet in seinen Erinnerungen "Was ich erlebte" von einer Vorlesung Fichtes in Jena. Fichte habe die Hörer zunächst aufgefordert, die Wand zu denken, die sich hinter ihm, hinter dem Katheder befinde. Danach habe er gefordert, nun den zu denken, der die Wand gedacht habe. Der damit aufgetane Abgrund habe auf die Anwesenden geradezu bestürzend gewirkt. Piepers Rückgriff auf die Scholastik blendet diesen Grund im Bewusstsein aus, obwohl er sämtliche Fragestellungen der Neuzeit durchzieht sowie durch Luthers Ausgang vom Nominalismus und die Erkenntnistheorie des deutschen Idealismus gerade auch für die Geistesgeschichte unserer Nation grundlegend war. Wer Pieper liest, sollte, nicht als Gegengift, sondern zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes, zumindest auch seinen Zeitgenossen Arnold Gehlen lesen!