Wann beginnt menschliches Leben? „Diese Frage spielte in meiner Arbeit nie eine Rolle“

Kein anderer Name fiel in der Debatte um Abtreibungen in den vergangenen Wochen so oft wie der von Joachim Volz. Es gab Kampagnen für ihn in sozialen Medien, zahlreiche Zeitungsartikel, ja sogar eine Solidaritätsdemonstration für den Mediziner.
Anlass war die Fusion des Evangelischen Krankenhauses im westfälischen Lippstadt mit dem katholischen Dreifaltigkeits-Hospital Anfang des Jahres. Bedingung des katholischen Krankenhauses war, dass keine Abtreibungen mehr durchgeführt werden, außer Leib und Leben der Mutter oder des ungeborenen Kindes seien in Gefahr und es gebe keine andere medizinische Lösung. Nach katholischer Lehre ist jedoch jede Abtreibung illegitim, weil das menschliche Leben mit der Vereinigung von Ei- und Samenzelle beginnt und es unbedingt zu schützen ist. Auch der von vielen als progressiv wahrgenommene frühere Papst Franziskus sprach im Zusammenhang mit Abtreibungen immer wieder von Auftragsmord.
Die neue Regelung betraf Chefarzt Volz direkt, weil er seit rund 13 Jahren Abtreibungen nach medizinischer Indikation als Mitarbeiter im Evangelischen Krankenhaus durchführt. In einem Interview bezifferte er ihre Zahl auf 20 bis 25 Fälle pro Jahr. Abtreibungen nach der Beratungsregelung, worunter mit Abstand die meisten der rund 106.000 Fälle pro Jahr kategorisiert werden, waren dem Frauenarzt schon unter evangelischer Leitung untersagt.
Volz klagte gegen die Weisungen seines neuen Arbeitgebers, die ihm auch Abtreibungen nach medizinischer Indikation sowohl in der Klinik als auch in seiner Privatpraxis verboten. Bislang ohne Erfolg. Das Arbeitsgericht Hamm gab der Leitung des fusionierten Klinikums Lippstadt – Christliches Krankenhaus am 8. August Recht und wies die Klage des Mediziners ab. „Der Arbeitgeber sei kraft seines Direktionsrechts zu beiden Maßnahmen berechtigt“, fasste das Fachportal LTO die Urteilsbegründung zusammen.
Sehr zum Ärger der rund 2.000 Demonstranten, die sich im August in Lippstadt versammelt hatten. Unter Anwesenheit von Grünen-Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann und anderen linken Politikern skandierten die Teilnehmer am Morgen des 8. August Parolen wie „Mein Körper ist kein Kirchengut“ oder „Hilfe kann keine Sünde sein“. Ende August ging Joachim Volz dann beim Landesarbeitsgericht Hamm in Berufung. Außerdem hatte er eine Petition gegen die „Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen“ initiiert.
Das CDU-Mitglied bezeichnet sich als lebensbejahender Helfer. Was versteht er unter Hilfe und Lebensschutz? Lässt er sich von radikalen Abtreibungsbefürwortern vereinnahmen? Und warum will er unbedingt in die nächste Instanz gehen? Hier stellt er sich den Fragen von Corrigenda.
Herr Professor Volz, haben Sie sich in den vergangenen Tagen von einer radikalen Abtreibungs-Lobby vereinnahmen lassen?
In den vergangenen Monaten habe ich fast ausschließlich mit Menschen gesprochen, die sich sehr ernsthaft und meist ausgewogen mit dem Thema beschäftigen. Natürlich bringt jeder seine eigene Agenda ein – das ist unvermeidbar. Für mich war es nicht immer einfach, in jedem Gespräch, jedem Interview oder Fernsehbeitrag meine Agenda komplett zu transportieren: nämlich die in meinen Augen unrechtmäßige Dienstanweisung, mir jegliche Form der Schwangerschaftsbeendigung zu verbieten. Aber betrachtet man die große Anzahl der Unterschriften unter meine Petition, so erkennt man, dass dieses Anliegen genau so von den allermeisten Menschen gesehen und geteilt wird.
Solidarität auf der Straße und im Netz erhielten Sie aber nicht etwa von der Jungen Union; es liefen auch nicht CDU-Bundestagsabgeordnete bei der Demonstration vorne mit, sondern solche von SPD, Grünen und Linkspartei, deren Positionen zum Thema Lebensschutz denen der Christdemokraten diametral entgegenstehen.
Mitgelaufen sind vor allem Menschen, die meine Haltung teilen – viele meiner Kolleginnen, Patientinnen und Bürgerinnen und Bürger aus Lippstadt. Richtig ist, dass mich auch Politikerinnen und Politiker von Grünen und SPD unterstützt haben. Alle wussten, dass ich CDU-Mitglied bin. Aber hier ging es nicht um Parteipolitik, sondern um Solidarität in einer zentralen Frage: Ärztinnen und Ärzte sollten ihre Patientinnen in einem freiheitlichen Rechtsstaat allein nach medizinischem Wissen, Diagnose und Empathie behandeln – unabhängig von finanziellen Überlegungen oder moralischen Vorgaben. In dieser Haltung weiß ich auch viele CDU-Abgeordnete an meiner Seite.
„Paragraf 218 schützt das ungeborene Leben nicht“
Vor Gericht ging es um medizinisch induzierte Abtreibungen. In Ihrer Petition ist aber von der Entkriminalisierung aller Schwangerschaftsabbrüche die Rede. Sind Sie für die Änderung von Paragraf 218 StGB? Wenn ja: Sollten Abtreibungen nur bis zu einer bestimmten Frist rechtskonform gestellt werden oder grundsätzlich?
Ich bin überzeugt: Paragraf 218 schützt das ungeborene Leben nicht – er stigmatisiert vielmehr Frauen und Ärztinnen, die verantwortungsvoll handeln. Seit seiner Einführung und trotz aller Reformen hat sich die Zahl der Abbrüche nicht nennenswert verändert. Die Kriminalisierung führt nicht zu einer tieferen ethischen Auseinandersetzung, sondern zu einer Verkürzung der Debatte und zu einer rechtlichen Grauzone, die engagierte Ärztinnen und Ärzte immer weiter unter Druck setzt.
In über 30 Jahren Berufspraxis ist mir nie ernsthaft die Frage begegnet, ob eine gesunde Schwangerschaft jenseits der 14. oder 15. Woche beendet werden sollte. Solche Fälle sind äußerst selten und werden durch das Strafrecht nicht sinnvoll reguliert.
Was meinen Sie genau?
Ich fordere, dass Gesetzgeber und Gesellschaft auf die Verantwortung von Müttern und Ärztinnen vertrauen – dass wir im Zweifel immer auf der Seite des Lebens stehen. Die Regelungen der medizinischen Indikation sollten für die gesamte Dauer einer Schwangerschaft gelten.

Das tut das Gesetz jetzt schon mit Paragraf 218a Abs. 2. Dort heißt es, eine Abtreibung auch über die zwölfte Schwangerschaftswoche hinaus sei nicht rechtswidrig, „wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann“. Der letzte Satz ist relevant, weil sich eine solche Gefahr durch technische Entwicklung oder eben bessere Hilfe künftig womöglich beseitigen lässt.
Schwangerschaftsabbrüche müssen allein zwischen der Frau und dem behandelnden Arzt entschieden werden. Natürlich braucht es Regeln – Bedenkzeiten, Beratungsangebote, eventuell auch die Einbindung einer zweiten ärztlichen Meinung. Aber das Strafrecht ist hier fehl am Platz: Es drängt beide Seiten in eine Beweislast, die einem offenen, ehrlichen Austausch entgegensteht.
Zum zweiten Teil der Frage: Dass technische Entwicklungen irgendwann genetische oder schwerwiegende somatische Störungen verhindern könnten, halte ich für wenig realistisch. Entscheidend ist vielmehr, die Lebensrealität von Schwangeren zu verbessern – hier liegt der Schlüssel, nicht in Paragrafen.
„Nur so kann man die Zahl der Abbrüche tatsächlich reduzieren“
In Deutschland erinnern sich immer noch viele, wenn es um Spätabtreibungen geht, an das „Oldenburger Baby“ namens Tim. Tim überlebte im Jahr 1997 seine eigene Spätabtreibung in der 25. Schwangerschaftswoche, obwohl er erst 9 Stunden nach dem Eingriff medizinisch versorgt wurde. Schließlich wurde er 21 Jahre alt. Ginge es unserem Land schlechter, wenn es keine Spätabtreibungen mehr gäbe? Selbst die Juristin Brosius-Gersdorf sprach sich dafür aus, die Regelungen bei medizinischen Indikationen zu verschärfen.
Bei Spätabbrüchen geht es fast immer um Frauen in höchster Not und Trauer. Sie müssen entscheiden, ob die Schwere der Erkrankung ihres Kindes für sie und das Baby tragbar ist. Hier geht es nicht um „das Land“, sondern um eine konkrete Frau, eine konkrete Familie und eine konkrete Situation. Meist handelt es sich um Kinder, die nicht lebensfähig sind oder nur durch extreme intensivmedizinische Maßnahmen, ohne die Möglichkeit einer menschlichen Interaktion, überleben würden. Das ist eine menschliche Tragödie, die Begleitung und Hilfe erfordert – keine theoretischen Verschärfungen durch Juristen.
Wann beginnt aus Ihrer Sicht menschliches Leben?
Diese Frage spielte in meiner Arbeit nie eine Rolle – obwohl ich als Reproduktionsmediziner wortwörtlich am Beginn des Lebens beteiligt bin. Verschiedene Kulturen und Religionen haben unterschiedliche Definitionen. Für meine Arbeit ist das unerheblich. Meine Ehrfurcht gilt immer dem Paar, das mir sein Vertrauen schenkt, dessen Eizellen und Spermien, dessen Zygoten oder im weiteren Verlauf dessen Fetus. Ob Leben mit der Zeugung beginnt, wie es manche Religionen sagen, oder – wie unser Staat und internationale Konventionen – mit der Geburt: Für mein Handeln zählt, den Menschen in Ehrfurcht und Respekt zu helfen, die mich konkret um Unterstützung für ihren Weg bitten.
Das Bundesverfassungsgericht sieht die Schutzwürdigkeit des Lebens mit der Einnistung gegeben. Sie sagen, Ihr Motiv sei in erster Linie die Hilfe für Schwangere und ihre Familien, Sie möchten Hilfe anbieten und Optionen sowie Konsequenzen aufzeigen. Als Arzt ist es nicht Ihre Pflicht und Aufgabe, Familien im und nach einem Schwangerschaftskonflikt und einer möglichen Geburt eines (behinderten) Kindes finanziell, organisatorisch oder personell zu unterstützen. Würden Sie aber sagen, dass solcherart Hilfe in Deutschland zu kurz kommt?
Wahre Lebenshilfe bedeutet: umfassende soziale Unterstützung – finanziell, organisatorisch und personell. Nur so kann man die Zahl der Abbrüche tatsächlich reduzieren. Ein behindertes Kind kann eine Familie vor unlösbare Probleme stellen, wenn sie nicht verlässlich und nachhaltig von außen unterstützt wird.
Würde es Ihre Sicht der Dinge ändern, wenn es mehr solcher Hilfe gäbe?
Ja, unbedingt. Statt mir in Lippstadt medizinisch indizierte Abbrüche zu verbieten, sollte die Kirche endlich die Kita bauen, die ich dort seit Jahren fordere. In meiner Zeit als Chefarzt in Bielefeld habe ich so etwas selbst initiiert – „Kidstown“ ist bis heute ein Erfolgsmodell. Solche Projekte helfen Familien konkret, statt sie im Konflikt alleinzulassen.
„Ein Wesen ohne Gehirn kann nicht leben“
Stimmt es, dass Sie aus der katholischen Kirche ausgetreten sind? Was waren Ihre Beweggründe?
Ja, ich bin vor rund 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten. Als Frauenarzt, der das Wohl seiner Patientinnen in den Mittelpunkt stellt, konnte ich die kirchlichen Einschränkungen nicht mehr mittragen: Keine Kondome in der AIDS-Pandemie, keine Pille, keine IVF oder ICSI, nur verheiratete Paare behandeln, nicht wieder heiraten dürfen, keine Behandlung lesbischer Paare oder alleinstehender Mütter, keine Sterilisationen – und jetzt als Gipfel das Verbot, Frauen mit Anenzephalus-Feten zu helfen. Diese Liste ließe sich fortsetzen. Sie steht für ein System, das medizinische Fürsorge immer wieder unter moralische Dogmen stellt.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Könnte eine sensible Wortwahl aus Ihrer Sicht dazu beitragen, dass bei der Diskussion um Spätabtreibungen die ethische Dimension ausreichend berücksichtigt wird? Beispielsweise könnte man statt von „Anenzephalus-Feten“ auch von „ungeborenen Kindern, die an Anenzephalie erkrankt sind“, sprechen.
Unsere Wortwahl ist hier korrekt und notwendig. Es gibt keinen Menschen ohne Gehirn, und Anenzephalie ist keine „Erkrankung“, sondern ein letaler Defekt. Ein Wesen ohne Gehirn kann nicht leben. Unser Staat definiert Leben sehr nüchtern: Es beginnt mit der Geburt und es endet mit dem Hirntod. Wo es kein Gehirn gibt, existiert kein Leben. Hirntote dienen uns als Organspender. Das mag hart klingen, ist aber biologische Realität. Wenn mir Menschen tief betroffen schreiben, dass ihnen diese Kinder so leidtun, dann verkehrt das in naiver Weise die Realität.
„Das Christentum hat unbestreitbar wertvolle Grundlagen für unser Zusammenleben geschaffen“
Sie haben die moralischen Standards der katholischen Kirche beklagt. Allerdings sind diese ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Dort, wo vorchristliche Religionen geherrscht haben, gab es Menschenopfer oder wurden Mädchen nach der Geburt getötet, weil sie Mädchen waren. Heute hat man oft den Eindruck, es gehe wieder in Richtung Selektion.
Das Christentum hat unbestreitbar wertvolle Grundlagen für unser Zusammenleben geschaffen: Nächstenliebe, Vergebung, Abkehr von Grausamkeit. Aber ärztliches Handeln im Rahmen einer medizinischen Indikation als „Selektion“ zu diffamieren und Parallelen zur NS-Zeit zu ziehen, ist schlicht unhaltbar.
Seit wann sind Sie Mitglied der CDU?
Ich bin seit mehreren Jahren Mitglied der CDU, war früher lange in der Jungen Union und in der Konrad-Adenauer-Stiftung aktiv.
Fühlen Sie sich dort gut aufgehoben? Im Grundsatzprogramm der Partei heißt es: „Wir sind für Lebensschutz. Der Schutz des Lebens in allen Lebenslagen hat für uns Christdemokraten eine überragende Bedeutung. Das ungeborene Leben bedarf unseres besonderen Schutzes.“
„Lebensschutz“ kann sehr unterschiedlich definiert werden. Für mich bedeutet er nicht die Kriminalisierung von Ärztinnen und Frauen, sondern ein echtes, tätiges Engagement für Mutter und Kind – vor, während und nach der Geburt. Nur so wird Lebensschutz wirklich gelebt.
Würden Sie zustimmen, dass der beste Indikator für effektiven Lebensschutz sinkende Abtreibungszahlen wären?
Das Beispiel Polen zeigt, wie untauglich dieser Indikator ist: Dort sind die offiziellen Zahlen zwar stark gesunken, gleichzeitig entstand ein Abtreibungstourismus nach Deutschland. Entscheidend ist nicht die Statistik, sondern ob Frauen in schwierigen Situationen ausreichend Unterstützung erfahren, damit sie sich für ihre Schwangerschaft entscheiden können.
Gemäß der ELSA-Studie fühlen sich nur drei Prozent der Ärzte wegen der geltenden gesetzlichen Abtreibungsregelung kriminalisiert, so dass sie keine Abtreibungen durchführen. In den vergangenen 16 Jahren wurde laut Bundesregierung lediglich eine einzige Frau wegen Paragraf 218 StGB verurteilt. Man kann angesichts dieser Zahlen doch nicht von einer Kriminalisierung von Ärzten und Frauen sprechen?
Paragraf 218 verurteilt nicht die Frauen, sondern die Ärztinnen und Ärzte. Schwangerschaftsabbruch ist eine Straftat – wer ihn durchführt, riskiert Gefängnis. Immer weniger Kolleginnen bieten Abbrüche an, weil sie den rechtlichen Druck scheuen. So wird eine legale Handlung permanent in einen Graubereich verschoben. Das zeigt sich auch in meinem Fall: Selbst das Arbeitsgericht Hamm erklärte, mein Arbeitgeber könne mir eine „rechtswidrige Tat nach Paragraf 218 Abs 2“ verbieten. Hier kippt etwas. Mit dem „gesellschaftlichen Kompromiss“ des Paragraf 218 konnte ich lange leben – doch nun wird das legale Angebot immer knapper, die Stigmatisierung nimmt zu. Rechte Parteien, die unsere Demokratie unterwandern wollen, setzen immer zuerst bei den Frauenrechten und bei Abtreibungen an. Das führt nicht zu mehr Lebensschutz, sondern untergräbt die Autorität unseres Gemeinwesens.
„Diese Entscheidung muss dann am Ende bei der Mutter liegen“
Sie haben angekündigt, in die nächste Instanz zu gehen. Wenn nötig, dann sogar bis zum Europäischen Gerichtshof. Warum ist Ihnen dieser Kampf so wichtig? Sie könnten die Zeit, Kraft und Finanzmittel auch für die vorhin angesprochene Hilfe aufwenden.
Ich kämpfe hier für ein zentrales Anliegen unseres Grundgesetzes: die Würde meiner Patientinnen. Ihnen die Kompetenz für die eigene Entscheidung abzusprechen, ist ein Angriff auf unsere Grundwerte. Mein Wissen und meine Erfahrung und mein Einsatz dienen dazu, freien Menschen in existenziellen Situationen eine freie Entscheidung zu ermöglichen. Hierfür ist mir keine Zeit, keine Kraft und kein Geld zu viel.
Kommen wir vom Europäischen Gerichtshof am Ende noch einmal zum deutschen Grundgesetz. In Artikel 1 steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Bei einer Spätabtreibung, was bei einer medizinischen Indikation oft der Fall ist, wird ein ungeborenes Kind beispielsweise mittels Kaliumspritze in das Herz getötet und anschließend tot geboren. Wird die Würde dieses Ungeborenen aus Ihrer Sicht nicht angetastet?
Um es klarzustellen: Es gibt keine Spätabbrüche gesunder Kinder nach der 22. Woche. Rund 450 Fälle jährlich, die es in Deutschland gibt, entstehen ausschließlich bei dringender medizinischer Indikation. Polizei und Staatsanwaltschaft sind eingebunden, die Fälle sind für alle Beteiligten hoch belastend. Hier gilt es, zwischen der Würde der Mutter und der des Kindes abzuwägen – eine zutiefst menschliche, existenzielle Entscheidung. Und diese Entscheidung muss dann am Ende bei der Mutter liegen, bei wem sonst?
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?



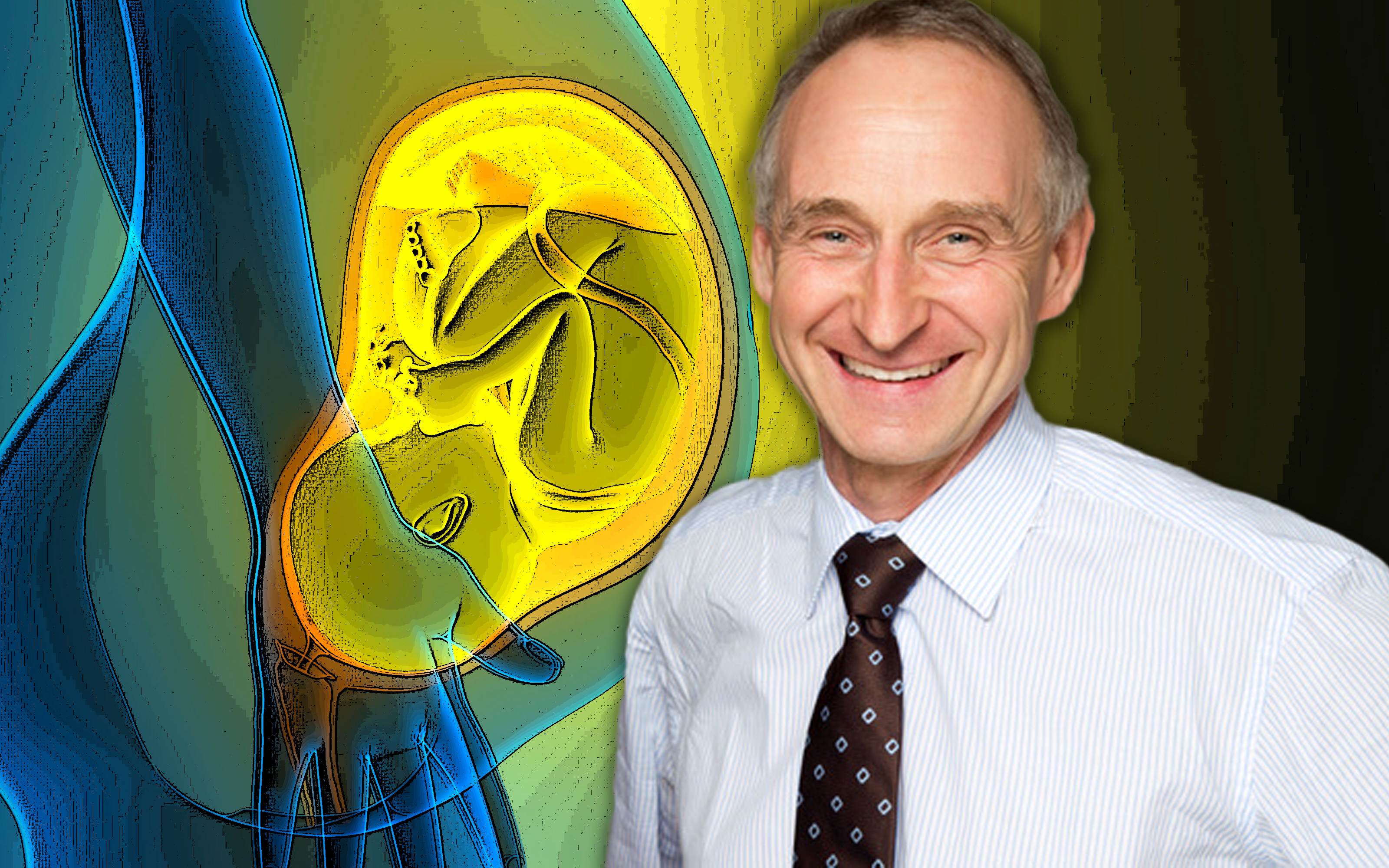

Kommentare
Ein klares Beispiel dafür, wie medizinische Praxis und ethische Grundsätze kollidieren – und wie der Herr Steinwandter mit gezielten Fragen die Widersprüche entblößt. Volz' Klage gegen seinen Arbeitgeber nach der Klinikfusion ist verständlich aus seiner Perspektive, doch die richterliche Bestätigung der Richtlinie im August zeigt: Arbeitgeber dürfen ethische Grenzen setzen und das ist gut so!!!
Seine Petition und die Solidarität von SPD, Grünen und Linken unterstreichen eine politische Allianz.
Besonders alarmierend finde ich seine Aussage: "Paragraph 218 schützt nicht das ungeborene Leben – er stigmatisiert vielmehr Frauen und Ärzte, die verantwortungsvoll handeln."
Diese Relativierung ignoriert den Kern des Gesetzes: den Schutz des Lebens im Mutterleib. Volz reduziert das Ungeborene auf ein entbehrliches Objekt, statt Alternativen wie bessere Familienförderung zu priorisieren, die er selbst als unzureichend kritisiert. Der Tiefpunkt dann bei der Frage "Wann beginnt menschliches Leben?"
Wissenschaftlich beginnt Leben bei der Befruchtung; diese Ignoranz wirkt wie eine bequeme Ausflucht, um das Gewissen zu beruhigen. Bei ihm siegt Pragmatismus vor Würde.
So kann man es auch machen - einfach die Frage, ab wann menschliches Leben entsteht komplett ausblenden. Schon existiert kein Problem mehr.
Faszinierend, schockierend, traurig.
Eins kann der Mann, das muss man ihm lassen: Kommunikation. Danke für das beredte Nachhaken des Fragestellers.