Die Schweizer K-Frage
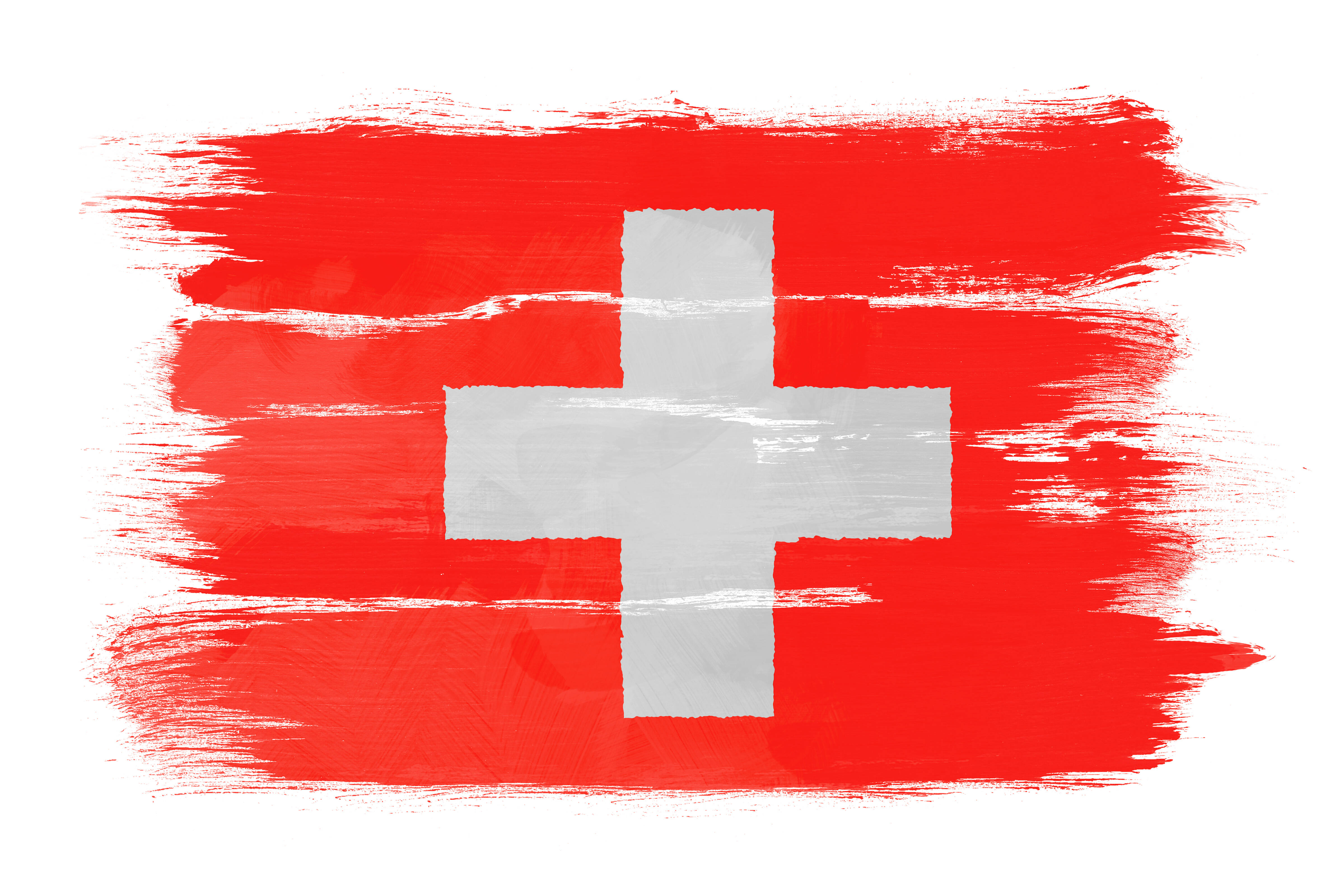
Wer will es werden? Wer wird es? In Wahljahren erhitzt die sogenannte „K-Frage“ ganz Deutschland. Wir Nachbarn schauen dann jeweils neidvoll nach drüben. Da läuft wenigstens etwas. Die Schweiz hat zwar auch eine K-Frage. Sie ist aber nicht besonders elektrisierend. Wir mögen es einfach weniger dramatisch.
Das „K“ bezieht sich auf Konkordanz. So nennen die Schweizer ihr Regierungsmodell, die eidgenössische Variante zum Koalitionssystem. Bei uns raufen sich nach einer Wahl nicht mühsam zwei oder drei Parteien in erbitterten Gesprächen zu einem Kabinett zusammen, das dann mehr oder weniger schlecht funktioniert. Das ist den friedliebenden Schweizern viel zu konfliktbehaftet.
Stattdessen wählt die Bundesversammlung, bestehend aus den beiden Kammern National- und Ständerat, die wackeren sieben Regierungsmitglieder nach einem Verteilschlüssel so gut wie immer aus immer denselben vier Parteien. Das macht nächtelange Koalitionsverhandlungen überflüssig. Dafür gibt es in der Schweiz aber auch keine lustigen Begriffe wie „Jamaika“ oder „Ampel“.
Lächeln, wenn man den Tränen nahe ist
Das Ergebnis darf man sich hinter den Kulissen aber als durchaus erheiternd vorstellen. Dort müssen Leute, die gerne möglichst viele Kernkraftwerke bauen würden, zusammen mit solchen, für die nur Sonne und Wind in Frage kommen, eine gemeinsame Energiepolitik ausdiskutieren. Die Migrationspolitik entsteht aus der Zusammenarbeit von Zuwanderungsbegrenzern einerseits und Freunden der Willkommenskultur und der „Wir schaffen das“-Mentalität andererseits. Es ist ein bisschen wie eine Ehe zwischen Robert Habeck und Alice Weidel.
Ist dann ein Beschluss mal gefasst, tun die Sieben so, als wären sie alle sehr erfreut über den Ausgang, wie auch immer der aussieht. Dahinter steckt ein weiteres „K“: Das Kollegialitätsprinzip, das Regierende zum Lächeln zwingt, während ihnen zum Weinen zumute ist. Ein Beispiel: Der vor Kurzem gewählte Bundesrat Albert Rösti (der Mann heißt wirklich so) war als Parlamentarier der rechtskonservativen SVP noch ein vehementer Gegner des Klimaschutzgesetzes. Dummerweise wurde er kurz vor der Abstimmung darüber in die Regierung gewählt und musste die Vorlage dort dann vehement vertreten. Plötzlich war für ihn alles, was er zuvor abgelehnt hatte, dringend nötig. Das klingt wie der direkte Weg in die Schizophrenie.
Diese an Shakespeare erinnernde Show ist nicht etwa von der Verfassung vorgegeben, sondern eine freiwillige Spielregel. Die lautet: Die vier Parteien, die bei den vorausgegangenen Wahlen die meisten Parlamentssitze ergattert haben, teilen sich danach das Regierungszimmer. Und weil man Sieben schlecht durch Vier teilen kann, bekommt die kleinste Partei eben nur ein Mandat im Bundesrat.
Kreative Auslegung der Arithmetik
Bevor es zu sehr nach dröger Staatskunde mit Schweizer Fokus riecht, sei versichert: Dieses Verteilspiel, das die Schweizer liebevoll „Zauberformel“ nennen, ist durchaus unterhaltsam. Da trifft die Dramatik von William Shakespeare auf die Absurdität von Samuel Beckett. Denn dahinter steckt nur scheinbar reine Arithmetik. Das System wird mit allerlei Vorwänden je nach den eigenen Bedürfnissen zurechtgebogen.
Die Sozialdemokraten (SP) beispielsweise befinden sich seit 2007 im langsamen Sinkflug. Damals entschied sich noch jeder Fünfte für die SP, 2019 waren es nicht mal mehr 17 Prozent. Ihre natürlichen Verbündeten, die Grünen, verdoppelten den Wähleranteil im selben Jahr fast auf über 13 Prozent. Die SP stellt aber zwei Regierungsmitglieder, die Grünen keines. Das würde nach dem oben geschilderten Rechenmodell kein Kind verstehen: Wieso gibt man nicht einfach beiden fast gleich starken Parteien je einen Sitz?
Ganz einfach. Die SP wird den Teufel tun und freiwillig einen Sitz abgeben, die Grünen wiederum haben wenig Lust, ihren ideologischen Partner zu attackieren. Den könnte man ja schließlich wieder mal brauchen. Die bürgerlichen Kräfte wiederum wollen sich da gar nicht erst einmischen. Das etwas verquere Wahlsystem ermöglicht es nämlich, einer allfälligen Unfreundlichkeit der anderen sofort mit einem eigenen Racheakt zu begegnen.
Kinderspiele unter Erwachsenen
Denn die Mitglieder des Bundesrats werden alle vier Jahre in einer Gesamtwahl neu bestimmt. Aber, als weitere Schweizer Besonderheit, nicht auf einen Schlag, sondern einer nach dem andern. Das Parlament hat also, selbst wenn alle bleiben möchten, sieben Möglichkeiten, die personelle Besetzung zu verändern. Am meisten zittern müssen die Regierungsmitglieder, die aufgrund der absolvierten Amtszeit zuletzt bestätigt werden. Sie baden es unter Umständen aus, wenn ihre Partei bei den vorausgegangenen Wahlgängen nicht brav war. Dann wird an ihnen ein Exempel statuiert.
Findet beispielsweise die rechte Seite, sie könnte versuchen, einen missliebigen Linken rauszuwerfen und selbst zuzulegen, droht danach ein Gegenschlag durch Mitte-Links, wenn es um ein bürgerliches Regierungsmitglied geht. Nicht etwa, weil da einer als Amtsinhaber etwas falsch gemacht hat, sondern einfach aus Prinzip. Was nach Kinderspielgruppe klingt, ist die Realität unter den 246 gewählten Volksvertretern.
Beständig, aber nicht besonders hochstehend
Was heißt das nun alles? Bewährt sich die Zauberformel? Was sie mit Sicherheit bringt: Beständigkeit. In der Schweiz kommt es auf der Regierungsbank nicht alle vier Jahre zum großen Wechsel, und es ist ausgeschlossen, dass eine neue Koalition alles auf den Kopf stellt, an dem die Vorgängerregierung gerade gearbeitet hat. Ganz im Gegenteil, gelegentlich hat man den Eindruck, es sei denkbar egal, wer gerade in der Regierung sitzt. Es wird sowieso alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner heruntergedimmt.
Etwas ernüchternder lautet die Antwort auf eine andere „K-Frage“: Die nach der Kompetenz. Diese spielt im beschriebenen Modell kaum eine Rolle. Denn Bundesrat wird in diesem System nur, wer sich die Zuwendung über das eigene politische Lager hinaus sichern kann. Und das sind selten die besten Leute, sondern die stromlinienförmigsten.
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Wer je in die Landesregierung will, darf einfach nicht auffallen. Er sollte keine flammenden Reden im Parlament halten, keine originellen Vorstöße einreichen und beim Gang durchs Bundeshaus alle immer nett grüßen. Wenn ein Linker für Rechte und ein Rechter für Linke wählbar sein muss, dann ist der Ausgang klar: Es kommen in erster Linie Freunde des gepflegten Wischiwaschis zum Zug.
Auf dieser Grundlage schaffen es natürlich selten herausragende Persönlichkeiten in den Bundesrat. Sondern eher der personifizierte Durchschnitt. Aber vielleicht ist Durchschnittlichkeit ja auch die perfekte Repräsentation dieses Volks.

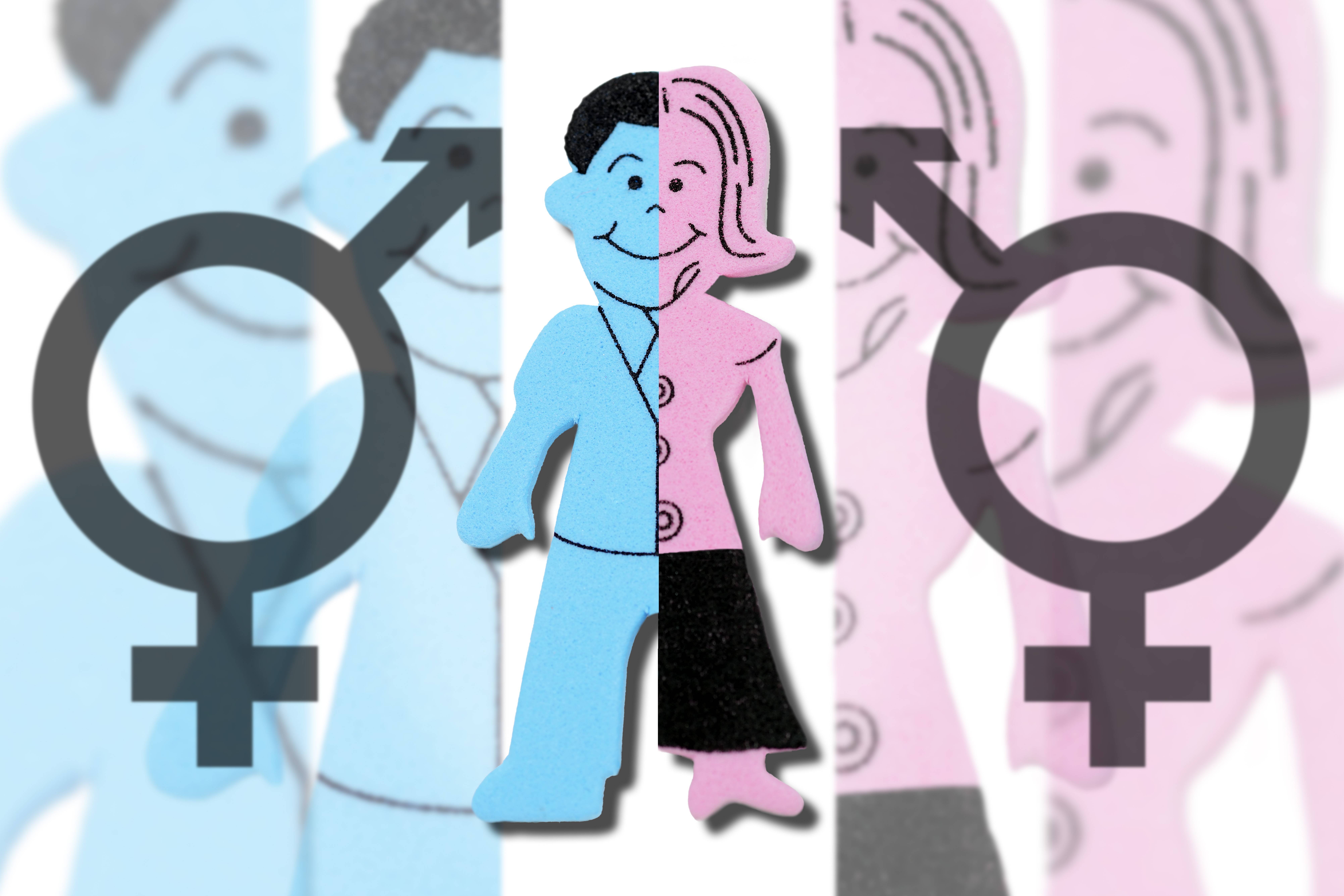



Kommentare
Aber ein Burkaverbot wurde den Schweizern zugestanden, das macht einiges wett. Und den Rest wird der Verfasser in Ordnung bringen, wenn er in die Politik aufbricht. Wir, als bekennende Fangemeinde seiner spit-zen Feder, drücken ihm und seiner aufrechten Bürgerrechtsbewegung alle Daumen!