Das Abendland – nur eine Erfindung?

Die abendländische Zivilisation – ein kollektiver Wahn oder gar eine retrospektive Erfindung böser alter Männer der Kolonialzeit? Darauf läuft sie grob gesagt hinaus, die These, die Josephine Quinn in ihrem viel diskutierten Werk „Der Westen. Eine Erfindung der globalen Welt“ vertritt. Quinn, Lehrstuhlinhaberin für Alte Geschichte an der Universität Cambridge, versucht in ihrem Buch nicht nur die Geschichte Europas in ein globales Geflecht kultureller Austauschprozesse einzubetten, sondern behauptet auch, der „Westen“ sei weniger ein eigenständiges Zivilisationsprojekt als vielmehr das Ergebnis zahlloser kultureller Hybridisierungen, und das Denken in „Kulturen“ laufe unmittelbar auf Rassismus und Exklusion zu:
„Dem Denken in Kulturen wohnt die Annahme eines dauerhaften und bedeutsamen Unterschieds zwischen menschlichen Gesellschaften inne, die echten Schaden anrichtet. Menschen sterben durch die Hand fanatischer Streiter für einen weißen Westen, während die verschiedenen Haltungen, die in manchen europäischen Ländern gegenüber den Flüchtlingen vor den Kriegen in Syrien und der Ukraine geäußert werden, vor Augen führen, wie stark die Überzeugung von einem kulturellen Exzeptionalismus menschliches Leid auszublenden vermag.“
Dass die Unterscheidung verschiedener Kulturen aber ganz im Gegenteil vielmehr deren jeweils einzigartigen und gleichberechtigten Zugang zu den höchsten Idealen wertschätzen könnte, Kulturalismus also alles andere als Rassismus sein kann, das scheint der Autorin, die hier natürlich nur pars pro toto für eine ganze Klasse an Denkern steht, undenkbar.
Ebenso wenig denkbar ist für sie die Tatsache, dass die Aberkennung geistiger Eigengesetzlichkeit das Werk unzähliger, sich sehr wohl in wechselseitige Kontinuität stellender Generationen von Menschen zugunsten eines materialistischen Mechanismus negiert. Im Folgenden wollen wir diese Thesen zum Ausgangspunkt einer allgemeinen Reflexion über Konstruktion und Dekonstruktion von Identitäten nehmen.
Dekonstruktion statt kulturelle Eigenständigkeit
Die Attraktivität ihrer Darstellung liegt zweifellos in ihrer erzählerischen Brillanz und materialreichen Gelehrsamkeit. Ihre Schwäche aber in eben jener ideologischen Grundausrichtung, die in der heutigen akademischen Welt fast reflexartig jeden Anspruch auf kulturelle Eigenständigkeit als Erfindung, jede historische Kontinuität als Mythos und jede Tradition als Exklusion abtut und an die Stelle einer konstruktiven Reflexion über Geschichte lieber die Allzweckwaffe der Dekonstruktion setzt. Dies ist praktischer, da sie in Anbetracht der Quellen nie wirklich widerlegbar ist.
Denn auch wenn Quinn vorgibt, lediglich die historischen Fakten sprechen zu lassen, ist ihr Werk doch deutlich von der Agenda geprägt, die kulturelle Besonderheit des Abendlands zugunsten eines ebenso inklusiven wie globalistischen Geschichtsbildes aufzulösen.
› Lesen Sie auch: Erwirb es, um es zu besitzen
Besonders deutlich wird dies dort, wo sie die Idee des Westens als zivilisatorische Kontinuität ausdrücklich bestreitet und stattdessen einen „Westen ohne Westen“ propagiert – einen Westen, der sich letztlich als Erfindung von Machteliten erweist, die bloß ihre hegemonialen Interessen durchsetzen wollten. Die implizite Botschaft lautet: Keine Kultur hat Legitimität, weil keine Kultur eine eigene Identität besitzt. Es gibt nur Menschen oder bestenfalls lokale, kontingente Kleingesellschaften, aber keine übergeordneten Entitäten:
„Das kulturalistische Denken stellt unsere Geschichte von Grund auf falsch dar. Nicht Völker machen Geschichte, sondern Menschen und die Kontakte, die sie untereinander herstellen. Die menschliche Gesellschaft ist nicht ein Wald voller Bäume, mit Subkulturen, die sich aus einzelnen Stämmen verzweigen. Sie gleicht eher einem Blumenbeet, das regelmäßig befruchtet werden muss, um sich neu auszusäen und von Neuem zu wachsen. Eigene lokale Kulturen kommen und gehen, aber sie werden durch Interaktionen geschaffen und erhalten – und sobald der Kontakt hergestellt ist, ist kein Land mehr eine Insel.“
Das entspricht exakt jenem globalistischen Paradigma, das die heutigen Eliten so erfolgreich verinnerlicht haben und das letztlich jede Form von kultureller Selbstbehauptung moralisch diskreditiert. Vor allem wenn es die eigene Zivilisation betrifft, ist man doch mit dem analogen Versuch, die Eigenständigkeit etwa der indischen oder chinesischen Zivilisation zu beweisen, erheblich vorsichtiger.
Der Gedanke des Zivilisationsbruchs ist keineswegs neu
Dabei ist die Grundthese des Buches in vielerlei Hinsicht alter Wein in neuen Schläuchen. Denn dass der Gedanke einer bruchlosen kulturellen Kontinuität zwischen griechisch-römischer Antike und Abendland zugunsten eines echten Zivilisationsbruchs in der Spätantike aufgegeben werden muss, wurde seit Jahrhunderten von vielen Zivilisationshistorikern vertreten: Ebenso wie die assyrisch-babylonische Zivilisation einzelne Formen der sumerisch-akkadischen Zivilisation übernommen, aber mit ganz neuen Inhalten gefüllt hat, ist auch das Verhältnis der europäischen zur griechisch-römischen Zivilisation eher das einer Wahlverwandtschaft als einer bruchlosen Kontinuität.

Dass die griechische und römische Antike selbst in ein enges Beziehungsgeflecht zum alten Orient eingebunden war, ist ebenfalls seit dem 19. Jahrhundert kalter Kaffee. Es ist eine offene Tür, die mit Pathos einzurennen ebenso peinlich wirkt wie die Feststellung, dass auch die christliche Tradition selbst alles andere als bruchlos verlief.
Zwischen der ostmediterranen, griechischsprachig und orthodox geprägten und stark auf den Basileos – den Herrscher – ausgerichteten Kirche und der nordwestlichen, lateinischen, katholischen, streng auf den Papst hin organisierten und oft mit dem Kaiser konkurrierenden Kirche klaffen bedeutsame Abgründe. Diese Abgründe waren auch theologischer Natur. Dies zeigt auch die Türkeireise Papst Leos XIV. Ende November 2025 und die Diskussion um das berühmte karolingische filioque.
Die ideologische Agenda: Kollektive Identitäten aufbrechen
Insoweit bietet Quinn bis ins 8. Jahrhundert in der Sache vor allem Altbekanntes, wenn auch mit einer klaren ideologischen Agenda: kollektive Identitäten aufbrechen oder negieren und vielmehr als Resultat zufälliger Verflechtungen, Migrationen und Appropriationen interpretieren. Das Christentum erscheint ihr weniger eine Offenbarungsreligion zu sein als eine synkretistische Synthese mediterraner Kulte.
Die griechische Philosophie wird nicht als originäres geistiges Aufbrechen in die Welt des Logos verstanden, sondern als eine Art Importprodukt altorientalischer Wissenssysteme. Selbst Rom erscheint bei ihr nicht als Träger eines genuin originären republikanischen Rechts- und Reichsgedankens, sondern als ein Sammelsurium fremder Einflüsse, das sein Wesen in erster Linie dem Austausch fremder Räume zu verdanken habe.
Es ist eine Geschichtsschreibung, die sich also ganz in den Dienst einer gegenwärtigen politischen Agenda stellt: der Auflösung aller festen kulturellen Grenzen zugunsten einer globalistischen Anthropologie, in der Identität nicht mehr als organisch gewachsene, halbwegs kohärente Größe gilt, sondern als funktionaler und ständig neu geknüpfter Knotenpunkt eines weltweiten Netzwerkes.
Die Existenz der abendländischen Zivilisation wird geleugnet
Dies wird dann peinlich, wenn Quinns Buch mehr oder weniger dort abbricht, wo die abendländische Zivilisation nach den Umbruchs- und Transformationsphasen der Spätantike mit ihren eigenen charakteristischen Besonderheiten hervortritt, nämlich in karolingischer und dann ottonischer Zeit. Von circa 500 Seiten sind somit mehr als 400 der Zeit vor dem Mittelalter gewidmet.
Selbst die letzten paar Kapitel behandeln zu einem wesentlichen Teil die islamische Zeit und nicht Europa – und brechen mit der Entdeckung der Neuen Welt völlig ab, so dass man sich die Frage stellen kann, wie allen Ernstes die Existenz einer abendländischen Zivilisation durch eine Darstellung negiert werden kann, die mehr oder weniger mit dem eigentlichen Beginn dieser Zivilisation aufhört.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Die Kernaussage, nämlich dass das Bewusstsein um eine historische und kulturelle Kohäsion und Eigenständigkeit bloß eine „jüngere Erfindung“ sei, wird also im Buch selbst überhaupt nicht abgehandelt oder doch nur auf die antiken Wurzeln dieser Identität bezogen, nicht aber auf die genuin europäischen Aspekte.
Aus zivilisationshistorischer Perspektive ist diese Herangehensweise überaus problematisch. Nicht nur wegen der Aussage von der „Erfindung“ des Westens, sondern auch weil jegliche Existenz historisch klar umreißbarer Einheiten unter einer Flut von Hybridisierungen begraben wird und weil man es in vielerlei Hinsicht „besser wissen“ will als die Beteiligten selbst.
Den Europagedanken gab es bereits in der späten römischen Republik
Denn dass die Griechen durchaus ein stark ausgeprägtes Bewusstsein um ihre Eigenständigkeit hatten und schrittweise von einem rein ethno-kulturellen Verständnis von Identität zu einem zivilisatorischen Verständnis übergingen, dem sich dann auch die Römer und die anderen italischen Völker anschlossen und es dann auf den gesamten hellenisierten und romanisierten Kulturbereich übertrugen, wird teils übergangen. So gab es den Europagedanken der späten Republik im Kampf mit dem orientalischen Hellenismus.
Das zivilisatorische Verständnis wird teils auf eine Art Elitendiskurs reduziert und gegen diverse archäologische Randerscheinungen, kunsthistorische Übergangszonen und Kulturtransfers ausgespielt, um gewissermaßen 2.500 Jahre später behaupten zu können, die Menschen der klassischen Antike hätten sich geirrt, als sie sich als eigenständigen Kulturkreis begriffen. Moderne Wissenschaftler könnten ja „beweisen“, dass ein Teil dieser Zivilisation Elemente umliegender Gesellschaften übernommen hätte.
Dies ist ungefähr ebenso sinnvoll wie der französischen Nation nachweisen zu wollen, ihre nationale Identität, Sprache und Geschichte sei seit Jahrhunderten eine Selbsttäuschung und ihre historischen Äußerungen irrelevant, da sie ja ursprünglich einmal aus keltischen, römischen und germanischen Elementen zusammengesetzt gewesen sei und auch später immer in Kontakt und Austausch mit den Nachbarn gestanden hätte.
Geschichte verstehen – statt sie zu dekonstruieren
Historische Größen bestehen im Guten wie im Schlechten vor allem darin, dass sie sich selbst als solche setzen und verstehen, und nicht darin, dass spätere Lehrstuhlinhaber ihnen auf Grundlage der Erforschung ihrer Genese und Geschichte gewissermaßen posthum das Recht zur Selbstkonstituierung und -äußerung verweigern, denn Identitäten existieren allem voran im Bewusstsein der Menschen und erst sekundär in archäologisch nachweisbaren Evidenzbündeln.
So „konstruiert“ eine historische Entität auch immer sein mag – solange sie sich als wirkmächtig und kohärent versteht und entsprechend agiert, muss man sie als Akteurin ihrer Art betrachten und in ihrer selbstgeschaffenen Originalität ernst nehmen, will man Geschichte wirklich verstehen, anstatt sie zu „dekonstruieren“.
Quinn verwechselt somit das unbestreitbare Faktum des kulturellen Austausches mit der Frage des inneren Selbstverständnisses, die eine Zivilisation ausmacht, egal, ob zurecht oder nicht. Dass griechische Mathematik und Kosmogonie Elemente aus Babylon übernahm, ändert nichts an der einzigartigen geistigen Struktur des griechischen Denkens und vor allem ihres Selbstbilds.
Zivilisationen sind nicht nur Durchlaufstationen globaler Ströme
Dass das Christentum auf das Judentum aufbaute, nimmt ihm weder seine erschütternde Wirkmächtigkeit noch seinen welthistorischen Anspruch. Dass die römische Republik orientalische Gottheiten, griechische Mythen oder hellenistische diplomatische Praktiken integrierte, relativiert nicht seinen ureigenen Begriff von Ordnung, Recht und Bürgertum, und dass die Kaiserzeit sich im Kampf gegen die Perser in die Kontinuität des angeblich uralten Kampfes zwischen Freiheit und Knechtschaft, Ordnung und Chaos, Europa und Asien stellte, wird dadurch nicht weniger wirkmächtig für das Selbstbild wie die Rezeption Roms, dass der ideologische Anspruch dieser Dichotomie in den realen Fakten nur wenig Berechtigung fand.
› Lesen Sie auch: Das Abendland geht unter. So what?
Zivilisationen sind eben nicht bloß Durchlaufstationen globaler Ströme, sondern Gestalten eigenen Ranges, die das Übernommene in eine neue, ihnen gemäße Form verwandeln und konkret aktivieren, egal, auf welcher Grundlage. Quinn aber negiert genau diese schöpferische Kraft der kulturellen Formgebung und bemüht sich erst gar nicht, diese Frage am Kernthema, nämlich der europäischen Geschichte seit dem Mittelalter, nachzuvollziehen.
Ein systematisches Ausblenden zentraler Elemente
Problematisch ist daher auch Quinns Gewichtung der Quellen. Die Autorin greift bevorzugt auf Beispiele zurück, die ihre These bestätigen, etwa die Rolle phönizischer Händler oder die Bedeutung altorientalischer Wissenssysteme.
Doch sie blendet systematisch jene Elemente aus, die für den inneren Eigensinn der antiken oder abendländischen Tradition zentral sind: Die Idee der individuellen Person, der Glaube an eine rational zu fassende transzendente Wahrheit, später die Spannung zwischen Athen, Jerusalem und Rom, schließlich die große mittelalterliche Synthese von christlichem Glauben und scholastischem Verstandesdenken. Und schließlich auch die humanistischen Freiheitskonzeptionen und das daraus entwickelte, in der Sache durchaus problematische Sendungsbewusstsein.

Wo immer ein geistiges Kontinuum oder eine Setzung eigener Identität erkennbar wird, weicht Quinn auf die Erklärung materieller oder wissenschaftlicher Austauschprozesse aus und betreibt damit eine Art methodischen Reduktionismus, der zwar im Einzelfall intellektuell durchaus stimulierend wirken kann, aber letztlich das eigentlich interessante Phänomen verschüttet.
Hinzu kommt ein weiteres Element, das aus zugegebenermaßen konservativer Sicht irritiert: Quinn ignoriert vollständig die Frage des Niedergangs. Ihre Weltgeschichte ist eine Geschichte des ständigen Austauschs, nicht der Verantwortung oder gar der Prozesse zivilisatorischer Ermattung. Zivilisationen, so Quinn, kommen und gehen nicht, weil sie ihre geistige Mitte verlieren, sie den Glauben an die Transzendenz und sich selbst verlieren oder sie gar am eigenen Reichtum zugrunde gehen, sondern weil sich ihre internationalen Verflechtungsnetzwerke verschieben, vom Klimawandel ganz zu schweigen.
Eine postmoderne Geschichtssicht
Die moralische und morphologische Dimension der Geschichte, die jede ernsthafte Geschichtsphilosophie – vom Philosophen und Kirchenlehrer Augustinus bis zum Philosophen Oswald Spengler – thematisieren muss, bleibt bei ihr vollkommen ausgespart, denn indem sie Struktur für Sinn und Mechanismus für Geist ausgibt, reproduziert sie eine postmoderne Geschichtssicht, die den Menschen und seine Gesellschaft aus seiner eigentlichen historischen Verantwortung entlässt und die großen Fragen des Schicksals und der Selbstbehauptung in ein globales Kaleidoskop von Austauschprozessen auflöst.
Doch wer Identität als bloßes Narrativ betrachtet, übersieht, dass die großen Zivilisationen der Geschichte nicht trotz, sondern wegen ihrer starken geistigen Selbstzentrierung überlebt haben. Die ägyptische, die chinesische, die römische, ja selbst die islamische Zivilisation wäre ohne ein starkes Bewusstsein ihrer eigenen Sendung längst erodiert.
Quinns Darstellung führt dagegen in eine historistische Beliebigkeit, in der alles mit allem verbunden ist und am Ende nichts mehr eine eigenständige Bedeutung besitzt, so dass die Frage nach den Motiven von Politik und Geschichte etwas hilflos nur auf mehr oder weniger böswillig identitär verbrämte Machtfragen reduziert werden kann, hinter denen früher oder später immer der alte weiße Mann lauert.
Die schöpferische Kraft des Abendlands
Quinns Buch ist brillant erzählt, kenntnisreich, geistreich und gelegentlich inspirierend. Es zwingt zum Widerspruch und damit zum Denken. Doch es verfehlt das eigentliche Wesen des Abendlands: Seine Fähigkeit, Tradition nicht als Last, sondern als Aufgabe zu begreifen. Seine Berufung, nicht bloß auf Einflüsse zu reagieren, sondern aus ihnen ein geistiges Gebäude zu formen, das Jahrhunderte überdauert. Seine tiefe Überzeugung, dass Zivilisation nicht im Austausch beginnt, sondern in einem inneren Ruf nach Wahrheit, Schönheit und Ordnung.
Und natürlich allem voran dem ewigen „faustischen Drang“, der den eigentlichen psychologischen Grund unserer Kultur darstellt und diesen mit seinen Höhen und Tiefen erst von innen heraus verständlich macht. Das Abendland hat sich nicht „aus der Welt ergeben“, wie Quinn behauptet. Es hat diese Welt in sich aufgenommen, um aus ihr etwas Neues, Eigenes zu schaffen. Genau dieser schöpferische Akt entzieht sich ihrem Ansatz.
So bleibt „Der Westen. Eine Erfindung der globalen Welt“ ein interessantes, aber letztlich unzureichendes Buch: ein Werk von großer gelehrter Ambition, dessen historiographische Methode jedoch dort bricht, wo Geschichte tatsächlich zur Zivilisation wird. Dass Quinns Thesen in der heutigen akademischen Welt so begeistert aufgenommen werden, sagt mehr über den Zustand unserer Zeit aus als über die Wirklichkeit der Vergangenheit. Das Abendland ist heute vor allem deswegen so gefährdet, weil es sich selbst nicht mehr versteht. Quinns Buch bestätigt diesen Verlust – aber es heilt ihn nicht.
Josephine Quinn, „Der Westen. Eine Erfindung der globalen Welt. 4000 Jahre Geschichte“, Klett-Cotta, Stuttgart 2025, gebunden mit Schutzumschlag, mit Tafelteil und Karten, 688 Seiten, 38,- Euro

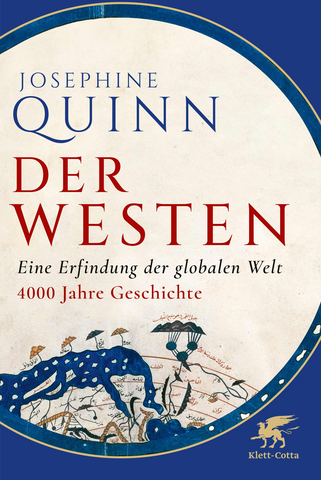





Kommentare