Als Kolumbus bewies, dass die Erde rund ist
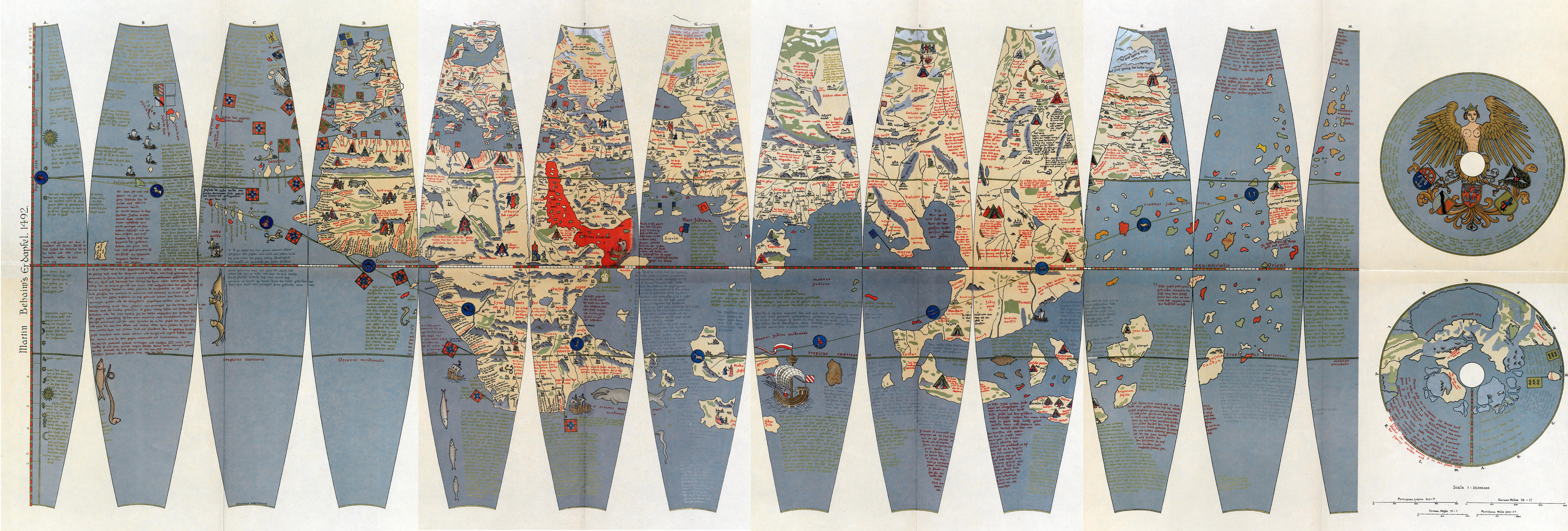
Über wenige Institutionen sind so viele Lügen im Umlauf wie über die katholische Kirche. Eine weitverbreitete Unwahrheit lautet, die Kirche wäre wissenschaftsfeindlich gewesen, weswegen Europa so lange im „finsteren Mittelalter“ verharren musste. Erst durch mutige Vorkämpfer wie Galileo Galilei, sowie durch Aufklärung und Französische Revolution, konnte sich der Fortschritt in Wissenschaft und Denken durchsetzen.
So heißt es, die Kirche hätte den Menschen eingeredet, die Erde wäre eine Scheibe. Schließlich stünde dies so in der Bibel (was nicht der Fall ist), und entsprechend wurden alle Kritiker mundtot gemacht. Hiergegen begehrte Christoph Kolumbus 1492 auf und wollte mit seiner Fahrt nach Asien beweisen, dass die Erde doch eine Kugel sei.
Um dies zu verhindern, versuchte die Kirche Kolumbus von seiner Erkundungsreise über den Atlantik abzuhalten und geriet mit ihm in Streit. Denn Kirchenvertreter gingen damals angeblich davon aus, dass wer mit einem Schiff über den Rand der Erdscheibe fährt, in einen Abgrund stürzt.
Kein Kirchenvertreter bei Verstand glaubte im Mittelalter an die Erde als Scheibe
Diese Räuberpistole fand sich, wie der Historiker Rodney Stark ausführt, bis 2009 sogar noch in zahlreichen deutschen und österreichischen Schulbüchern. So heißt es in „Zeitbilder 5 & 6“ aus dem Verlag E. Dorner, erschienen 2006 in Wien:
„Den meisten Menschen [im Mittelalter] war die antike Vorstellung von der Kugelgestalt der Erde unbekannt. Sie hielten die Erde für eine kreisförmige Scheibe, die von einem weiten Weltozean umgeben war.“
Fakt ist: Kein Kirchenvertreter bei Verstand glaubte im Mittelalter, also circa vom 5. bis zum 15. Jahrhundert, an die Scheibenform der Erde. Bereits in der Antike, ab dem 3. Jahrhundert nach Christus hatte sich die Vorstellung durchgesetzt, die Erde wäre eine Kugel. Die katholische Kirche unterstützte diese Vorstellung, die bereits von antiken Gelehrten wie Aristoteles und im Mittelalter von Theologen wie Thomas von Aquin (1225–1274) vertreten wurde. So schrieb der große Kirchenlehrer:
„Der Sternenkundige beweist durch Sonnen- und Mondfinsternis, dass die Erde rund ist.“ (Summa theologica I q1 a 1 ad 2).
Aber auch im Volkstümlichen, zum Beispiel in den Kirchen selbst, wurde auf die Kugelgestalt der Erde hingewiesen. In vielen mittelalterlichen Kirchen hält das Christuskind auf Mariens Arm stets einen Erdball, nie eine Scheibe in der Hand. Oder man denke an den Reichsapfel der Deutschen Kaiser, lateinisch globus cruciger, ein Herrschaftszeichen in Form einer Weltkugel mit aufgesetztem Kreuz. Die Kugel steht für die Erde, Symbol für die Weltherrschaft des Kaisers, das Kreuz ist Zeichen für das Bekenntnis des Kaisers zum christlichen Glauben.
Wie aufgeklärt und wissenschaftlich dachte Kolumbus selbst?
Worum ging es aber dann bei dem Streit mit Kolumbus? Kolumbus’ Plan stieß bei den Gelehrten der Universität Salamanca auf Kritik – und das zu Recht: Er hatte den Erdumfang deutlich unterschätzt und ging davon aus, dass Japan westwärts über den Atlantik nur etwa 4.500 Kilometer entfernt liege. Tatsächlich beträgt die Luftlinie rund 19.600 Kilometer. Die katholische Kirche war überdies nicht direkt in diesen Disput involviert, sondern das spanische Königspaar Ferdinand und Isabella. Nach jahrelanger Verzögerung erhielt Kolumbus schließlich 1492 die Unterstützung der „Katholischen Majestäten“ (Reyes Católicos).
Erst dreihundert Jahre später wurde die Geschichte von einem angeblichen Streit der Kirche mit Kolumbus wegen der Kugelgestalt der Erde durch den Romanautor Washington Irving in seiner 1828 erschienenen Kolumbusbiografie in die Welt gesetzt. Antiklerikale und protestantische Kreise griffen dieses Märchen begierig auf. Schließlich konnte man mit dieser Geschichte anschaulich die Kirche als wissenschaftsfeindlich und sich selbst als fortschrittlich darstellen. Und so fand das Märchen, die katholische Kirche hätte gelehrt, die Welt wäre eine Scheibe, weitere Verbreitung. Einen historischen Beleg für diesen Streit gibt es jedoch nicht.
Nebenbei gefragt: Wie aufgeklärt und wissenschaftlich dachte eigentlich Kolumbus selbst? So erblickte der von Irving zum aufklärerischen Gegenspieler der Kirche verklärte Kolumbus bei seinen Erkundungsfahrten in der Karibik am 8. Januar 1493 ganz unwissenschaftlich, wie im „Diario de a bordo“ beschrieben, drei waschechte Meerjungfrauen. Er schilderte diese Fabelwesen als allerdings „nicht halb so schön, wie sie gemalt werden“.
Dennoch hält sich der Glaube an die Fortschritts- und Wissenschaftsfeindlichkeit der Kirche hartnäckig. Was viele erstaunen wird, ist, dass ganz im Gegenteil die Naturwissenschaften und der technische Fortschritt im eigentlichen Sinn Kinder der Kirche sind.
Das „finstere Mittelalter“ und die „wissenschaftsfeindliche“ Kirche
Der Begriff „Fortschritt“ hat in Westeuropa einen bösen Beigeschmack bekommen, da linke Sozialingenieure ihn für Gender, Multikulti, Abtreibung, Auflösung der Familie, Sterbehilfe und andere Nihilismen missbraucht haben. Dabei errang das durch die katholische Kirche geprägte Europa bereits im Mittelalter seine Vormachtstellung in der Welt gerade durch seine Bereitschaft, in der Wissenschaft und in den Künsten voranzuschreiten und nicht konservativ im Alten zu verharren. Historiker Rodney Stark (Buch „Bearing False Witness. Debunking Centuries of Anti-Catholic History“) gibt hierfür zwei eindrückliche Beispiele:
So predigte Fra Giordano 1306: „Es wurden noch lange nicht alle Künste und Wissenschaften entdeckt; es werden immer noch neue entdeckt werden, und ein Ende ist nicht in Sicht. Jeden Tag könnte jemand eine neue Kunst oder Wissenschaft entdecken.“
Zur gleichen Zeit herrschte in China ein strengster Konservatismus. So schrieb Li Yen-Chang: „Wenn Gelehrte dazu gezwungen werden, ausschließlich die Klassiker zu studieren und daran gehindert werden, die vulgären Praktiken späterer Generationen zu studieren, dann wird das Reich glücklich sein.“
Rationales Denken, gefördert durch die katholische Kirche
Das Gegenteil ist also der Fall: Das Mittelalter ist das Zeitalter, das Europa wissenschaftlich und technologisch an die Spitze aller anderen Zivilisationen führte. Eine wichtige Ursache hierfür ist die Förderung des rationalen Denkens durch die katholische Kirche. Augustinus schrieb in seinem Brief an Consentius (Epistula 120): „… der Glaube … muss das Herz reinigen, damit es in der Lage ist, das große Licht des Verstands zu empfangen und zu tragen.“
Entsprechend war die Kirche nicht nur eine Förderin der Naturwissenschaften, sie war praktisch die Mutter, die unter dem Begriff „theologia naturalis“ (Natürliche Theologie) die Naturwissenschaften aus dem Schoß der Theologie hervorbrachte. Ziel war, durch Erforschung der Schöpfung Gott selbst näherzukommen. Durch Vernunft und reine Beobachtung der Natur wurde versucht, Gottes Existenz und Wirken zu beweisen, ohne sich explizit auf die kirchliche Lehre oder die Schrift zu stützen.
Die Wurzeln der Natürlichen Theologie reichen bis in die Antike zurück, insbesondere zu Philosophen wie Platon und den Stoikern, die das Göttliche in der Natur verwirklicht sahen. Im Mittelalter wurde dieser Ansatz von christlichen Denkern wie Augustinus weiterentwickelt.
Die Kirche garantierte den Universitäten Forschungsfreiheit gegenüber dem Landesherren
Ein prominenter Vertreter dieser Sichtweise war Thomas von Aquin (1225–1274), dessen Werk „Summa Theologica“ die „Natürliche Theologie“ stark prägte. Er formulierte die „fünf Wege“, um die Existenz Gottes durch Vernunft und Naturbeobachtung zu beweisen, wie durch die Bewegung der Himmelskörper. Drei Beispiele berühmter Naturforscher innerhalb der Natürlichen Theologie sind:
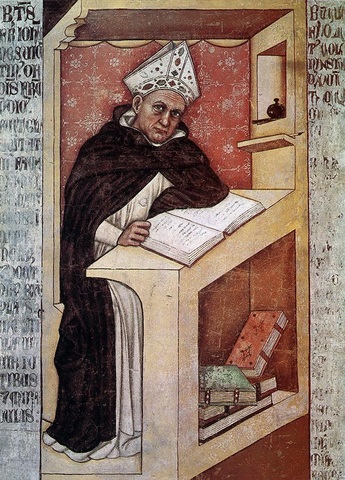
- Albertus Magnus (1200–1280), Bischof von Regensburg, der unter anderem anfing, die Naturwissenschaften zu systematisieren und philosophisch die Grundlagen für die rationale Naturerforschung legte.
- Roger Bacon (ca. 1214–1292), Franziskanermönch, entwickelte die empirische Methode (Beobachtung und Experimente als Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis) und forschte in den Bereichen Optik, Astronomie und Mathematik.
- Nikolaus von Kues (1401–1464), Kardinal und Fürstbischof von Brixen, vertrat die Theorie, dass das Universum unendlich sei und die Erde sich nicht im Mittelpunkt befinde. Forschte u. a. in Mathematik und Astronomie.
Die Kirche errichtete und bestätigte darüber hinaus zahlreiche Universitäten in ganz Europa, die teilweise direkt dem Vatikan unterstanden, womit Forschungsfreiheit gegenüber dem Landesherren garantiert wurde. Die wichtigsten Beispiele sind Paris, Toulouse, Oxford, Cambridge, Rom, La Sapienza, Perugia, Prag und Heidelberg. Päpstliche Bullen verliehen den Universitäten jedoch nicht nur Legitimität, sondern auch Privilegien wie das ius ubique docendi, das Recht, überall, an allen anderen Universitäten zu lehren. Was zusammen mit Latein als Universalsprache zur raschen Verbreitung und Ausweitung des naturwissenschaftlichen Diskurses führte.
Dennoch hält sich der Mythos von der wissenschaftsfeindlichen Kirche hartnäckig. In diesem Zusammenhang wird immer wieder der Fall des Galileo Galilei angeführt.
Kein Kerker, keine Folter: Galileo Galilei
Insbesondere um Galileo Galilei ranken sich seit der Aufklärung wilde Märchen. So behauptete Voltaire 1733 in seinen „Philosophischen Briefen“:
„Der große Galilei, im Alter von achtzig Jahren, seufzte seine Tage in den Kerkern der Inquisition dahin, weil er durch unwiderlegbare Beweise die Bewegung der Erde bewiesen hatte.“
Selbstverständlich wussten viele von Voltaires Zeitgenossen, dass das, was Voltaire da geschrieben hatte, bösartige, antikirchliche Satire war. Nachfolgende Generationen jedoch verstanden diese Worte – ob mit Absicht oder aus Unwissenheit – buchstäblich, und so hält sich der Mythos von Kerkerhaft, Folter und angedrohtem Tod auf dem Scheiterhaufen bis heute.
George Bernard Shaw schrieb in seinem feministisch geprägten Werk „Die heilige Johanna“ (1923): „Galileo war ein Märtyrer, und seine Verfolger unverbesserliche Ignoranten.“
Oder man denke an die Schullektüre „Das Leben des Galilei“ von Bertolt Brecht (1943). Hier wird propagandistisch geschickt die von Voltaire ins Leben gerufene Parodierung ins Absurde getrieben und gegen die katholische Kirche gewendet:

„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher!“
Fakt ist, Galileo geriet sich mit seinem Jugendfreund und Förderer Maffeo Barberini, dem späteren Papst Urban VIII., tatsächlich über wissenschaftliche Theorien in die Haare. Es gab wirklich einen Inquisitionsprozess, der sich laut Rodney Stark um die Frage drehte, ob wissenschaftliche Erkenntnisse wie das heliozentrische Weltbild absolute Wahrheiten sind, wie Galileo behauptete, oder, wie die Kirche sagte, stets vorläufigen, sprich hypothetischen Charakter haben, da die absolute Wahrheit allein bei Gott liegt und Naturwissenschaftler sich irren können.
Luthers Vorwurf: Die Kirche vertrete ein nicht bibeltreues Weltbild
Alles andere jedoch ist frei erfunden. Nicht nur gab es keine Folter, keine Kerkerhaft und erst recht keinen Scheiterhaufen, sondern Galileo stellte sich freiwillig einem Prozess, den er einfach hätte vermeiden können, wäre er nicht freiwillig zu dem Prozess nach Rom gekommen. Der Ausgangspunkt des Streits lag in seinem berühmten Werk „Gespräch über die zwei Weltsysteme“. Hier machte er sich über seinen Freund und Förderer Papst Urban VIII. lustig.
In seinem in Dialogform geschriebenen Buch ließ er den Papst die Rolle des „geistig Schlichten“ („Simplicio“) spielen, der mit sturer Beharrlichkeit an der Behauptung festhält, dass die Sonne sich um die Erde drehe. Dabei war der Papst nicht einmal ein dezidierter Vertreter des geozentrischen Weltbilds. Er hatte wegen der Reformation ganz andere Sorgen. Diane Moczar führt in ihrem Buch „Seven Lies About Catholic History. Infamous Myths about the Church’s Past and How to Answer Them“ aus:
Galileo suchte gezielt die Konfrontation in einer Zeit, in der die Katholische Kirche gerade, was die Naturwissenschaften anbelangt, auf unsicheren Füßen stand. Denn ein Vorwurf von Seiten Luthers und der Reformatoren damals war, dass die katholische Kirche, auch was astronomische Fragen anbelangt, ein nicht bibeltreues Weltbild vertrete. So war einer seiner Vorgänger, Papst Clemens VII. (1478–1534) nicht nur sehr an wissenschaftlichen Fragen interessiert, er stand der heliozentrischen Theorie von Kopernikus wohlwollend gegenüber.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Ferner schrieb Kardinal Nikolaus von Schönberg, Erzbischof von Capua, 1536, also noch vor Galileo, an Kopernikus und ermutigte ihn, seine vollständige Theorie, nämlich dass sich die Erde um die Sonne dreht, zu veröffentlichen:
„Ich hatte nämlich erfahren, dass du nicht nur die Entdeckungen der alten Mathematiker ausgezeichnet beherrschst, sondern auch eine neue Vorstellung vom Aufbau der Welt entwickelt hast. Du lehrst darin, dass sich die Erde bewege … Deshalb, höchst gelehrter Mann, bitte ich dich eindringlich und wiederholt …, dass du diese deine Entdeckung den Gelehrten zugänglich machst …“
Aufgrund der zunehmenden Provokationen durch Galileo jedoch blieb dem Papst nichts anderes übrig, als ihn zu bitten, seine wissenschaftlichen Theorien als Hypothesen zu bezeichnen und nicht als Gewissheiten, wie Rodney Stark ausführt. Dies steigerte jedoch nur Galileos Spottsucht, so dass der Papst schließlich dem innerkirchlichen Druck nachgab und den Prozess zuließ.
Eine Ironie der Geschichte
Eine Ironie der Geschichte ist, dass die Kirche wissenschaftstheoretisch die modernere Position vertat. Denn wie Albert Einstein in seinem 1953 erschienenen Vorwort zu Galileos Werk herausstellte, ist der größte Teil dessen, was Galileo schrieb, heute wissenschaftlich widerlegt. Einstein wörtlich:
„Es war Galileis Sehnsucht nach einem mechanischen Beweis für die Bewegung der Erde, die ihn dazu verleitete, eine falsche Theorie der Gezeiten zu formulieren. Die faszinierenden Argumente des letzten Gesprächs wären … kaum als Beweis akzeptiert worden, hätte sein Temperament ihn nicht überwältigt.“
Bei all dem darf nicht vergessen werden, dass, wie zuvor besprochen, die Naturwissenschaften damals noch eng mit der Theologie verknüpft waren und der Erforschung der göttlichen Schöpfung dienten. Galileos Provokationen waren Teil des Emanzipationsprozesses der Naturwissenschaften von der Theologie, die sich damals innerhalb der durch die Kirche gegründeten Universitäten abspielte. Dem gegen Galileo verhängten milden Hausarrest mag man also kritisch gegenüberstehen, ein „Märtyrer der Wahrheit“ gegen eine „verbrecherische Herrschaft der Lüge“, wie sinngemäß Bert Brecht schreibt, war der bis zu seinem Lebensende tiefgläubige Galileo jedoch nicht.
Das Christentum war die Kraftquelle
Während der moderne Mensch an ein „finsteres Mittelalter“ glaubt, in dem die katholische Kirche brutalst jegliche wissenschaftliche und technologische Entwicklung unterdrückte, führt er ganz selbstverständlich einen Besucher in die mittelalterliche Kirche seiner Stadt und stellt sie ihm als Höhepunkt der Baukunst vor, gegen das kein modernes Gebäude ankommt.
Dass das Mittelalter als „finster“ bezeichnet wird, hat also mehr mit dem seit der Französischen Revolution geführten (Propaganda-)Krieg gegen das Christentum zu tun als mit der Wirklichkeit. Oder glaubt jemand im Ernst, der postmoderne Mensch wäre in der Lage, auch nur eine einzige gotische Kathedrale zu errichten?
Und so war auch für das Abendland der christliche Glaube die Wurzel, aus der alles andere hervorging. Das Christentum war die Kraftquelle, durch welche Europa die moderne Wissenschaft erschuf, die Welt auf eine höhere zivilisatorische Stufe brachte und die ethische Landkarte segensreich umgeschrieben hat.

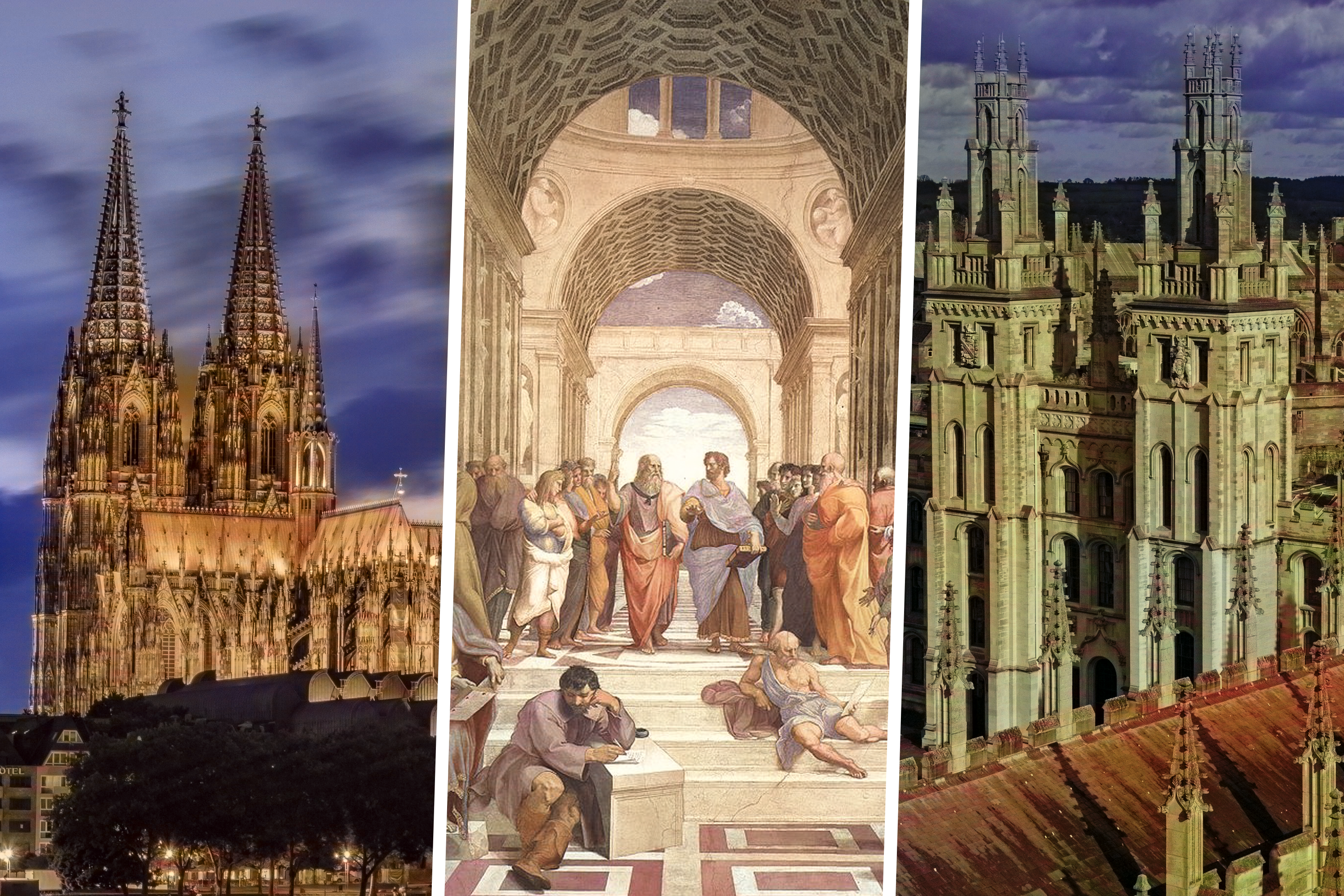



Kommentare
Gegen Ressentiments anzukämpfen mit Mitteln der Vernunft scheint mir eine vergebliche Liebesmüh. Und überhaupt, weshalb sollte "die Kirche" sich ihrer wissenschaftlichen Überlegungen und Gedankenverkrümmungen rühmen? Ist ihr doch vielmehr noch die Offenbarung anvertraut! Sicher, eine "Alma Mater" rühmt sich gern der Brosamen, die ihr unterm Tisch zufallen und schöne und wertvolle Erkenntnisse sind gelegentlich damit verbunden, aber auch viel Leid ist schon daraus erwachsen und vor allem ist das Studium doch meist eine staubtrockene Angelegenheit. Der erlösenden Momente sind wenige und am Ende bleibt viel Blasses und Fades übrig, oder, um es mit den Worten des Aquinaten zu sagen, der 49 Jahre alt wurde: „Alles, was ich geschrieben habe, kommt mir vor wie Stroh im Vergleich zu dem, was ich gesehen (geschaut) habe."
@Dinah Na ja. Den wenigsten von uns sind Schauungen wie einem Thomas von Aquin vergönnt.
Was Ihnen als staubtrockenes Studium vorkommt, macht anderen Leuten, unter anderem mir, Freude.
Gott hat sich uns in Christus offenbart, aber darüber hinaus gibt es immer noch genug zu entdecken, erfahren, wissen und verstehen.
Dass wir die Offenbarung haben, ist kein Grund, sich mit Selbstzufriedenheit zu begnügen oder nicht neugierig zu sein.
"Dennoch hält sich der Glaube an die Fortschritts- und Wissenschaftsfeindlichkeit der Kirche hartnäckig."
"Cui bono?" Auch eine alte, zeitlose Weisheit. ;-)
Das Märchen vom abergläubischen Mittelalter und dem Glauben an die Erde als Scheibe hält sich, weil die Moderne ihre eigene geistige Armseligkeit kaschieren muß. Daß die Katholische Kirche absolutes Wissen für den Menschen bestritt, macht sie dabei hyper-modern, stellt sie also über eine überhebliche Moderne. Wirkliche Wissenschaftler wissen das.