Jenseits von Wirklichkeit

Mit der Wirklichkeitsfiktion von der künstlichen Bestimmbarkeit des Geschlechts zerbricht die Realität ebenso wie das Wesen der Sprache in Bezug auf Benennung der Wirklichkeit und Mitteilung. Da gibt es – eigentlich erst seit relativ wenigen Jahren – diejenigen, die davon ausgehen, dass das Geschlecht frei wählbar und austauschbar sei, und da gibt es die anderen, die sich in die Rolle der Verteidigung der evidenten Tatsache gedrängt sehen, dass der Mensch als Mann oder Frau geboren ist.
Der chromosomalen und anatomischen Faktizität wird in der absurdesten aller Wirklichkeitsfiktionen das entgegengesetzt, als was man „sich fühlt“: Der seltsame, aber mittlerweile standardisierte Satz „Ich identifiziere mich als Mann/Frau“ signalisiert, dass jemand sein ursprüngliches Geschlecht (das in „politisch korrekter“ Sprache mittlerweile als „das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht“ fungiert – als hätte die Hebamme massiv ihre Kompetenz überschritten) zugunsten des anderen Geschlechts ablehnt.
Man beachte die unhinterfragt widersprüchliche Sprachverwendung: während auf Seiten dessen, der „sich als … identifiziert“ in der Formulierung gleichsam alles möglich ist, haben die Empfänger der Botschaft die Faktizität der neuen Identität unbedingt und gehorsam zu bestätigen: Er fühlt sich als Frau, also „ist“ er eine Frau. Nicht zu vergessen, dass die Proklamation auch heißen kann „Ich identifiziere mich weder als Mann noch als Frau“ – denn das mit den zwei Geschlechtern soll ja auch nicht stimmen, es fließt. Das heißt, es gibt keine Definitionen (vgl. das Wort „finis“ = Grenze, Begrenzung) mehr, sondern nur mehr „Selbst-Bestimmung“ – was an Romano Guardinis Wort von der „Hybris der Autonomie“ als Kennzeichen der Neuzeit denken lässt.
Die Zeit löst die Entwicklungsdramen
Zum Begriff der „Fluidität“: die kann es in der Pubertät tatsächlich geben, im Sinne von (vorübergehenden) Suchbewegungen hin zur Identität der erwachsenen Frau oder des erwachsenen Mannes. Ein frühes Outing, egal, ob „Ich bin trans!“ (oder auch „Ich bin lesbisch/schwul!“), ist in dieser frühen und labilen Phase wohl wenig ratsam oder kann auf eine determinierende Spur setzen, die oft weniger selbstbestimmt ist als vielmehr – wie der Kinder- und Jugendpsychiater Alexander Korte äußerte – auch ein „Zeitgeistphänomen“.
Laut den Ergebnissen einer repräsentativen Studie, in der bundesweite Abrechnungsdaten der kassenärztlichen Vereinigungen von 2013 bis 2022 ausgewertet wurden, habe nach fünf Jahren nur noch etwa ein Drittel der Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren eine gestörte Geschlechtsidentität, schrieb die NZZ vor knapp anderthalb Jahren. Bei den Mädchen im selben Alter seien es sogar nur rund 27 Prozent gewesen, bei denen die Diagnose bestehen blieb. Ein ähnlicher Trend zeige sich in internationalen Studien.
Die logische Folge dieser Studienergebnisse müsste eigentlich sein: Einfach einmal abwarten und auf jeden Fall nichts tun, was irreversibel in den Körper eingreift, sei es hormonell, sei es operativ. Doch leichter gesagt als getan. Denn der Wind weht in die andere Richtung: „Selbstbestimmungsgesetze“ blockieren den Einfluss der Eltern, die Schule befördert nur zu schnell die „soziale Transition“, und eine ausschließlich affirmative Begleitung wird schlicht vorausgesetzt – ungeachtet zunehmender Zahlen und Zeugnisse von Detransitioners.
Aus wenig beachteten Anfängen zur Dominanz und Relevanz
Die Ablösung der geschlechtlichen Bestimmtheit als Mann oder Frau durch eine behauptete Geschlechtsfluidität geht einher mit einer unerträglichen Korrumpierung der Sprache, die vor den Karren der fatalen Fiktion gespannt wird: Denn wenn Wirklichkeit nicht benannt und beschrieben, sondern – entgegen jeglicher Evidenz und Vernunft – beharrlich ein Gegenentwurf als wirklich behauptet wird, wird Sprache zur Lüge wie im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“!
Mit Verweis auf diese Parabel leitete Jan Ledóchowski, Obmann der Plattform Christdemokratie in Wien, ein Gespräch ein über „Europas Umgang mit Geschlecht und Realität“ zwischen Faika Anna El-Nagashi (ehemals für Die Grünen im österreichischen Nationalrat) und Caroline Hungerländer (ÖVP-Landtagsabgeordnete in Wien).

Erfreulicher Anlass der Veranstaltung war die Vorstellung des neugegründeten Athena-Forums, dessen Direktorin Faika El-Nagashi ist. Die europaweit ansetzende Denkfabrik will die immer mehr um sich greifende Theorie einer selbstbestimmten Geschlechtsidentität in Politik und Gesellschaft darstellen, transparent machen und sich dagegen zur Wehr setzen. Über die Entwicklung bis hin zur Dominanz und politischen Relevanz des gefühlten Geschlechts informiert die erste Broschüre des Athena-Forums mit dem Titel „Unter der Oberfläche. Wie die Gender-Identität Europa umgestaltet“.
Hoffnungszeichen einer politischen Kultur der Vernunft
Endlich soll es fundierte Aufklärung darüber geben, wie europäische Trans-Lobbygruppen in den letzten 15 Jahren einen Richtungswechsel hin zum gefühlten Geschlecht durchsetzten, der das biologische Geschlecht als rechtliche und materielle Grundlage zunehmend ignoriert: so würden etwa Schutzräume wie Toiletten und Umkleidekabinen für Männer geöffnet, die sich als Frau „identifizieren“.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Die Broschüre des „Athena-Forums“ betont, dass entsprechende Veränderungen etwa durch „Leitlinien, Empfehlungen und andere Instrumente von Soft Law“, also rechtlich nicht Bindendes, aber dennoch Prägendes, „vorangetrieben würden, die institutionelle Normen ohne öffentliche Debatte neugestalten“.
Man kann es als Hoffnungszeichen einer politischen Kultur der Vernunft sehen, dass sich – ungeachtet völlig unterschiedlicher weltanschaulicher Provenienz und Lebensentscheidungen – die kritische Feministin Faika El-Nagashi und die Konservative Caroline Hungerländer im Kampf gegen die Auflösung des Geschlechts finden. Derartige ungewöhnliche Koalitionen wären ein hochspannendes Modell für eine neue (parlamentarische) Debattenkultur, das zeigte die Wiener Veranstaltung auf beeindruckende Art und Weise.
Das „Non-binäre-Nichte-Syndrom“
Aber auch, dass zuerst die Knebelung durch die oben geschilderte Wirklichkeitsfiktion abgestreift werden muss und in einem entschiedenen Widerstand gegen die dominante Ideologie großflächig neue Freiräume freier und wirklichkeitsgemäßer Rede erkämpft werden müssen. Das ist höchst unbequem und anstrengend, aber wenn der Angriff auf die körperliche Integrität von Kindern und Jugendlichen beendet werden soll, müssen wir – endlich! – reden statt schweigen, uns für Offenheit und aktives Dagegenhalten entscheiden, als Eltern, als Erwachsene, als Staatsbürger.
Wie es überhaupt so weit kommen konnte? Lange habe man das Trans-Phänomen als nicht relevant für den Großteil der Bevölkerung empfunden, sein Potenzial unterschätzt beziehungsweise es verabsäumt, es rechtzeitig zu bekämpfen. Faika El-Nagashi holte bis zum „Non-binäre-Nichte-Syndrom“ aus: Betroffenheit im eigenen Umfeld blockiere und verhindere Positionierung. Was im – überwiegend konservativen – Publikum hoffentlich am meisten nachhallt, ist dieser Satz El-Nagashis: „Wir müssen eine Debatte führen. Denn das Vermeiden einer Debatte ist das, was diesem Thema sehr lange sehr geholfen hat.“
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

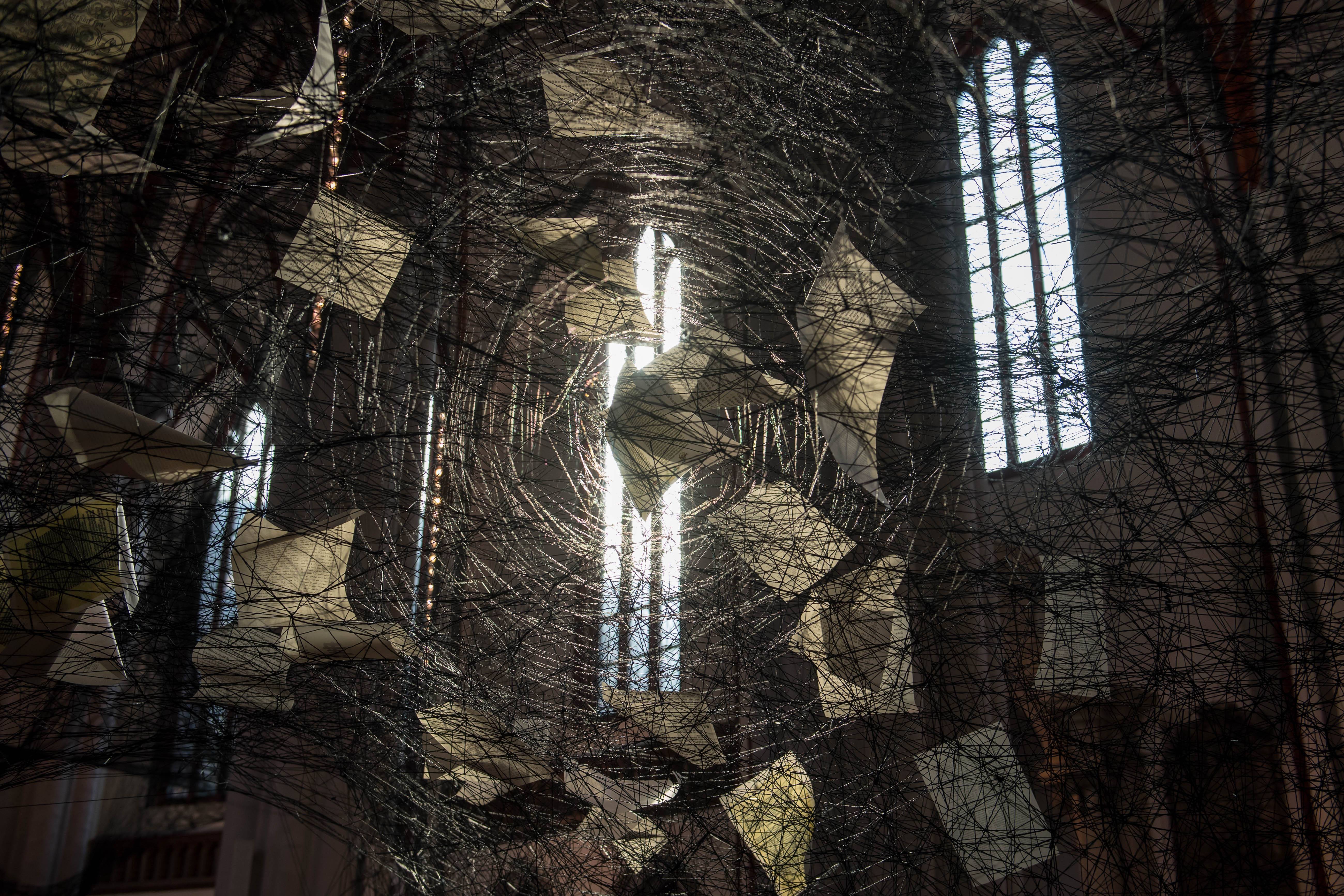



Kommentare
Jedes Gefühl entzieht sich kategorisch jeder Überprüfbarkeit und bleibt daher immer subjektiv. Die Genderindustrie zielt also letztlich auf die Vernichtung der Objektivität ab. Wenn nun eine mittels behauptetem (!) Gefühl erfundene, neue und kontrafaktische (Pseudo)Faktizität des einen Menschen ernstzunehmen sein soll, dann muss es auch nicht nur erlaubt, sondern ebenso ernstzunehmen sein, wenn ein anderer Mensch ersterem auf seine Genderselbstbezeichnung antwortet, wie er diesen Menschen fühlt.
Beispiel: Frau A. trifft nach einiger Zeit ihre alte Bekannte Frau B. wieder und sagt zu ihr: "Ich fühle mich jetzt als Mann, reden Sie mich also bitte als Herr A. an." Dann könnte Frau B. mit dem gleichen Recht antworten: "Da ich Sie aber als Frau fühle, werde ich Sie weiter als Frau anreden."
Da mittels Gefühlspriorisierung jede Objektivität zerstört ist, ist auch jede Möglichkeit zu einer Wahrheitsfindung verloren. (Der Wunsch zur Wahrheitsfindung ist bei den Genderisten ohnehin längst nicht mehr vorhanden.) Damit kann aber kein Gefühl des einen Menschen dem Gefühl eines anderen Menschen über- oder untergeordnet werden. Frau B. hat also dasselbe Recht ihr Gefühl zu priorisieren wie es Frau A. für sich in Anspruch nimmt. Kategorien wie Beleidigung, Unhöflichkeit usw. scheiden dann aus. Im Rahmen allgemeiner Subjektivität ist es unmöglich dem Gefühl des einen Menschen einen höheren Rang vor dem eines anderen einzuräumen. Jede richterliche Entscheidung diesbezüglich wäre von vornherein unmöglich. Eine solche dennoch zu treffen wäre immer willkürlich und damit in diesem neuen System Unrecht.
Vielen Dank für diesen mutigen großartigen Artikel!
Mit der Gendertheorie hat man ein Fass ohne Boden aufgemacht. "Die Identität eines Menschen hat nichts mit seiner Physis oder seinen biologischen Eigenschaften zu tun" - das ist das Grunddogma der Gender-Ideologie. Nimmt man das ernst, kann man aber nicht beim Geschlecht stehen bleiben. Gerade in Zeiten von Critical Race Theory kann es sein, dass sich immer mehr Menschen mit ihrem Phänotyp unwohl fühlen. Analog zum "Geschlechtswechsel" müsste dann auch hier ein Wechsel möglich sein. Soweit ich weiß, hat ein amerikanischer Philosophieprofessor tatsächlich versucht, unter Berufung auf genau diese Argumentation sich von der Universität als "Schwarzer" anerkennen zu lassen. Er ist damit allerdings gescheitert. Wäre ein solcher Wechsel möglich, könnten sich Weiße etwa der "kolonialen Vergangenheitsbewältigung" bequem entziehen indem sie einfach erklären, sie gehörten selbst zu den Opfern des Kolonialismus. Weiße könnten dann auch "affirmative actions" und ähnliches für sich in Anspruch nehmen. Es verwundert nicht, dass sich Linke über solche Möglichkeiten ausschweigen.
Das Beispiel zeigt: Es geht schlicht um die Durchsetzung der linken Kulturagenda. Mit Logik, Wissenschaft oder Gerechtigkeit hat all das nichts zu tun.
@EUM
Ja, das stimmt. Man könnte dann bei jedem äußeren Merkmal weiter machen. Menschen mit Glatze z.B. könnten sich als jemand mit vollem Haar fühlen, weshalb man sie dann nicht als "skinhead" bezeichnen dürfte. Menschen ohne jegliche körperliche Einschränkung könnten sich als Behinderte fühlen, woraufhin ihnen z.B. ermäßigter Eintritt zu gewähren wäre. usw.
Da Sie das Thema Kolonialismus ansprechen, möchte ich dazu das Buch von Bruce Gilley "Verteidigung des deutschen Kolonialismus" empfehlen. 9783948075934, Manuscriptum 2021.
Ich stellte mir gerade vor, wenn ein Bio Mann zum Gynäkologen geht und sagt , ich fühle mich als Frau und möchte meine jährliche Vorsorgeuntersuchung machen,...was der wohl sagen wird??