Der Relativismus frisst seine Kinder
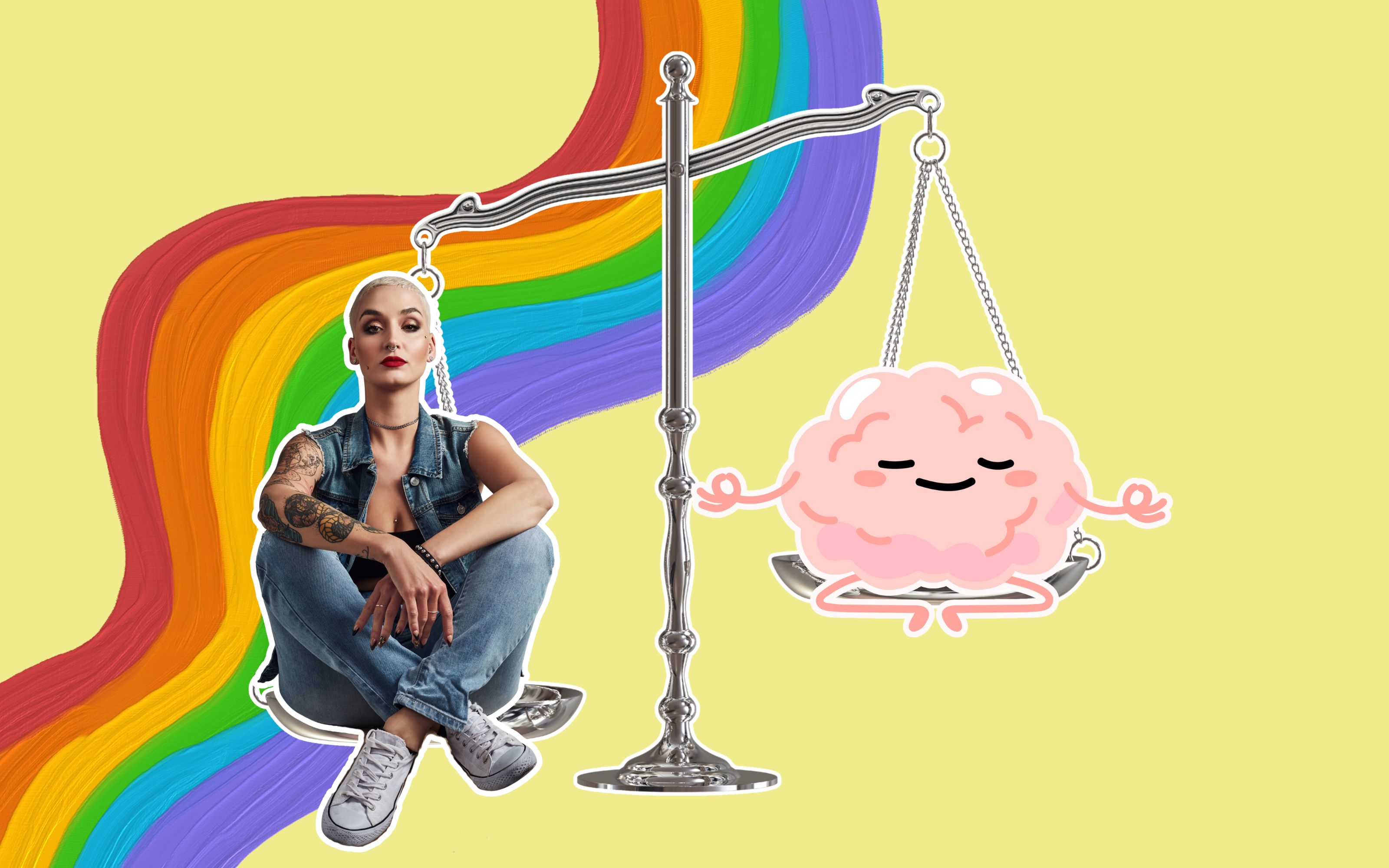
Die mehr als fünf Dekaden, die Joe Biden den USA als Politiker diente, waren gepflastert von zahlreichen Versprechern und unbedachten Äußerungen des Demokraten. Ein Auftritt bei der sonntäglichen Politik-Talkshow „Meet The Press“ im Mai 2012 ist dabei in die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika eingegangen. Als der damalige Vizepräsident von Moderator David Gregory gefragt wurde, wie er denn zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Eheschließungen stehe, äußerte sich Biden zustimmend.
Mit dieser offenbar mit dem Weißen Haus nicht abgesprochenen Aussage brachte Biden seinen Präsidenten Barack Obama in die Bredouille. Denn dieser sprach sich zwar einerseits gegen die Diskriminierung von homosexuellen Paaren aus. Andererseits ging dem 44. US-Präsidenten die landesweite Legalisierung von gleichgeschlechtlichen Ehen zu weit. Offenbar aus wahlkampftaktischen Gründen, fand doch im November des Jahres 2012 die Präsidentschaftswahl statt. Weder wollte Obama ein zur damaligen Zeit polarisierendes Thema noch stärker auf die Agenda setzen noch eher konservativ eingestellte US-Amerikaner in den so bedeutenden Swing States verprellen.
Der Wandel in den USA
Am 26. Juni 2015 legalisierte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten sodann im Grundsatzurteil „Obergefell vs. Hodges“ mit fünf zu vier Richterstimmen homosexuelle Ehen in allen US-Bundesstaaten und Territorien. Eine zum damaligen Zeitpunkt kontroverse Entscheidung, sprachen sich doch laut dem Pew Research Center im Jahr 2012 noch 45 Prozent der US-Amerikaner gegen und 46 Prozent für die Möglichkeit von Ehen zwischen Homosexuellen aus. Im Jahr 1996 lehnten sogar noch zwei Drittel der US-Amerikaner gleichgeschlechtliche Ehen ab.
Heutzutage hat sich der sprichwörtliche Wind gedreht, ein einst polarisierendes Thema bestimmt kaum noch den ansonsten so unerbittlich ausgetragenen Kulturkampf. Knapp zwei Drittel der US-Amerikaner befürworten Ehen zwischen Homosexuellen, nur noch 37 Prozent der US-Amerikaner lehnen diese ab. Vier von fünf Demokraten sowie 43 Prozent der Republikaner befürworten die Liberalisierung. Laut einer Erhebung des Pew Research Center aus dem Jahr 2024 plädierten sogar 54 Prozent der US-Katholiken für die Anerkennung homosexueller Ehen durch ihre Kirche. Der einstige Präsident Biden, der sich früh für die staatliche Anerkennung dergleichen aussprach, ist wohlgemerkt katholischen Glaubens.
Die Diskussion um gleichgeschlechtliche Ehen nahm in den USA einen immensen medialen und politischen Raum ein. Dabei werden laut dem U.S. Census Bureau aus dem Jahr 2023 nur 1,3 Prozent aller Ehen von homosexuellen Paaren geschlossen. In absoluten Zahlen sind dies 774.553 Haushalte. Der Anteil homosexueller Partnerschaften an allen unverheirateten Haushalten liegt bei 5,6 Prozent.
Gleichgeschlechtliche Ehen in Deutschland
Die Debatte um gleichgeschlechtliche Ehen verlief in Deutschland hingegen deutlich gemäßigter ab als in den USA. Gleichwohl auch auf dem alten Kontinent teilweise emotional geführt, kann die letztendlich ausschlaggebende politische Entscheidung, die zur Liberalisierung des Eherechts führte, als Symbol für die deutsche Diskussion diesbezüglich herhalten. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ nämlich ihre Fraktion wissen, dass doch jeder Abgeordnete einfach nach dem eigenen Gewissen abstimmen solle.
Der langjährige Widerstand gegen die Ausweitung der bürgerlichen Ehe von Seiten der Christdemokratie wurde somit ad absurdum geführt. 75 Christdemokraten stimmten am 1. Oktober 2017 schlussendlich für die Liberalisierung, so dass insgesamt 393 Bundestagsabgeordnete für die Einführung der sogenannten „Ehe für alle“ votierten. 226 Abgeordnete stimmten bei vier Enthaltungen dagegen.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Laut dem Statistischen Bundesamt wurden zwischen den Jahren 2017 und 2023 circa 84.800 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen. Allein im Jahr 2023 trauten sich 9.228 homosexuelle Paare. Die rückläufige Tendenz an neu geschlossenen Ehen konnte jedoch auch die Ausweitung des Eherechts nicht stoppen: Im vergangenen Jahr gaben sich in Deutschland nur noch insgesamt 349.221 Paare das (weltliche) Ja-Wort. Im Jahr 1950 lag dieser Wert noch bei über 750.000, im Jahr 1990 bei über 500.000.
Der Mikrozensus 2024 hat zudem ergeben, dass 208.000 gleichgeschlechtliche Paare, unabhängig von ihrem Beziehungsstatus, in Deutschland leben. Davon leben laut Bundesamt für Statistik in 31.000 homosexuellen Haushalten insgesamt 50.000 minderjährige Kinder. Ein vergleichsweise geringer Wert, existieren in Deutschland doch 8,4 Millionen Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Deutschland war das 23. Land, in dem gleichgeschlechtliche Ehen legalisiert wurden, die USA die 19. Nation. Als erstes Land legalisierten die Niederlande Eheschließungen von homosexuellen Paaren im Jahr 2001, mittlerweile haben 40 Länder ihr Eherecht liberalisiert.
Verpasste Chancen
In den vergangenen Jahren gab es in zumeist liberalen Demokratien einen immensen gesellschaftlichen Liberalisierungsschub. Homosexuellen Personen wurden mehr Rechte zugesprochen, gleichgeschlechtliche Ehen haben sich im juristischen, politischen und gesellschaftlichen Verständnis normalisiert. Eine Begebenheit, der in diesem Beitrag keiner Beurteilung bedarf. Von höherer Bedeutung ist jedoch die Analyse der auf die Etablierung der sogenannten „Ehe für alle“ erfolgten Debatte. Diese war (und teilweise ist) nämlich weder förderlich für homosexuelle Paare noch für die gesamte Gesellschaft.
Die Hochphase gesellschaftspolitischer Liberalisierung wurde nämlich nicht dafür genutzt, eine der größten Herausforderungen, die für alle liberalen Demokratien des freien Westens nahezu gleich stark besteht, zu adressieren. Die Rede ist von alternden sowie größtenteils schrumpfenden Gesellschaften. Allein aus politisch-ökonomischer Sicht entstehen hieraus enorme Belastungen für den Sozial- und Wohlfahrtsstaat, die sich schon heute bemerkbar machen. Des Weiteren wurde sich nicht mit einem Wertewandel auseinandergesetzt, der die Familie als Keimzelle einer jeden Gesellschaft in Frage stellt. Die insgesamt sinkende Anzahl an Eheschließungen, trotz Liberalisierung des Eherechts, unterstreicht diese Veränderung.
An die Stelle unaufgeregter, tiefgehender Debatten, die zu nachhaltigen Lösungen für oben genannte Herausforderungen hätten beitragen können, war das vergangene Jahrzehnt von einer Hochphase eines von großen Teilen aus Politik, Medien und Wirtschaft propagierten Relativismus geprägt. „Eine Diktatur des Relativismus“, bei der alles beliebig und nichts mehr endgültig scheint, vor der schon Joseph Ratzinger warnte, brach sich Bahn. Auch die Katholische Kirche blieb von dieser Entwicklung nicht verschont wie das Pontifikat des verstorbenen Franziskus sowie der Synodale Weg in Deutschland zeigen sollten.
Gesellschaftspolitische Trendwende
Mit Blick auf die Umwälzungen Frankreichs im 18. Jahrhundert war einst davon die Rede, dass „die Revolution ihre Kinder frisst“. Im 21. Jahrhundert ist dieser Satz abzuändern in „der Relativismus frisst seine Kinder“. Der Liberalismus schlug nämlich über die Schlänge, in dem grundlegende Wahrheiten hinterfragt und sich gegen das Leben gestellt wurde. Als Antwort auf die sogenannte Woke-Bewegung entstand eine Anti-Woke-Bewegung, auf deren Welle beispielsweise ein Donald Trump in den USA zum zweiten Mal in das Weiße Haus gespült wurde. Ein erneuter Wandel in der Gesellschaftspolitik wurde hierdurch in den liberalen Demokratien des Westens eingeläutet. Die letzte Antwort auf die gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit kann eine „Anti“-Bewegung jedoch auch nicht darstellen.
Vielmehr benötigt es Verantwortliche in Politik, Gesellschaft und Religion, die sich gegen oben beschriebene Extreme stellen und für innere Stabilität in sicherheitspolitisch turbulenten Zeiten sorgen. Papst Leo XIV. beispielsweise sorgte mit seinen ersten Auftritten nicht nur für Enthusiasmus unter den Gläubigen. Auch gibt er der Katholischen Kirche zu Beginn seines Pontifikats ihre Stabilität zurück. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri erhebt sich gegen die „Diktatur des Relativismus“. Und dies mit ganz bedachten, wohl überlegten Äußerungen.
Auch Julia Klöckner wartet in den ersten Wochen in ihrem neuen Amt als Bundestagspräsidentin mit wohlüberlegten Worten und Entscheidungen auf. Beispielsweise wurde die sogenannte Regenbogenflagge der LGBTQ-Bewegung nur noch am 17. Mai am Deutschen Bundestag gehisst. An diesem Tag wird an die Streichung von Homosexualität als Krankheit aus dem Diagnoseschlüssel der WHO (1990) sowie an die Nichtigkeit von Urteilen gegen Homosexuelle aus der NS-Zeit durch den Deutschen Bundestag (2002) gedacht. Die Beflaggung wird sich jedoch ausdrücklich nicht auf andere Tage, sprich am Christopher Street Day (CSD) wie in den Jahren zuvor, erstrecken. Ebenso wurde einer queeren Gruppe der Bundestagsverwaltung die offizielle Teilnahme am CSD untersagt.
Klöckner begründete ihre Entscheidung mit dem Neutralitätsgebot. Auf einer Personalversammlung des Bundestags wurde die Christdemokratin damit konfrontiert, explizit wurde hinterfragt, weshalb im Sitzungssaal vor dem Hintergrund, der von ihr formulierten Neutralität denn noch ein Kreuz hängen würde. Klöckner antwortete darauf, dass es „ohne das Kreuz die offene Gesellschaft, wie wir sie heute in Deutschland haben“, gar nicht geben würde. Damit wäre am Ende des Regenbogens alles gesagt.


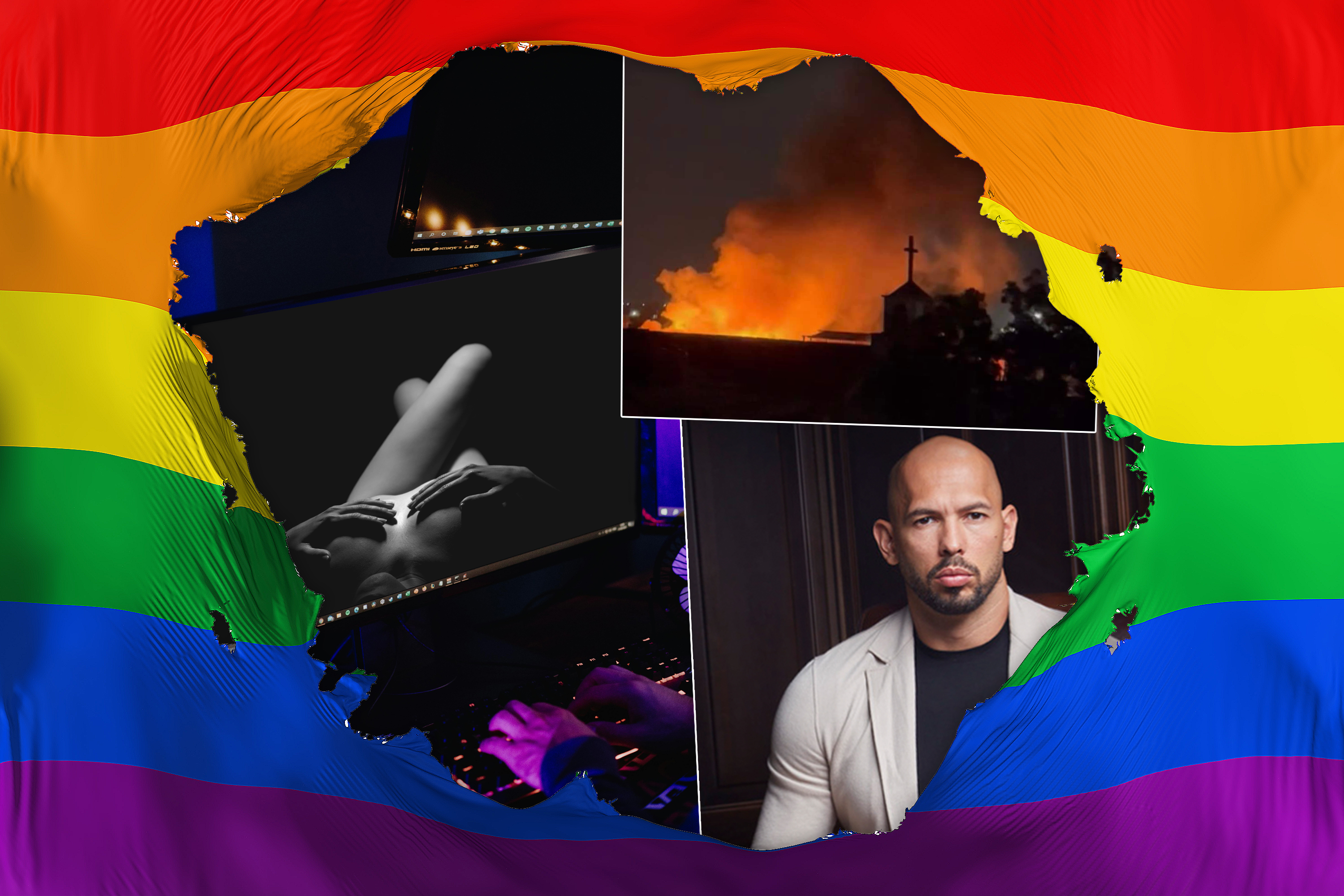


Kommentare
Herr Hülss, waren nicht die Regierenden, gerade wenn sie konservativ sind, sehr bedacht, ja geradezu zahm? Hätte ein vehemterer Widerstand nicht eher geholfen?
Es klingt natürlich vernünftig, zu sagen, man hätte zu "unaufgeregten, tiefgehenden Debatten (...) beitragen können", aber dazu hätte es jemanden gebraucht, der daran interessiert gewesen wäre. Die "Progressives", also die Leute, die man heute "woke" nennt und die im Wesentlichen Kommunisten sind, die sich heute dezentral und nicht in einer Kommunistischen Partei organisieren, sind Leute, die nicht an inhaltlicher Debatte interessiert sind. Sie wollen Macht und sie wollen herrschen. Wenn sie sich bedroht fühlen, fangen sie an, im ÖRR Denunziationskampagnen gegen ihre Feinde zu führen und wenn sich Leute an der Wahlurne dagegen wehren, na dann wird halt über Parteiverbote geredet und die Innenministerin fälscht einen Bericht oder verbietet eine Zeitung. Da ist nichts zu machen, mit "unaufgeregten Debatten", weil die Hysterisierung der Diskurse die Strategie der Wahl ist. Die Grünen und die Linken sind das Establishment, das den Ton angibt und die "Demokratie" für sich so monopolisiert haben, dass jeder, der kein Kommunist ist, bereits als rechtsextrem gilt. Sie müssen anfangen, das bisher für sie Undenkbare als reale Tatsache zu akzeptieren:
Trump ist der Vernünftige hier, genauso wie die Marine Le Pen, Giorgia Meloni, die AfD oder die FPÖ. Wenn sie unaufgeregte Debatten und tiefgehende Gespräche haben wollen, müssen sie dort anfangen. Wenn sie glauben, dass ihnen Leute wie Nietzard, Reichinnek, Neubauer oder Eckhard-Göring dabei entgegenkommen, dann viel Glück.
@Jurek Molnar Unaufgeregte Debatten? Bei Trump in den USA? In der AfD in D? Bei der FPÖ in A? Wenn der Wind sich mal gedreht hat, dann wird gelten, wenn ich mir die Abwandlung erlauben darf:
Die Blauen und die Braunen sind das Establishment, das den Ton angibt und die "Demokratie" für sich so monopolisiert haben, dass jeder, der kein Nationalkonservativer ist, bereits als linksextrem gilt.
Das kann man in den einschlägigen Foren und Kommentarbereichen übrigens jetzt schon sehr genau beobachten. Nein, „Unaufgeregtheit“ und „Besonnenheit“ findet man auf keiner Seite des Hufeisens. Sie wissen schon, wenn ein Finger auf die andere Seite zeigt, dann weisen vier andere auf einen selbst zurück.
die sogenannten christlichen Werte haben in der Gesellschaft keine Mehrheit mehr und das ist sehr gut so,
an der gleichgeschlechtlichen Ehe in den USA sieht man das sehr gut
vor der Einführung wurde heftig diskutiert da wurde sie eingeführt und die Welt ging nicht unter.
Jetzt sind das Ehepaar Paul und Michael als Nachbarn etwas ganz normales geworden
den Kirchen passiert so etwas übrigens öfter die Päpste des 19 Jhd bezeichneten die liberale Demokratie als Verdammenswert.
Gregor XVI spricht von der Pressefreiheit als Wahnsinn
und seit 50 Jahren tut die Kirche so als hätte sie die Menschenrechte erfunden
die Aussage zum Kreuz von Frau Glöckner ist historisch völlig falsch
@Thomas Kovacs die Aussage zum Kreuz von Frau Glöckner ist historisch völlig falsch
Nein, die Aussage ist vollkommen richtig – oder gehören Sie auch zu den Leuten, die Aufklärung als historisch völlig voraussetzungslos, als aus dem Nichts geboren ansehen?