Schweigen kann tödlich sein

In der öffentlichen Debatte gibt es Wörter, die so mächtig sind, dass sie alles überstrahlen. „Femizid“ ist ein solches Wort. Dieses Schlagwort signalisiert Haltung, Engagement, Sensibilität. Doch wie so oft, wenn ein Begriff zum moralischen Kampfbegriff aufgeladen wird, droht er mehr zu verschleiern als zu erklären.
Seit einiger Zeit kommt es in der Schweiz zu einer Häufung von tödlichen Gewaltdelikten, in denen ein Mann der Täter und eine Frau das Opfer ist. An Forderungen fehlt es nicht. Sie reichen vom besseren Schutz für gefährdete Frauen bis zu Statistiken, die Femizide als eigene Kategorie berücksichtigen.
Dem zugrunde liegt die Annahme, jedes Tötungsdelikt an einer Frau sei ein Fall von struktureller Gewalt gegen das weibliche Geschlecht. Wer das Wort „Femizid“ in den Mund nimmt, macht sofort klar: Hier geht es um Gewalt gegen Frauen, und diese Gewalt ist besonders, weil sie Frauen trifft. Mit dem Begriff wird ein Narrativ geschaffen: Männer sind Täter, Frauen sind Opfer. Punkt.
Komplexere Ursachen
Problematisch dabei ist: Diese Verkürzung wird der Realität nicht gerecht. Niemand bestreitet, dass Gewalt gegen Frauen ein dringliches Problem ist. Aber die Ursachen sind komplexer, als es der Sammelbegriff suggeriert.
Wer die Statistiken betrachtet, sieht zwar, dass die meisten Täter Männer sind. Doch wer genauer hinschaut, erkennt auch: Die Taten häufen sich in bestimmten Milieus, in bestimmten kulturellen Kontexten, bei Menschen mit bestimmten biografischen Prägungen. Diese Faktoren sind entscheidend, wenn man Gewalt verstehen und verhindern will. Sie verschwinden aber aus der Debatte, sobald man alles unter dem Begriff „Femizid“ zusammenfasst.
Die Folge ist eine banale Formel: Männer sind gefährlich, Frauen sind schutzlos. Damit wird das gesellschaftliche Problem auf eine plumpe Geschlechterfrage reduziert. Wer so argumentiert, entlastet sich von der Pflicht zur Analyse. Es ist einfacher, das Patriarchat anzuprangern, als zu fragen: Wer sind die Täter? Wo kommen sie her? Welche kulturellen Muster, welche Vorstellungen von Ehre und Besitz spielen eine Rolle?
In welchen Kulturen herrscht Patriarchalismus?
Dass man über diese Fragen kaum spricht, ist kein Zufall. Denn sobald man sie stellt, wird es unangenehm. Man müsste darüber reden, dass ein erheblicher Teil der Gewalttaten gegen Frauen von Männern aus Kulturkreisen begangen wird, in denen die Frau traditionell eine untergeordnete Rolle spielt. Man müsste einräumen, dass Integration nicht nur ein ökonomisches Thema ist, sondern auch eines der Werte und Normen. Und man müsste anerkennen, dass es Gruppen gibt, in denen patriarchale Gewalt ein akzeptiertes Mittel ist, um „Ordnung“ in Familie oder Partnerschaft durchzusetzen.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Genau das geschieht aber nicht. Stattdessen wird die Debatte auf eine symbolische Ebene verschoben. „Femizid“ wird zu einer Art Zauberwort, mit dem man Betroffenheit ausdrückt, ohne etwas ändern zu müssen. Die Politik kann Statistiken präsentieren, NGOs können Kampagnen starten, Medien können Schlagzeilen produzieren. Doch an den eigentlichen Ursachen rührt niemand.
Die Konsequenz ist fatal: Frauen, die von Gewalt bedroht sind, werden nicht besser geschützt, wenn man ihre Schicksale in einer neuen Kategorie sammelt. Im Gegenteil: Man beraubt sich der Möglichkeit, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Prävention funktioniert nur, wenn man die Realität anerkennt – und dazu gehört auch, die unbequeme Wahrheit über Herkunft und Kultur vieler Täter auszusprechen.
Differenzierung ist unerwünscht – zum Schaden der Opfer
Natürlich gibt es auch Schweizer Täter, auch Männer aus der Mitte der Gesellschaft, die ihre Partnerinnen verletzen oder gar töten. Das bestreitet niemand. Aber es macht eben einen Unterschied, ob Gewalt in einem individuellen Ausnahmefall geschieht oder ob sie Teil eines kulturell verankerten Musters ist. Und dieser Unterschied verschwindet, wenn man alles unter der Überschrift „Femizid“ subsumiert.
Es ist bemerkenswert, wie sehr sich Medien und Politik gegen diese Differenzierung sperren. Wer auf die Herkunft von Tätern hinweist, gilt schnell als „rechts“ oder ausländerfeindlich. Doch Schweigen schützt keine Opfer. Ehrlichkeit hingegen könnte helfen, gezielt Prävention zu betreiben, gefährdete Frauen besser zu schützen und Männer aus Risikogruppen frühzeitig zu erreichen.
Solange diese Ehrlichkeit fehlt, bleibt das Wort „Femizid“ ein leeres Schlagwort. Es erzeugt moralische Empörung, aber keine Lösungen. Es ist wie ein Pflaster, das man auf eine offene Wunde klebt, um nicht hinschauen zu müssen. Für die Betroffenen bedeutet das: viel Rhetorik, wenig Schutz.
Wenn wir eine Gesellschaft wollen, in der Frauen sicher leben können, dann führt kein Weg daran vorbei, unbequeme Fragen zu stellen. Wer sind die Täter? Warum häufen sich Gewalttaten in bestimmten Kreisen? Und wie schaffen wir es, diesen Kreislauf zu durchbrechen? Wer diese Fragen meidet, macht sich schuldig – nicht nur an der Debatte, sondern letztlich auch an den Opfern.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?


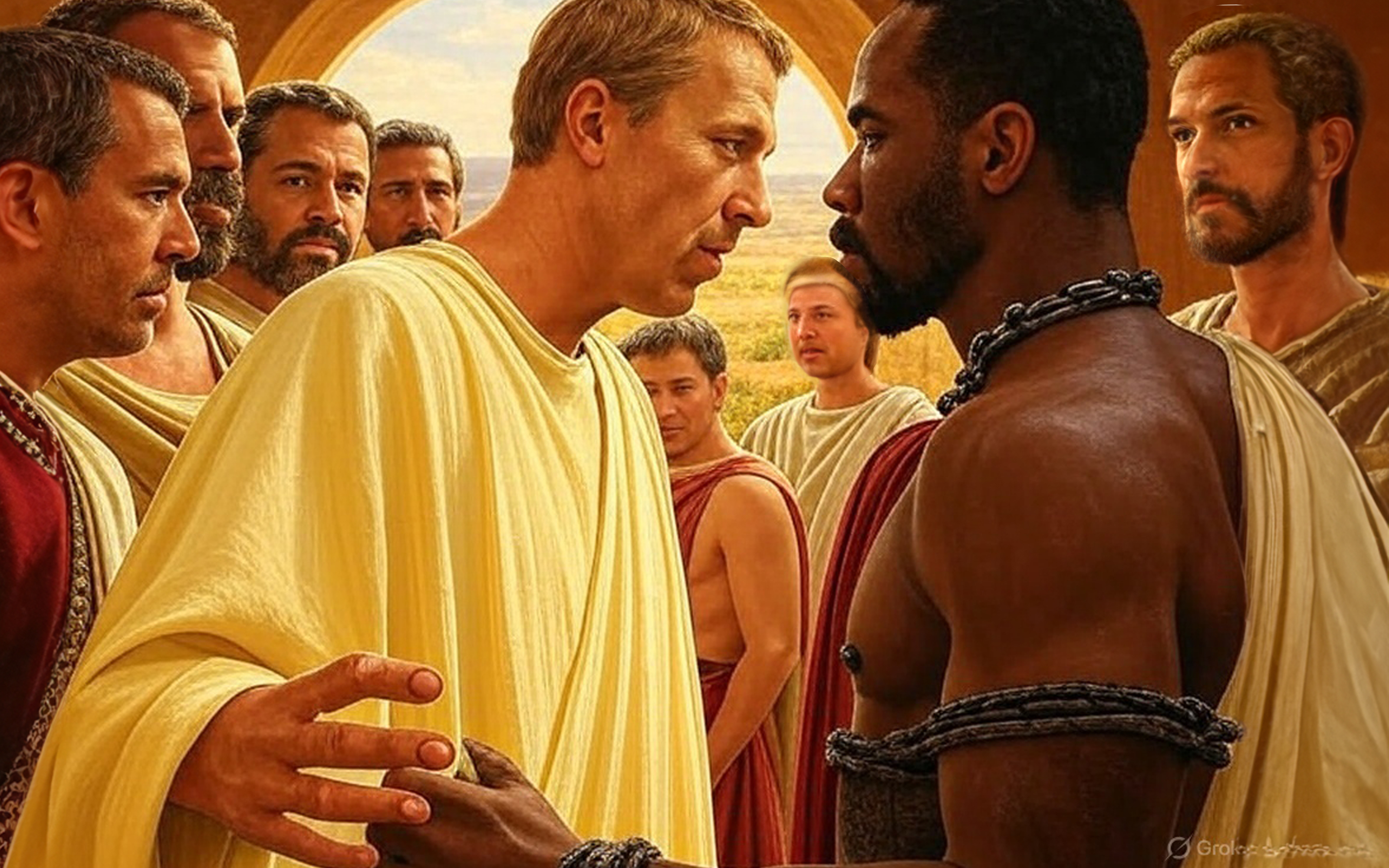


Kommentare
Wäre tatsächlich Männlichkeit an sich die Ursache von Gewalt, so könnte es doch nur eine Lösung geben: nämlich die Verweiblichung des Mannes. Hier muss man aber fragen: Kann man den Mann noch mehr verweiblichen, als dies bei uns in den letzten Jahrzehnten geschehen ist? Nicht unbegründet kann man das Gefühl bekommen, dass Frauen einen Mann heutzutage nur noch zur "Samenspende" benötigen, er wird immer mehr überflüssig.
Man kann hier aber auch argumentativ den Spieß umdrehen: Ist für die Zunahme an Gewalt nicht auch ein Mangel an Männlichkeit verantwortlich? Männlich ist es doch, beherzt dazwischenzugehen, wenn Frauen im öffentlichen Raum belästigt werden. Ein US-Amerikaner hat dies vor einigen Tagen in Dresden getan und dafür einen hohen Preis bezahlt. Statt mit Dank reagiert man hierauf lieber mit betretenem Schweigen.
Wie es der Artikel sagt, deckt der Begriff "Femizid" kein Problem auf, sondern er verschleiert es. Lässt sich der Elefant im Raum nicht mehr leugnen, wird die Realität einfach entsprechend uminterpretiert. Man muss immer aufpassen, wenn auf einmal neue hochtrabende Begriffe in den Diskurs eingeführt werden. Nicht alles gleich schlucken, sondern hinterfragen. Die Linken haben sich - mit Ankündigung - die Sprache zur Beute gemacht. Ein kritischer Geist ist mehr denn je gefragt.