„Die allermeisten Frauen, die ein krankes Kind erwarten, nehmen es in Liebe an“
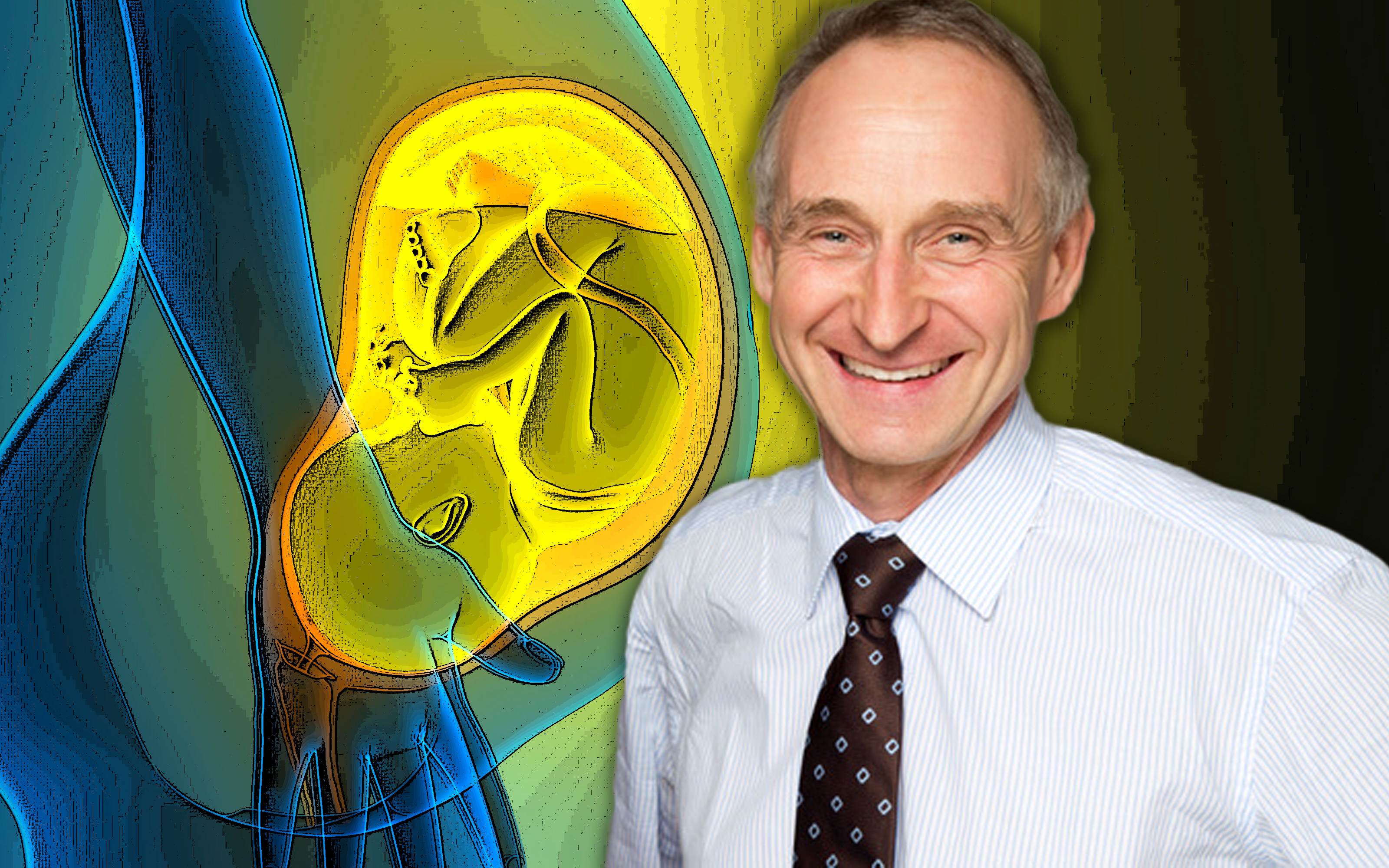
Schwangerschaft ist in den Industrienationen heute ein lückenlos überwachter Zustand, der sich zwischen Ultraschallgerät, flackernden Monitoren, Test-Kits, Kanülen und Einweghandschuhen abspielt. Der Gynäkologe Alexander Scharf-Jahns ist seit 2011 niedergelassener Pränatalmediziner. Zu ihm werden Schwangere überwiesen, deren ursprünglich gute Hoffnung durch einen auffälligen Befund getrübt wurde. Immer wieder kommt es vor, dass sich der Anfangsverdacht auf eine sehr schwere Krankheit oder Fehlbildung des ungeborenen Menschen durch die Diagnostik bestätigt. Damit verändert sich für die Schwangere die Situation grundlegend. Im Interview beleuchtet der Professor praxisnah und theoretisch die menschlichen Dramen, die am Beginn des Lebens stehen können und denen er im Beruf sowohl mit aller Fachkunde wie mit Empathie begegnet. Dabei räumt er mit verbreiteten Mythen auf, die in der oftmals mit viel Emotionen, aber wenig Wissen geführten Abtreibungsdebatte vorherrschen.
Herr Professor Scharf-Jahns, Sie sind Pränataldiagnostiker. Wie oft müssen Sie Paaren mitteilen, dass ihr Nachwuchs möglicherweise eine Fehlbildung oder eine Beeinträchtigung hat?
Wir arbeiten im Team: In der Praxis für Pränatalmedizin Mainz MVZ PraenatGyn sind vier Ärztinnen und Ärzte tätig, die sich ausschließlich auf Fragestellungen der vorgeburtlichen Medizin spezialisiert haben. Gemeinsam führen wir pro Jahr etwa 5.000 Untersuchungen durch. Ein Schwerpunkt ist dabei die frühe Fehlbildungsdiagnostik jenseits der 12. Schwangerschaftswoche. Dies mit guten Gründen: Der Zeitbereich der 11./12. Schwangerschaftswoche stellt biologisch die zeitliche Untergrenze für die Anwendung von pränatalmedizinischen Maßnahmen dar. Davor ist die Organanlage noch nicht abgeschlossen und eine systematische Ultraschallanalyse noch nicht möglich.
Durch den Umstand, dass uns als Überweisungspraxis Schwangere von den primär betreuenden Frauenärzten, bei denen sich in der Vorsorge spezielle Fragen aufgetan haben, zugewiesen werden, haben wir es mit einer nicht repräsentativen Vorauswahl zu tun, wenn ich es einmal so technisch ausdrücken darf. Bei den uns zugewiesenen Schwangeren sehen wir daher anteilig häufiger, also in circa 15 Prozent der Fälle, besondere Befunde als dies natürlicherweise der Fall ist, wo sie nur zu etwa vier Prozent vorkommen.
Im seltenen, aber in einer Pränatalpraxis doch regelmäßig auftretenden Fall, dass der Fetus als von einer schweren Erkrankung betroffen diagnostiziert wird – bei 15 Prozent erkrankten Feten sind ein Siebtel, also insgesamt ungefähr zwei Prozent, schwer krank –, kommt es psychodynamisch dann in der Verarbeitung dieser Situation meistens erst einmal zu einer schweren depressiven Reaktion: Die Schwangere muss leidvoll Abschied nehmen vom Idealbild eines perfekten Kindes und einer damit verbundenen Zukunftsaussicht. Dies wird ihr schicksalhaft und schmerzvoll von außen auferlegt. Damit ist der Aspekt der psychologischen Verarbeitung ihrer Situation hier zentral.
Wie geht man als Arzt mit der Situation um, wenn es den Verdacht auf eine mögliche Erkrankung des ungeborenen Babys gibt?
Möglichst erfahren und umsichtig. Der zeitnahe Ausschluss von Erkrankungen des Fötus ist immer die Pflicht. Die Kür dagegen besteht in der professionellen umfassenden Betreuung der Schwangeren, bei deren Kindern wir im Mutterleib ein gesundheitliches Problem feststellen mussten. Viele weitere Untersuchungen machen wir im Hause. Dazu gehören pro Jahr zwischen 200 und 250 Punktionen (Fruchtwasser, Chorionzottenbiopsien). Wenn es sinnvoll und erforderlich ist, vermitteln wir die Schwangeren über unser berufliches Netzwerk weiter an medizinische Spezialeinrichtungen, die eine zu der jeweiligen Gegebenheit passende weiterführende Diagnostik und Therapie anbieten.
„Solche Betreuung ist nie Routine, sondern immer komplex und individuell“
Derartige Betreuungen sind, lassen Sie mich das sagen, auch für uns in der Spezialisierung nie Routine, sondern immer medizinisch wie psychologisch gleichermaßen komplex und individuell.
Eine Fehlbildung des Fötus wird individuell ganz unterschiedlich von der einzelnen hiervon betroffenen Schwangeren aufgenommen, verarbeitet und bewältigt. Hier betrachten wir es als unsere Pflicht, der Schwangeren auf dem Weg, der dann vor ihr liegt, unterstützend und ergebnisoffen-nondirektiv zur Seite zu stehen und ihr möglichst niedrigschwellig in einem professionellen Netzwerk informationell, aber auch pragmatisch alle Wege zu ebnen und Türen zu öffnen.
Damit ist der erkennbar erkrankte Fetus aus einer biologischen und medizinischen Sicht kein Anhängsel der Mutter, sondern ein eigener Mensch in der seinem Lebensalter zukommenden spezifischen Lebensform. Dies sollte bei dem schwierigen weiteren Entscheidungsfindungsprozess entsprechend immer mitberücksichtigt werden.
Wie sprechen Sie mit Eltern über mögliche Risiken, Mängel und Folgen medizinischer Tests?
Vor der Beantwortung dieser Frage ist es erforderlich, sich zunächst den fundamentalen Unterschied klarzumachen zwischen einem medizinischen Test und einer medizinischen Diagnose.
Ein Test ist keine Diagnose, und der falsche Alarm bringt Verunsicherung
Tests prüfen körperliche Merkmale, zum Beispiel Blutwerte, und vergleichen diese mit Referenzwerten von Gesunden oder Kranken. Mit anderen Worten: Ein medizinischer Test stellt eine Frage an die Natur. Er liefert Wahrscheinlichkeiten, keine Gewissheit. Tests sind Bausteine der Diagnosefindung, rechtfertigen aber keine direkten therapeutischen Maßnahmen, etwa in der Pränatalmedizin unter Umständen einen Schwangerschaftsabbruch. Diagnosen hingegen synthetisieren mehrere Befunde, oft mit histopathologischer oder genetischer Analyse, und bieten maximale Sicherheit für gezielte Therapien. Eine medizinische Diagnose liefert eine Antwort an den Menschen: Nur ein Diagnoseverfahren erlaubt eine klinische Handlungskonsequenz, das heißt, sie rechtfertigt es, eine zielgerichtete Therapie einzuleiten.
Und was bedeuten diese Vorab-Klärungen für die vorgeburtliche Betreuung der Schwangeren in Ihrer Praxis?
In vorgeburtlichen Betreuung nehmen medizinische Tests zunehmend mehr Raum ein. In der Pränatalmedizin haben Tests wie der sogenannte Tripletest, der ab 1990 weltweit in die klinische Routine kam, und der kombinierte NT-Test seit 2000 die Erkennung des Down-Syndroms verbessert, jedoch mit Einschränkungen: Auch wenn eine Sensitivität bis zu 95 Prozent erreicht werden kann, liegt die Falsch-Positiv-Rate weiterhin bei fünf Prozent, das heißt fünf Prozent der tatsächlich gesunden Feten werden als auffällig im Sinne von verdächtig auf Down-Syndrom eingestuft und bringen durch den falschen Alarm Verunsicherung.
Der nicht-invasive Pränataltest, der NIPT, der seit 2012 eingeführt wurde, erhöht die Sensitivität auf über 99 Prozent und löst bei kleiner als 0,1 Prozent Falsch-Positiv-Rate viel seltener falschen Alarm aus. Er bleibt aber ein Test, kein Diagnoseverfahren. Ein unauffälliger NIPT schließt das Down-Syndrom weitgehend aus, sagt jedoch nichts über andere genetische oder körperliche Auffälligkeiten aus. Fehlinterpretationen, dass ein unauffälliger NIPT einen gesunden Fetus garantiert – hier ist der Wunsch häufig Vater des Gedanken –, sowie irreführende Werbung und unzureichende Aufklärung verstärken dann Missverständnisse und Beunruhigung. In Deutschland fehlen zudem strukturell eine Kombination mit einer systematischen Ultraschalluntersuchung und ein echter medizinischer Indikationskatalog für den NIPT: Damit findet die Suche ohne Unterscheidung, ob überhaupt eine Risikokonstellation im konkreten Einzelfall vorliegt, im sogenannten Normalkollektiv aller Schwangeren statt.
„Fehldiagnosen sind extrem selten“
Über diese Aspekte vor der Testanwendung angemessen aufzuklären und bei der Ergebnismitteilung danach zu vermitteln, ist zwar eine Kernaufgabe aller Frauenärzte, sowohl in der primären Schwangerenbetreuung und noch vielmehr von Spezialisten in Pränatalpraxen wie bei uns. Aber die hierzu von den gesetzlichen Krankenkassen zugestandenen und vergüteten maximal 20 Minuten sind in Anbetracht der Komplexität der Fragestellung völlig unzureichend.
Immer wieder hört man auch von Fällen, in denen sich pränatale Befunde nicht bewahrheitet haben: Statt behinderter Kinder kamen „pumperlgesunde“ Babys auf die Welt. Haben Sie das auch schon erlebt?
Wissen Sie: nein. Ich will Ihnen auch erklären, warum. Bei einer sorgfältigen Kombination aus Ultraschall und genetischen Tests ist die pränatale Diagnostik sehr genau und gesunde Kinder werden zuverlässig als solche erkannt. Fehler passieren meist, wenn nach einem auffälligen Test (wie NT-Test oder NIPT) keine weiterführende Diagnostik erfolgt, was bei 5 bzw. 0,1 Prozent der Fälle vorkommt. Leider ist die irrige Annahme weitverbreitet, dass ein Test schon eine Diagnose bedeutet – aber das ist wie erwähnt nicht so.
Wenn jedoch alle Schritte konsequent durchgeführt werden, sind Fehldiagnosen extrem selten, außer bei schlechten Untersuchungsbedingungen, was offen mit der Schwangeren besprochen werden muss – sie hat ein Anrecht darauf zu wissen, wie präzise die bei ihrem Kind erfolgte Diagnostik war. Die Diagnostik ist ein freiwilliges Angebot und nicht immer vollumfänglich, weshalb die Trefferquote für kranke Feten je nach Umfang variieren kann. Falsche Zuweisungen eines gesunden Kindes als krank sind bei korrekter Durchführung jedoch nahezu ausgeschlossen, sofern keine groben methodischen Fehler passieren: Wenn Sie die Proben im Labor vertauschen, haben Sie natürlich ein Problem ...
Auf der Internetseite Ihrer Praxis sprechen Sie Schwangere mit den folgenden Worten direkt an: „Sie und Ihr ungeborenes Kind sind für uns immer etwas Besonderes. Jede Schwangere und ihr ungeborenes Kind erhalten die Aufmerksamkeit und Zuwendung, welche sie mit ihrer individuellen Fragestellung benötigen.“ Ist diese im besten Sinne des Wortes „inklusive“ Sprache bewusst so gewählt – und wie nehmen betroffene Frauen diese Art des Umgangs auf?
Eine Schwangerschaft bedeutet immer eine zeitlich begrenzte, natürliche Symbiose zweier ontologisch unterschiedlicher Menschen unterschiedlichen biologischen Alters. Die Schwangere, mit der wir als Ärzte direkt sprechen, ist meist zwischen 15 und 45 Jahre alt und der Fetus, dem wir in der Pränatalmedizin begegnen und dessen körperliche und genetische Zeichen wir „lesen“ und in eine für die Schwangere verständliche Sprache übersetzen, 12 bis 36 Wochen alt. Beide, Schwangere und Fetus sind biologisch klar und eindeutig Varianten unterschiedlichen Alters ein und derselben Spezies: des Menschen, Homo sapiens, der sich ab seiner Zeugung kontinuierlich bis zum Tage seines Todes fortentwickelt.
Ungewöhnlich, nicht alltäglich, es so aufzufassen, nicht wahr?
Ja, freilich. Noch etwas Interessantes: Die Ultraschalluntersuchung, verstanden als Kulturtechnologie, ist ein Instrument der Erkenntnisgewinnung jüngsten Datums. Sie wird ja erst seit rund 30 Jahren, ich sagte das eben schon, in dieser Form routinemäßig angewendet. Damit ist diese Technologie immer noch revolutionär: Bis in die späten 1980er Jahre hinein war die Schwangerschaft, von den unsicheren Anzeichen – die Periode bleibt aus, die Beckenorgane werden verstärkt durchblutet – und sicheren klinischen Schwangerschaftszeichen, also dem Verspüren der Kindsbewegungen ab etwa der 20. Schwangerschaftswoche abgesehen, eine „Black Box“: Erst nach der Geburt konnte eine Information eingeholt werden zum Gesundheitszustand des neuen Lebens, zum Sein an sich.
„Durch den Ultraschall schauen wir in den Maschinenraum der Schöpfung“
Indem wir vorgeburtlichen Ultraschall anwenden, überwinden wir praktisch, aber auch symbolisch eine früher für uns Menschen absolute, unüberwindliche Hürde: Wir werden beim Ultraschall der menschlichen Entwicklung in ihrer Frühphase, in der Gebärmutter, bildlich gesprochen im Maschinenraum der Schöpfung ansichtig und so zu Zeugen dieses stets aufs Neue einmaligen, in der letzten Konsequenz nicht ergründbaren, auch metaphysischen Geschehens.
Zur Person Prof. Dr. med. Alexander Scharf-Jahns
Professor Dr. med. Alexander Scharf-Jahns ist seit 2022 Geschäftsführer des MVZ PraenatGyn GmbH in Mainz. Mit fast 40 Jahren Berufserfahrung in der Frauenheilkunde und 30 Jahren in der Pränatalmedizin zählt er zu den führenden deutschen Experten seines Fachs. Nach seinem Medizinstudium an der Universität des Saarlandes (1980-1987) promovierte er 1991 und habilitierte 2005 an der Medizinischen Hochschule Hannover. 2008 erhielt er eine außerplanmäßige Professur an der Universität Heidelberg. Zusätzlich absolvierte er berufsbegleitende Studiengänge zum Medical Hospital Manager (2006-2007) und zum MBA (2007-2008).
Seine Laufbahn umfasst Stationen als den Universitäts-Frauenkliniken in Frankfurt, Hannover und Heidelberg. Seit 2011 ist er niedergelassener Facharzt für Pränatalmedizin, zuerst in Darmstadt, später in Mainz.
Dr. Scharf-Jahns verfügt über zahlreiche Fachkunden, unter anderem in spezieller operativer Gynäkologie, Perinatalmedizin und Ultraschalldiagnostik (DEGUM II). Er ist Mitglied in Fachgremien wie der DEGUM und war Vorsitzender des Berufsverbands Niedergelassener Pränatalmediziner (2015-2020). Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Versorgungsforschung, pränatalen Neurowissenschaften, fetales Bewusstsein und Philosophie des Geistes. Mehrfach wurde er für seine wissenschaftlichen Beiträge ausgezeichnet, so mit dem ASCO Merit Award (2004).
Alexander Scharf-Jahns wurde 1962 in Mannheim geboren.
Damit ist uns ein Privileg gegeben, aber auch eine Verantwortung, die weit hinausgeht über die situativen Gegebenheiten einer konkreten pränatalen Ultraschalluntersuchung: Es sind dies die Ehrfurcht und Achtung vor den Menschen, denen wir in der Ordination gegenübersitzen. Zu ihnen gehören immer mindestens zwei: Die Mutter, direkt und unvermittelt, gegebenenfalls mit anwesendem Partner oder Angehörigen, und das in der Gebärmutter befindliche Kind, durch die Bauch- und Gebärmutterwand getrennt und geschützt, aber ontologisch nicht weniger vorhanden als die Mutter; ein Mensch, der vermittelst der Ultraschalltechnologie im Zentrum unserer ärztlich-diagnostischen Aufmerksamkeit steht und von welchem wir der Mutter berichten.
Die Pränataldiagnostik warf von Anfang an ethische Fragen auf. Mittels des angesprochenen NIPT ist es heute leicht geworden, einen Verdacht auf genetisch bedingte Krankheiten des Kindes festzustellen. Von einem solchen Verdacht zu einer Abtreibung ist es dann nicht mehr weit: Schätzungsweise werden 85 bis 90 Prozent aller Föten mit Trisomie 21 abgetrieben. In Dänemark, einem der ersten Länder, in denen der NIPT für alle Schwangeren eingeführt worden war, liegt der Wert sogar bei 95 Prozent. Hat diese technologische Neuerung mehr Nach- als Vorteile gebracht?
Ob die NIPT-Einführung mehr Vor- oder Nachteile in die praktische pränatale Medizin gebracht hat, ist eine wichtige Frage, die zunächst nicht pauschal mit einem Ja oder Nein beantwortet werden kann. Wichtige Aspekte sind dabei die Frage, wie NIPT in einem staatlichen Gesundheitssystem implementiert ist und wie ein auffälliges NIPT-Ergebnis von der Schwangeren und den sie beratenden Ärzten interpretiert wird – wir sprachen just davon.
Wenn eine Schwangere ein „auffälliges“ Testergebnis schon als Beweis auffasst
Wissen Sie: Ein grundsätzliches Problem im Hinblick auf die Beantwortung Ihrer Frage ist doch der Umstand, dass NIPT von vielen Anbietern bereits ab der 10. Schwangerschaftswoche angeboten wird! Unterstellt man eine Bearbeitungszeit von fünf bis sieben Werktagen, so liegt das Ergebnis frühestens bereits um die 11. SSW, das heißt noch ein gutes Stück vor der gesetzlichen Grenze für die Fristenregelung vor. Bei einem falsch-auffälligen NIPT-Befund, der – und das ist wichtig – erst nach Durchführung einer diagnostischen Punktion der richtig-auffälligen Testbefunde abgegrenzt werden kann, ist es durchaus denkbar, dass eine Schwangere – selbst bei korrekter Befundinterpretation und Beratung durch den Frauenarzt – das lediglich „auffällige“ Testergebnis dennoch als diagnostisch, also als „beweisend“ interpretiert und dann auf Basis der Bestimmungen des Paragrafen 218a Absatz 1, also der Fristenregelung, der Beratungsregelung, einen Abbruch an einem tatsächlich genetisch gesunden Fetus vornehmen lässt. Wie häufig dies in der Realität vorkommt, ist freilich nicht bekannt.

Für die Antwort nun auf Ihre Frage nach der generellen Bereitschaft, Kinder mit einer vorgeburtlich gesicherten Trisomie 21 auszutragen, können wir Erhebungen zwischen 1995 und 2020 heranziehen. Demnach schwankt die Bereitschaft international stark und hängt unter anderem vom Land beziehungsweise der Region, den Beratungsstandards und auch der Rechtslage ab. Für Deutschland gibt es hierzu keine verlässlichen Zahlen. In Nordeuropa, wenn wir auf zum Beispiel Dänemark oder Großbritannien sehen, finden sich mit um die zehn Prozent sehr niedrige Austragungsraten. Nach den verfügbaren Daten weisen die USA dagegen mittlere Austragungsraten von 33 Prozent auf.
Auch für die Frage, ob diese Raten durch die Einführung von NIPT ab 2012 – in Deutschland ist der Test seit 2022 eine GKV-Leistung – erkennbar modifiziert wurden, ist die Datenlage nicht robust und für die einzelnen untersuchten Länder uneinheitlich. Die Einführung von NIPT hat vor allem die Prozesse verändert: Man macht frühere und häufigere pränatale Erkennung und deutlich weniger invasive Diagnostik. Die beste Gesamt-Evidenz spricht eher für unveränderte oder leicht niedrigere Abbruchraten im Vergleich zur Vor-NIPT-Zeit; zugleich steigt die Anzahl pränatal erkannter Fälle. Für Deutschland fehlen bislang belastbare bundesweite Daten.
Sie sagten, dass seit 2022 solche Tests eine Kassenleistung sind. Hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
Ja, fundamental. Die Aufnahme des NIPT, also des nicht-invasiven Pränataltests, als Kassenleistung seit dem 1. Juli 2022 hat die Arbeit in der Praxis grundlegend verändert. NIPT hat den bis dahin genutzten NT-Test nahezu vollständig verdrängt, da das Verfahren präzisere Ergebnisse bei geringerer Falsch-Positiv-Rate liefert, kostenlos für Schwangere ist und als qualitativ hochwertig wahrgenommen wird. Dies führte in den Folgejahren dazu, dass mittlerweile mehr als 80 Prozent aller Schwangeren in Deutschland NIPT als Kassenleistung in Anspruch nehmen. Bei jährlich 700.000 ausgetragenen Schwangerschaften bedeutet dies mehr als 550.000 NIPT-Untersuchungen pro Jahr. Damit ist der NIPT zu einem flächendeckenden Screening, zu einer Reihenuntersuchung geworden, entgegen der ursprünglichen Absicht, dieses genetische Testkonzept nur in Einzelfällen einzusetzen.
„Der Test wird oftmals nur genutzt, um das Geschlecht zu erfahren“
Das Ziel indessen, diagnostische Punktionen und damit verbundene Fehlgeburten zu reduzieren, wurde jedoch nur ganz begrenzt erreicht: Die Punktionszahlen sind um weniger als 20 Prozent gesunken, nämlich von 10.000 auf 8.000 jährlich, wobei wir nicht wissen, ob dies allein auf NIPT zurückzuführen ist.
Zudem nutzen, das wissen wir aus Motivationsanalysen der Inanspruchnahme, bis zur Hälfte der Schwangeren den NIPT – sie müssen dann 20 Euro zuzahlen –, um das Geschlecht des Fetus zu erfahren: ein konsumptiver Fehlanreiz.
Ein weiterer ordnungspolitischer Mangel bei der NIPT-Einführung kommt noch hinzu: die fehlende Koppelung des Verfahrens an eine systematische Ultraschalluntersuchung. Bereits seit der Einführung von NIPT im Jahre 2012, damals zunächst als kostenpflichtige iGeL-Leistung, nimmt die Anzahl der Spätabbrüche jenseits der 24. Schwangerschaftswoche um den Faktor 3, 4 zu. In unserer Spezialpraxis raten wir daher dringend zu einer begleitenden systematischen Ultraschalluntersuchung, um die medizinische Aussagekraft der NIPT-Ergebnisse zu erhöhen.
Als Pränataldiagnostiker haben Sie es mit vorgeburtlichem Leben zu tun. Wann beginnt menschliches Leben für Sie? Gibt es objektive Kriterien dafür, wann menschliches Leben beginnt? Kann man das objektiv bestimmen?
Tatsächlich gibt es objektive ontologische Kriterien dafür, wann menschliches Leben beginnt. Auch sind sie objektiv bestimmbar. Es sind dies die drei primären Seinskategorien „Mensch als spezifische biologische Lebensform“ = ontologische Kardinalkategorie 1, „Individualität des Seins – Mensch als Individuum“ = ontologische Kardinalkategorie 2 und „Zeitlichkeit – Endlichkeit des menschlichen Lebens“ = ontologische Kardinalkategorie 3. Sie werden im Menschenwürdeaxiom des Artikels 1, Satz 1 des Grundgesetzes normativ gespiegelt und sind insoweit unverrückbar. Diese drei Kriterien sind ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung des Vorkerns von Samenzelle und Eizelle zur Zygote erfüllt.
Abtreibungsärzte argumentieren, dass bei Spätabtreibungen in den allermeisten Fällen keine gesunden Kinder abgetrieben werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass unsere Gesellschaft Selektion betreibt. Sind Kinder mit Beeinträchtigungen wirklich weniger wert?
Ich muss hier die Frage hinterfragen. Wir müssen hier klar differenzieren, denn der Begriff der Selektion ist stark emotionalisierend und wertbeladen: Er muss sauber definiert und kontextualisiert werden, um Missverständnisse zu vermeiden.
„Ja, ich kenne den Einwand, dass selektiert werde“
Aus pränatalmedizinischer Sicht will ich Ihnen aber wie folgt antworten: Ja, natürlich kenne ich den häufig erhobenen ethischen Einwand, es würde im Kontext der medizinischen Indikation zum Schwangerschaftsabbruch Selektion betrieben. Doch dieser Einwand verfängt nicht, da hier primär die Schwangere entscheidet und nicht eine dritte Person oder Institution: Ähnlich wie bei der Fristenregelung handelt es sich in der Bewertung der gegebenen Situation für eine Schwangere, mit einer schweren kindlichen Erkrankung im Mutterleib konfrontiert worden zu sein, zunächst und direkt um einen intrapsychischen, privaten, höchstpersönlichen und nur in Teilen rational steuerbaren Verarbeitungsprozess. Die ärztliche Indikationsstellung reflektiert und dokumentiert dabei dieses Geschehen und bewertet medizinisch die Bedeutung – Sie können auch sagen, die Dimension – dieser Verarbeitung für die absehbare weitere mütterliche Gesundheit.
Also, formallogisch trifft der Begriff „Selektion“ nicht zu, weil die juristische und damit gesellschaftliche Bewertung der Zulässigkeit eines Abbruches nicht spezifische, den fetalen Organismus beschreibende Gesundheits-Merkmale betrachtet, sondern primär auf deren individuelle und im Einzelfall sehr variable psychologische Verarbeitung durch die Mutter abstellt. Damit sind fetale Fehlbildungen nur mittelbarer Auslöser für einen Abbruch. Ist das verständlich?
Ja, wenngleich die Argumentation schon reichlich sophistisch wirkt.
Natürlich ist die Faktizität in den meisten Fällen eine andere: Die Feststellung der schweren kindlichen Erkrankung führt zum Abbruch der Schwangerschaft. Insoweit könnte hier der Vorwurf der Selektion erhoben werden. Er richtet sich aber dann an die Schwangere selbst und nicht an die Gesellschaft oder die Ärzteschaft pauschal, da das optionale Weigerungsrecht für diese ihre Bereitschaft, die Schwangere in ihrem Abbruchsbegehren zu unterstützen oder nicht, zu einer persönlichen Einzelfallentscheidung macht, welche sie vor dem Hintergrund ihrer persönlichen ethischen Normen zu treffen haben.
„Sind Kinder mit Beeinträchtigungen weniger wert? Ganz klar nein“
Die Frage, ob Kinder mit Beeinträchtigungen wirklich weniger wert sind oder nicht, ist demgegenüber schnell abgehandelt und klar zu beantworten: ganz klar nein. Weder rechtlich noch real. Dies spiegelt sich darin wider, dass die weit überwiegende Mehrzahl der Schwangeren, 85 Prozent, die von einer Erkrankung ihres Kindes im Mutterleib erfahren, die Schwangerschaft austragen und das Kind in seiner besonderen gesundheitlichen Verfasstheit in Liebe annehmen.
In Deutschland sind Abtreibungen nach einer medizinischen Indikation während der gesamten Schwangerschaft straffrei möglich. Im entsprechenden Paragrafen heißt es, dies gelte, „wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann“. Werden Schwangeren zu wenig Alternativen für eine Abtreibung aufgezeigt?
Aus meinem Verständnis nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit in der Pränatalmedizin heraus würde ich diese Frage zunächst mit einem klaren Nein beantworten.
Die Psychodynamik im Entscheidungsfindungsprozess einer mit einem kranken Kind konfrontierten Schwangeren ist die, dass die Schwangere dieses Kind zunächst unter der in den allermeisten Fällen, nämlich in 96 Prozent, zutreffenden Grundannahme, ein gesundes Kind zu tragen, in Liebe angenommen hat: Es besteht insoweit bereits ab der grundsätzlichen Annahme der Schwangerschaft, im Schwerpunkt zwischen der 5. bis 7. SSW, eine stabile komplexe emotionale Beziehung der Mutter zum Kind.
„Über diesem schmerzhaften Prozess geht nicht die Liebe zum Kind verloren“
Wenn nun die Schwangere die Nachricht ereilt, dass das Kind schwer krank ist, bedeutet dies in einer psychologischen Betrachtung zunächst die Zerstörung, den Zusammenbruch des idealisierten Bildes vom Kind und eines avisierten generellen Lebenskonzeptes. Die Loslösung von diesem Ideal in der Sache – das Kind ist tatsächlich krank – und ihrer symbolischen Bedeutung – mein Leben als Mutter wird gänzlich anders verlaufen – ist immer ein extrem verletzender und schmerzhafter Prozess. Über ihm geht jedoch nicht die Liebe zum Kind verloren und damit verbunden die an sich unverbrüchliche Bereitschaft, das Kind anzunehmen, so wie es ist.
Erst wenn in einem weiteren Verarbeitungsschritt die Schwangere für sich zu der Erkenntnis gekommen ist, dass die Erkrankung für das Kind und sie selbst nicht zumutbar ist, kann sie sich von ihm lösen. Dieser Prozess ist hochkomplex und extrem individuell. In seinem Verlauf werden üblicherweise alle Facetten dessen, was das Leben mit einem Kind mit der konkret vorliegenden Erkrankung bedeutet, als Informationsangebot an die Schwangere herangetragen.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Dies umfasst insbesondere die Kontaktherstellung mit betroffenen Familien, in welchen Kinder mit vergleichbarer Erkrankung aufwachsen und die intensive medizinische Beratung der Schwangeren und ihres Partners durch spezialisierte Kinderärzte, die nachgeburtlich entsprechende Kinder medizinisch versorgen und begleiten.
Insoweit scheint mir hier direkt kein substanzielles Handlungspotenzial gegeben zu sein, wodurch es möglich wäre, an dieser Stelle die Abbruchszahlen zu mindern.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die palliative Begleitung des Sterbens in Hospizen etwas etabliert – es lindert Leiden mehr, als das im Krankenhausbetrieb möglich wäre und bewahrt die Würde da, wo therapeutisch nichts mehr zu machen ist. Gibt es denn auch ein palliatives Umsorgen am Lebensbeginn, so etwas wie palliative Geburten?
Sie sprechen da etwas Wichtiges an: Die palliative Geburt bietet eine Alternative zum Schwangerschaftsabbruch oder ineffektiver Intensivtherapie bei schweren, lebenslimitierenden Fetaldiagnosen. Denken Sie zum Beispiel an Anenzephalien, an Fälle von Trisomie 13/18 mit schweren Organfehlbildungen, an letale Skelettdysplasien oder komplexe Mehrfachanomalien ohne Aussicht auf Heilung für den kleinen Menschen. Ziel ist es, Leiden zu vermeiden und dem Kind sowie seinen Eltern Zeit, Nähe und Würde zu ermöglichen – vor, während und nach der Geburt –, indem man auf unverhältnismäßige, disproportionale lebenserhaltende Maßnahmen verzichtet. Die medizinischen und ethischen Grundprinzipen umfassen dabei das Wohl des Kindes, Komfort vor Lebensverlängerung um jeden Preis, gemeinsame Entscheidungsfindung und Symptomlinderung ohne aktive Lebensverkürzung.
Sie sehen: Dieses Konzept unterscheidet sich vom Schwangerschaftsabbruch, der Maximaltherapie oder auch einem Therapieabbruch und fördert die Elternzufriedenheit, eine bessere Trauerverarbeitung und klarere Behandlungspfade, auch weniger hektische Notfallentscheidungen für uns als medizinisches Personal. Es ist so, dass die Palliative Geburt selten an der Idee scheitert. Dennoch wird dieser Weg wegen der weitaus komplexeren praktischen Umsetzung bisher eher zögerlich von Ärzten und Schwangeren beschritten, trotz des Nutzens.
Birgt die Prozedur einer Spätabtreibung, die eine Schwangere beispielsweise in der 26. Schwangerschaftswoche über sich ergehen lässt, nicht ebenfalls eine große Gefahr, als traumatisch erlebtes Geschehen das Seelenleben dauerhaft zu belasten?
Jede Form eines medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbruchs stellt aus den zuvor schon dargestellten psychologischen Gründen ein schweres psychologisches Trauma und eine biografische Zäsur dar. Es gibt Hinweise dafür, dass ein medizinisch indizierter Abbruch – wir sprechen hier von einem TOPFA, das kommt von „Termination of Pregnancy for Fetal Anomaly/Abnormality“ –, mit zunehmendem Schwangerschaftsalter im Durchschnitt psychisch belastender erlebt wird; aber der Effekt ist ziemlich heterogen und wird von anderen Faktoren wiederum teils stärker geprägt. Zu denken wäre da an vorbestehende psychische Belastungen, an Unterstützung durch den Partner oder das soziale Umfeld, aber auch an Entscheidungs- und Zeitdruck, an mögliche Stigmatisierungen sowie an Nachsorge oder deren Fehlen und überhaupt an die Versorgungsqualität.
Die Pränatalmedizin macht stetig Fortschritte. Immer wieder hört man von Operationen, bei denen Ungeborene erfolgreich außerhalb des Mutterleibs behandelt werden und die Schwangerschaft danach normal fortgesetzt werden kann. Werden Möglichkeiten wie diese Ihrer Einschätzung nach hierzulande angemessen berücksichtigt – bei Pränatalmedizinern, in der Beratung von Schwangeren mit auffälligem Befund, oder auch bei Gynäkologen, die es gewohnt sind, vielleicht vorschnell Abtreibungen vorzunehmen?
Hier zunächst noch einmal der Rahmen, von dem wir sprechen: Pro Jahr werden in Deutschland laut Hochrechnungen etwa 900.000 bis eine Million Frauen schwanger. Bis zur 12. Woche gehen 15 bis 20 Prozent der als solche durch das Ausbleiben der Periode und einen positiven Schwangerschaftstest nachgewiesenen und sodann im Frühestultraschall ab der 5. Schwangerschaftswoche als solche bestätigten Schwangerschaften als Ausdruck eines natürlichen embryonalen Selektionsprozesses wieder ab: Es finden sich in dieser Gruppe gehäuft Chromosomenanomalien und komplexe embryonale Anlagestörungen als Ursache für diesen abortiven Verlauf.
„Aborte jenseits der 12. Woche sind ein sehr seltenes Ereignis“
Von den verbleibenden circa 800.000 Schwangerschaften werden etwa 100.000, mithin 12,5 Prozent, auf Basis der Fristenregelung bis zur 12. Schwangerschaftswoche nach Empfängnis abgebrochen.
Hat ein Fetus die 12. Schwangerschaftswoche lebend erreicht, ist seine weitere Prognose an sich günstig: Aborte jenseits der 12. Schwangerschaftswoche sind ein sehr seltenes Ereignis. Mütterliche Schwangerschaftskomplikationen treten mehrheitlich im dritten Schwangerschaftsdrittel zwischen 28. und 40. Schwangerschaftswoche auf, aber infolge der hohen Leistungsfähigkeit der neugeburtlichen Intensivmedizin kann man das Kind in aller Regel retten.

Von den verbleibenden 700.000 Schwangerschaften jenseits dieser Zeit, die natürlicherweise dann zur Geburt geführt werden, sind vier Prozent, mithin jährlich 25.000 bis 28.000 Schwangerschaften, von einem besonderen kindlichen Gesundheitszustand betroffen – seien es körperliche Fehlbildungen, seien es genetische Erkrankungen. Sechs Siebtel dieser so diagnostizierten Kinder, das sind etwa 21.000 bis 24.000 Schwangerschaften, werden ausgetragen. In dem verbleibenden ein Siebtel der Fälle, dies entspricht knapp 4.000 Fällen pro Jahr, bei welchen eine erkennbar schwere und prognostisch ungünstige Form einer schon vorgeburtlichen Fehlentwicklung vorliegt, wird die Schwangerschaft basierend auf einer medizinischen Indikation mehrheitlich im Zeitfenster zwischen 12. und 22. Schwangerschaftswoche abgebrochen. Ja, so ist die Realität.
Der Abbruch stellt für die Schwangere selbst als Handlungsoption in aller Regel die ultima ratio dar, bei der sie sich nicht gegen das Leben des Kindes als solches stellt, sondern dagegen, dass das Kind erkennbar einen Schicksalsweg auferlegt bekommen hat, den sie für das Kind als nicht tragbar beziehungsweise würdig erachtet. Es mag paradox klingen, doch auch in dieser extremen Konfliktsituation steht für die Schwangere das Kindswohl immer noch an vorderster Stelle.
Genauso wie die Schwangere wird der Pränatalmediziner alles daransetzen, der Schwangeren über die Darstellung auch der therapeutischen Möglichkeiten in der Gebärmutter eine Handlungsoption aufzuzeigen, mit der sie sich fähig sieht, die Schwangerschaft fortzuführen: Tatsächlich kämpfen engagierte Pränatalmediziner hier um jedes einzelne Kind. Da der primärversorgende Gynäkologe erkrankte Kinder immer an pränatalmedizinische Spezialisten weiterverweist, ist Sorge dafür getragen, dass hier keine unsachliche oder sonst wie unangemessene Beratung der Schwangeren erfolgt. Generell ist übrigens die Kenntnis um die Grundprinzipien der differenzierten pränatalmedizinischen Optionen bei primärversorgenden Gynäkologinnen und Gynäkologen groß und das Niveau der Kooperation zwischen Primärversorger und Pränatalzentrum hoch.
„Die Pränatalmedizin ist grundsätzlich dem Leben verpflichtet“
Überdies ist die Gefahr vorschnell durchgeführter Abbrüche, und das ist vielleicht gerade für Sie und Ihr Magazin interessant, auch deswegen nicht gegeben, weil Abbrüche jenseits der 13. SSW nicht mehr einzeitig, das heißt in einer medizinischen Prozedur, auf ambulanter Basis durchgeführt werden können, sondern in hierauf spezialisierten geburtshilflichen Kliniken, welche strukturell-apparativ und prozedural-personell die hierfür notwendige Expertise vorweisen. Insoweit ist es schwerlich vorstellbar, dass die Möglichkeiten einer pränatalen Therapie hierzulande nicht angemessen berücksichtigt werden könnten, um Ihre Frage schlussendlich zu beantworten.
Also gibt es Ihrer Einschätzung nach genug umfassende Begleitung von Paaren, die einen pränatalen Befund bekommen oder die sich für ein Leben mit ihrem Kind entscheiden, auch wenn es mit Behinderung zur Welt kommt? Oder kommt es doch öfter als nötig vor, dass Schwangere sich gegen eine Fortsetzung der Schwangerschaft entscheiden, weil sie hilflos und überfordert sind?
Nein, denn sofern in den Betreuungspfad eine Spezialeinrichtung für Pränatalmedizin mit eingebunden ist, besteht hierfür keine Gefahr. Weil die Pränatalmedizin und die in ihr arbeitenden Ärzte qua hippokratischen Eid und Genfer Gelöbnis grundsätzlich dem Erhalt des Lebens und der Minderung von Leid verpflichtet sind. Sie werden in einer gegebenen Situation bereits aus einem intrinsischen ärztlichen Ethos alle Optionen besprechen und anbieten, um dem Kind und damit auch der Mutter zu helfen.
Zentral ist in einer Pränatalpraxis immer die obligate Miteinbindung von spezialisierten, engagierten Sozialarbeiterinnen, die sich innerhalb ihrer beruflichen Ausbildung auf die psychosoziale Begleitung von Eltern mit vorgeburtlich erkrankten Kindern spezialisiert haben. Als Spezialistinnen liegt ja ihre Kernkompetenz darin, der Schwangeren und ihrem Partner psychologische Instrumente an die Hand zu geben, dass diese wiederum durch die unvorhergesehene Situation nicht völlig aus der Bahn geworfen werden, sondern ihre Entscheidungs- und Handlungskompetenz bewahren.
Hier gelangen Sie zu Teil 2 des großen Interviews mit Alexander Scharf-Jahns.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?






Kommentare
Diese und weitere Passagen dieses sehr lehrreichen Interviews finde ich geardezu motivierend im Kampf für die Kultur des Lebens!
Spannend zu wissen wäre die Information gewesen, wie häufig und in welchen Fällen die Pränataldignostik eine Handlungsoption jenseits des Schwangerschaftsabbruchs ermöglicht - und welche!?
Oder anders gefragt: Gibt es für gläubige Katholiken, die erst gar nicht in die verflixte Entscheidungssituation kommen wollen, über das Leben z.B. ihres ungeborenen "Mongolchens" entscheiden zu müssen, eine echte Alternative zur Ablehnung der Pränataldiagnostik und zur Wahl des "rationalen Nicht-Wissens"?
Sorry, da der an sich sehr informative und differenzierte Artikel in diesem Punkt dünn bleibt, ist er für mich letztlich wertlos! Die alles entscheidende Frage, wie gehe ich als Katholik mit der Pränataldiagnostik um, welche Varianten können mir (katholisch-)ethisch akzeptable Handlungsoptionen eröffnen, welche nicht, beantwortet der Artikel nicht ... 😢
@Ambrosius Sehr geehrte/r Ambrosius,
vielen Dank für Ihren Kommentar. Das Interview ist durch den differenzierten Fragenkatalog bereits recht umfangreich geworden, so dass sich hier, so wie ich es verstanden habe, redaktionell die Notwendigkeit einer gewissen thematischen Bescheidung und insoweit auch Beschränkung ergab. Natürlich hätte man noch eine Fülle weiterer, wichtiger Punkte besprechen können und vielleicht auch müssen. Erlauben Sie mir daher im Nachgang, auf Ihre Frage aus meiner pränatalmedizinischen Perspektive zu antworten:
Die Schwangerenvorsorge in der GKV basiert auf § 25 SGB V und wird durch die Mutterschafts-Richtlinien des G-BA konkretisiert. Sie hat den doppelten Schutzauftrag für Mutter und Kind (Schutz der Schwangeren: Gesundheitserhaltung, Erkennung und Behandlung mütterlicher Risiken, Schutz des Kindes: Früherkennung von Gefährdungen des Fetus (Wachstumsstörungen, Fehlbildungen, Infektionen) und als gesellschaftlicher Auftrag die Schaffung einheitlicher Standards und Senkung von Mortalität und Morbidität. Sie ist für die Anbieter (Alle Kassen und Leistungserbringer, wie Ärztinnen/Ärzte, Hebammen, sonstige verwandte Berufe) verbindlich.
Für die Schwangere dagegen stellt die Vorsorge immer "nur" eine Option, ein Angebot dar (§ 1 Abs. 2 MuRL). In Deutschland nehmen jedoch fast alle Schwangeren diese Vorsorgeangebote in Anspruch. Die Quote liegt stabil bei über 95 %. Unterschiede zeigen sich nur bei sozial benachteiligten oder neu zugewanderten Gruppen. Unterschieden werden sollte dabei auf sogenannte Vorsorgemaßnahmen, die auf die Erhaltung der mütterlichen Gesundheit gerichtet sind, von solchen, die sich primär auf das Ungeborene beziehen: Hierunter fallen auch die fetalen Ultraschalluntersuchungen. In der Realität lassen sich beide Kategorien nie vollständig trennen.
Immerhin 90-95% der Schwangeren nehmen auch die 3 Basis-Ultraschalluntersuchungen bei der primärbetreuenden Frauenärztin/Frauenarzt wahr. Primär dienen diese im Normalfall der Beruhigung und Rückversicherung. Allerdings können sie bei Feststellung von Auffälligkeiten immer auch Einstieg in eine Kaskade von (pränatalmedizinischen) Folgeuntersuchungen sein.
Insoweit trifft Ihre Aussage uneingeschränkt zu: Wer nicht in eine ungewollte Entscheidungssituation kommen möchte, sollte konsequenterweise Pränataldiagnostik nicht in Anspruch nehmen. Frauenärzte sind übrigens verpflichtet, auch über das Recht auf Nichtwissen aufzuklären. Insbesondere bei pränataler Diagnostik.
"Tests sind Bausteine der Diagnosefindung, rechtfertigen aber keine direkten therapeutischen Maßnahmen, etwa in der Pränatalmedizin unter Umständen einen Schwangerschaftsabbruch."
Einen Schwangerschaftsabbruch hatte ich bislang nicht unter die Rubrik "therapeutische Maßnahmen" subsummiert ... 😢
"Der Abbruch stellt für die Schwangere selbst als Handlungsoption in aller Regel die ultima ratio dar, bei der sie sich nicht gegen das Leben des Kindes als solches stellt, sondern dagegen, dass das Kind erkennbar einen Schicksalsweg auferlegt bekommen hat, den sie für das Kind als nicht tragbar beziehungsweise würdig erachtet."
Bei allem menschlichen Verständnis für eine solche Überlegung, über die ich mir auch kein moralisches Urteil erlaube:
Was hier beschrieben wird - darüber sollten wir uns im Klaren sein, ist argumentationslogisch keine "medizinische Indikation" (Gefährdung der Mutter), sondern Euthanasie ("guter Tod")!
Mit dem Ansatz "Wir informieren, die Entscheidung trifft ja die Frau" wird die Verantwortung für ärztliches Handeln auf die Frau abgewälzt, statt sie selbst zu übernehmen. Der Arzt bahnt den potenziellen Weg zur Abtreibung. Dann steht er auch mit in der Verantwortung für das, was am Ende des Weges geschieht.
Die Verantwortung für ärztliches Handeln wird nicht durch die Patientenautonomie aufgehoben. Der Arzt ist für sein Handeln ethisch höchstpersönlich verantwortlich und kann sich nicht hinter einem "Der Patient hat es doch so gewollt und enschieden" zurückziehen.
Wobei es hier zudem noch um das Leben eines Dritten geht.
@Martin FeichtingerSehr geehrter Herr Feichtinger,
vielen Dank für Ihren wertvollen Kommentar. Folgender Gedanke hierzu:
Zutreffend ist (vergl. letzte Frage im Teil 2 des Interviews): Wer Pränatalmedizin betreibt, arbeitet, auch wenn er selbst aus ethischen Gründen persönlich keine medizinisch indizierten Abbrüche durchführt, in einem Versorgungsnetz auch Abbrüche durchführenden Einrichtungen und den dort tätigen Ärztinnen und Ärzten zu. Ohne diese Tätigkeit kleinreden zu wollen, muss in der dimensionalen Zuordnung der beruflichen Tätigkeit betont werden, dass es sich hier in der Gruppe der 4 % Fehlbildungen um eine anteilig 16 % umfassende Untergruppe handelt (entspricht 6 Promille aller Schwangerschaften), bei welcher die Schwangere als gemeinsam mit dem Kind primär Betroffene für die ärztliche Seite glaubhaft und nachvollziehbar (-> Indikationsstellung) diese gesundheitliche Störung ihres Kindes als derart schwer erachtet bzw. erlebt, dass sie sich außerstande sieht, die Schwangerschaft auf dieser Basis für sich und das Kind fortzuführen. In der Realität handelt es sich hierbei fast immer um entweder infaust kranke oder bei Erreichen der Geburt meist schwerst mehrfach behinderte Feten: Nur als Erklärung, keine Rechtfertigung, wovon wir hier sprechen.
Keine Ärztin/kein Arzt versteckt sich an diesem Punkt hinter dem Verweis, die Schwangere habe das so gewollt: Er muss sich immer, nachdem die Schwangere sich auf diese Weise geprüft hat, dann selbst fragen, ob er/sie für sich dem aus einer in letzter Konsequenz unlösbaren Konfliktsituation entstandenen Begehren der Schwangeren unterstützend in einer medizinischen und persönlich-ethischen Betrachtung Folge leisten kann oder nicht. Insoweit sind solche Situationen immer auch für Ärztinnen und Ärzte ethisch schwierig und zumindest potentiell ebenfalls konfliktbehaftet. Daher: Wer aus nachvollziehbaren Gründen dies generell nicht möchte oder verständlicherweise nicht kann, sollte besser nicht in diesem Feld beruflich tätig werden.
Das Weigerungsrecht erstreckt sich damit nicht nur auf den aktiven Abbruch, sondern auch das Ausmaß einer zuarbeitenden Unterstützung. Im umgekehrten Fall, hier stimme ich Ihnen zu, geht er/sie als "Unterstützer/in" mit der Schwangeren zumindest in Teilen gemeinsam den extrem schwierigen weiteren Weg.
Jede Schwangere hat immer in einer solchen Situation, wie sonst auch, das Recht, sich andernorts eine ärztliche Zweit- oder auch Drittmeinung einzuholen – auch bezgl. der Indikation.