Zwischen Kuhmist, Hellebarden und Ekstasen

Am 25. September feiert die Schweiz ihren Landespatron Niklaus von Flüe (1417–1487), besser bekannt als Bruder Klaus. Der Mystiker aus den Alpen gilt bis heute als spirituelle Leitfigur – über Sprach- und Konfessionsgrenzen hinweg. Seiner moralischen Autorität ist es zu verdanken, dass die junge Eidgenossenschaft damals nicht auseinanderbrach.
Auch heute noch ist seine Einsiedelei in der malerischen Ranft-Schlucht ein Anziehungspunkt für Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt und ein beliebter Kraftort. Bruder Klaus’ Frau Dorothee hat bei seiner Berufung eine entscheidende Rolle gespielt.
Niklaus von Flüe wuchs in einer Bauernfamilie auf einer Hochebene in Obwalden auf, der zu den drei Gründerkantonen der Eidgenossenschaft gehörte und sich von den Habsburgern losgesagt hatte: Man wollte keine Abgaben mehr leisten, selbst Recht sprechen und die eigene Freiheit mit Waffengewalt verteidigen. Wenn die Bündnispartner riefen, zog man mit Hellebarden und Spießen in die Schlacht und metzelte, was es zu metzeln gab. Danach kehrte man zurück auf den Hof, um die Felder zu bestellen, die Gefallenen zu ehren und für ihre Totenruhe zu beten.
Mit dem Rosenkranz ins Gefecht
Auch Niklaus von Flüe marschierte in diesen Kriegszügen mit und beteiligte sich an den Bruderkriegen: Die junge Eidgenossenschaft war von inneren Konflikten erschüttert, denn der eidgenössische Ort Zürich hatte sich ausgerechnet mit den Habsburgern verbündet, um Gebietsansprüche durchzusetzen – ein Affront, den die übrigen Kantone nicht auf sich sitzen ließen.
Der spätere Friedensstifter Bruder Klaus berichtete, er sei in die Schlachten gezogen, um zu verhindern, dass ein anderer an seiner Stelle Unheil anrichte. Damit meinte er vor allem die Übergriffe der Milizsoldaten auf die Zivilbevölkerung nach den Gefechten.
Aus Pflichtgefühl zog er aus, „in der einen Hand den Spieß, in der anderen das Bätti“. Mit dem „Bätti“ war eine Paternosterkette gemeint, den Vorläufer des Rosenkranzes. Schon als Kind war Klaus ein leidenschaftlicher Beter, der sich häufig in mystischen Visionen verlor. Seine Beichtväter halfen ihm später, diese Erfahrungen zu deuten – und die immer wiederkehrenden Anfälle von Schwermut durchzustehen.
Das entscheidende Ja von Dorothee
Mit 30 Jahren heiratete Niklaus von Flüe und bekam mit seiner Frau Dorothee zehn Kinder. Er machte Karriere als Politiker, saß im Gericht und führte den Bauernbetrieb. An Geld mangelte es der Familie nicht. Der Hof versorgte alle gut. Doch während das Leben äußerlich geordnet verlief, wuchs in Niklaus innerlich eine immer schmerzlichere Sehnsucht nach Gott. Sie brachte ihn in heftige seelische Turbulenzen: Angst und Trost, Zweifel und Kraft, Versuchungen und mystische Erfahrungen wechselten sich ab. Mit fast 50 Jahren schließlich wollte er sich dann ganz Gott hingeben – auch wenn das bedeutete, seine Familie zu verlassen.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Hier kam Dorothee ins Spiel. Die Beichtväter des Bauern bestanden darauf, dass ein Aussteigen nur möglich war, wenn seine Frau ihm die Erlaubnis erteilte. Die Ehe ist ein Sakrament und als solches wichtiger als die Sehnsucht nach Einsamkeit, möge diese noch so fromm sein. Zuerst weigerte sich Dorothee, aber nach langem Ringen gab sie ihren Mann schweren Herzens frei. Die ältesten Söhne waren längst volljährig und konnten für sie und die Geschwister, deren jüngstes sie noch stillte, sorgen. In der Sippe war sie gut aufgehoben.
Endlich durfte Bruder Klaus als Pilger in die Ferne schweifen. Doch es kam anders: Kurz vor Basel wurde er durch eine göttliche Vision wieder nach Hause geschickt. In der Ranft-Schlucht, nur wenige Gehminuten von seiner Familie entfernt, ließ er sich nieder. Er verbrachte dort zwanzig Jahre als Einsiedler, aber immer in Verbindung mit Frau und Kindern, die ihn regelmäßig besuchten.
Zwanzig Jahre ohne Nahrung
Bis zu seinem Tod lebte Bruder Klaus zwanzig Jahre lang barfüßig in seiner kargen Zelle im Ranft – ohne zu essen und zu trinken, allein gestärkt durch die heilige Kommunion. Dieses widernatürliche Verhalten sorgte für Aufsehen. Weltliche Behörden ließen ihn einen Monat lang überwachen, um auszuschließen, dass er heimlich doch etwas aß. Auch kirchliche Würdenträger unterzogen ihn einer Prüfung, um jeglichen Verdacht von Aberglauben fernzuhalten. Auf die Frage, ob seine totale Abstinenz echt sei, antwortete er immer nur: „Gott weiß“.

Schon zu Lebzeiten rankten sich zahlreiche Wundergeschichten um Bruder Klaus. Vor allem aber wurde er zu einem gefragten Seelsorger und politischen Ratgeber. 1481 stand die Schweiz kurz vor einem Bürgerkrieg. Es ging um die Verteilung der reichen Beute unter den Kantonen nach den Burgunderkriegen und die Aufnahme von Freiburg und Solothurn in den Bund. Aber die Verhandlungen scheiterten, bis eine Botschaft aus dem Ranft die Regierungsvertreter erreichte. Leider ist ihr Inhalt auf sein Geheiß bis heute geheim geblieben, aber sie führte dazu, dass sich die zerstrittenen Parteien ein letztes Mal an den Verhandlungstisch setzten und eine Einigung erzielten. Der Frieden war gerettet und mit ihm die Schweiz.
An seiner Heiligkeit zweifelte niemand. Trotzdem wurde er erst Jahrhunderte später, nach dem Zweiten Weltkrieg, heiliggesprochen. Papst Pius XII. legte den 25. September als offiziellen Gedenktag fest, obwohl Bruder Klaus an einem 21. März gestorben war.
Kompromiss für den Frieden
Das politische Vermächtnis von Bruder Klaus lebt bis heute vor allem in zwei Briefen weiter, die er den Regierungen von Bern und Konstanz diktierte. In seinem Dankesschreiben an Bern würdigte er ein Geschenk, das er für seine Friedensarbeit erhalten hatte. Die Stadt Konstanz hingegen wandte sich an ihn, weil sie im Konflikt mit den Eidgenossen steckte und auf seine Vermittlung hoffte.
Der Rat des Einsiedlers klingt schlicht, ist aber von zeitloser Brisanz: Bei Streitigkeiten müsse man zuerst an den Verhandlungstisch, um Kompromisse zu suchen. Nur im äußersten Notfall dürfe man ein Gericht anrufen. Damit sprach er den wohl schwierigsten Punkt an – den Verzicht auf das eigene Recht.

Niklaus von Flüe wusste, wovon er sprach. Als ehemaliger Politiker, politischer Berater und Richter kannte er die Mühen des Aushandelns. Frieden, so seine Überzeugung, verlangt immer Opfer. Er muss Schritt für Schritt, geduldig und oft unter Schmerzen errungen werden.
„Ein Gutes bringt das andere“, diktierte er damals – ein Satz, der auf den ersten Blick banal wirkt. Überträgt man ihn aber auf die Konflikte unserer Gegenwart, zeigt er seine ganze Tiefe. Wo Emotionen lähmen und Fronten verhärtet sind, bleibt genau dieser Gedanke oft die letzte Hoffnung – dass man manchmal nachgeben muss, um den Weg zum Frieden zu ebnen.


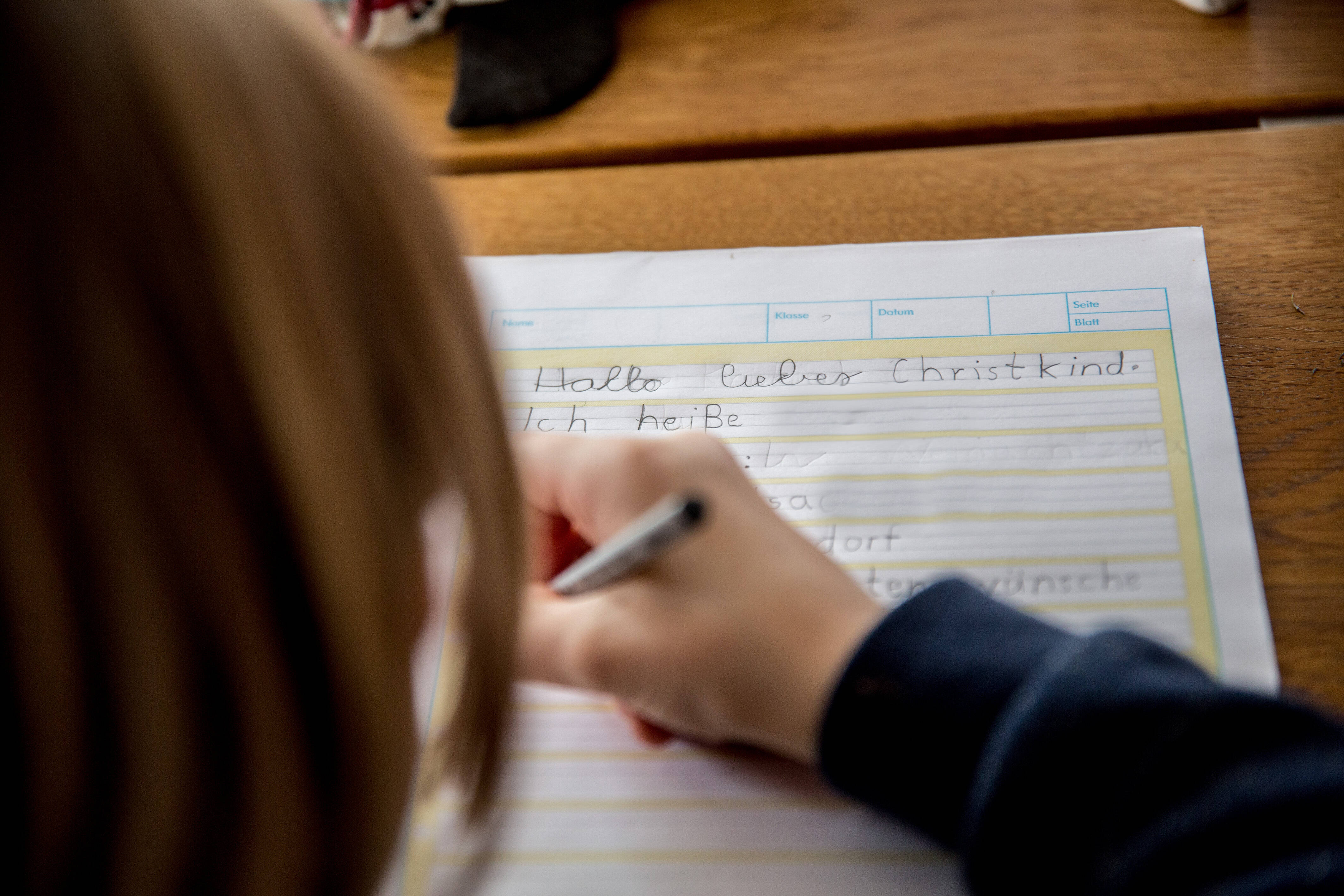


Kommentare
Was für ein grosser Heiliger, den wir als Schutzpatron haben dürfen. Danke Bruder Klaus. Beschütze uns weiterhin gegen alle Gefahren und hilf unseren verirrten Politikern mit deinem Leitspruch "Macht die Grenzen nicht zu weit" (EU, NATO, UNO ...).
In obenstehendem Text über das Wunder, dass Bruder Klaus dank der hl. Kommunion 20 Jahre ohne Nahrung lebte, wäre der Begriff "übernatürlich" wahrscheinlich passender als "widernatürlich".
Es wäre schön, bei Corrigenda bald auch etwas zu seinem grossen Wunder während des 2. Weltkriegs zu lesen, als der hl. Bruder Klaus die Schweiz mit seiner grossen Hand am Himmel vor Nazi-Deutschland bewahrte.
Heiliger Niklaus, bitte für uns! 🙏