Alle bunt, alle frei? Wenn der Vielfaltskult wie ein Haferkeks zerbröselt

Ich sitze in Berlin-Mitte, sehe Plakate der Bundeswehr, lese Artikel, in denen gefordert wird, Männer – und in manchen Vorschlägen auch Frauen – müssten in Zukunft Dienst leisten. Ein Pflichtdienst, ein Fragebogen beim 18. Geburtstag, mit Fragen über Stress, Disziplin, Führungsfähigkeit. Es klingt wie ein vorsichtiger Schritt in Richtung Bürgerpflicht – und als Frau frage ich mich: Wollen wir das wirklich? Und was verlangt der Staat dann von uns?
Berlin ist die Stadt der Parolen: „Alle gleich, alle bunt, alle frei.“ Doch was passiert, wenn diese bunte Theorie plötzlich auf den Ernstfall trifft? Wenn es nicht mehr um Regenbogenflaggen am Rathaus geht, sondern um Uniformen, Drill und Gehorsam? Und betroffen sind ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die sich als „weibliche Menschen“ identifizieren. Plötzlich zerbröselt der Vielfaltskult wie ein Haferkeks, oder? Im Ernstfall sortiert man wieder nach den simpelsten Rastern: Alt oder jung, Mann oder Frau, tauglich oder untauglich, bereit oder verweigernd.
Noch schützt das Grundgesetz Frauen vor der Wehrpflicht. Eine schnelle Änderung ist erstmal nicht in Sicht. Wozu also die Aufregung? Und doch treibt allein die Idee Feministinnen und Pazifisten gleichermaßen in Rage – die einen, weil sie keinen Zwang dulden, die anderen, weil sie Frauen nicht im Schützengraben sehen wollen. Aber ist das nicht selbst verräterisch? Wer an allen Ecken Gleichberechtigung fordert, gerät in Panik, sobald Gleichberechtigung einmal echten Einsatz bedeutet.
Andere Länder und andere Zeiten kennen kämpfende Frauen
Ein Blick über die Grenzen: In Dänemark hat man gerade die Wehrpflicht für Frauen beschlossen. Nicht aus Militarismus, sondern weil man Gleichberechtigung ernst nimmt – auch wenn sie unbequem wird. In Israel ist weiblicher Wehrdienst seit der Staatsgründung selbstverständlich, zwei Jahre lang. Dort spricht eine junge Kampfpilotin nach einem Einsatz davon, „das Gewicht der Verantwortung gespürt“ zu haben – für Kinder, für die Zukunft, für den Frieden von morgen. Und in Berlin? Hier protestiert man lieber mit Transparenten und Kerzen gegen jede Form von Pflicht – im sicheren Schatten der NATO.
Natürlich, Frauen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten harte Berufe erkämpft – sie fliegen Passagierjets, löschen Brände, steuern Kräne. Aber wenn es um den Militärdienst geht, heißt es plötzlich, das sei unzumutbar. Sind dänische oder israelische Frauen also Wesen von einem anderen Stern? Oder sind es nicht vielmehr wir Deutschen – und besonders wir Berliner –, die uns in Ausreden flüchten?
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

Wir kennen kämpfende Frauen nicht nur aus der Gegenwart, sondern auch aus der Geschichte. Jeanne d’Arc – Widerstandskämpferin im Hundertjährigen Krieg. Amelia Earhart – Pilotin, die Atlantikflüge meisterte, Symbol für weiblichen Mut und Technikbegeisterung und deshalb im Krieg als Idol für Frauen in der Luftfahrt gesehen wurde. Soja Kosmodemjanskaja – Partisanin, von der Wehrmacht gefoltert und gehängt, mit 18 Jahren schon zur Nationalheldin der Sowjetunion erklärt. Frauen, die ihre Völker verteidigten, oft als Mütter, fast immer unter Einsatz ihres Lebens.
Sie waren keine dekorativen Amazonen für Paraden, sondern Führungsfiguren, Kämpferinnen, Leitbilder. In Berlin dagegen zitiert man sie gern in Vorträgen über „Female Empowerment“ – aber wehe, die Konsequenz würde heißen: auch hier Uniform und Pflicht.
Die Fragen „Wer ist Mann?“, „Wer ist Frau?“, „Wer ist trans, und wie zählt das?“ erübrigen sich. Wie der ermordete konservative US-Influencer und Bürgerrechtler Charlie Kirk sagte: „I am pro-reality“ (deutsch: Ich bin auf der Seite der Realität). Heißt, im Ernstfall ordnet der Staat nach Biologie!
Gleichwertigkeit braucht keine Gleichmacherei
Als Christin sage ich, dass das richtig ist. Unser Wert liegt nicht darin, ob wir marschieren, Uniform tragen, schießen können. Unser Wert liegt darin, dass wir Geschöpfe Gottes sind, Mann und Frau, gewollt in unserer Unterschiedlichkeit. „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie“ (Gen 1,27). Gleichwertigkeit braucht keine Gleichmacherei. Und Gleichberechtigung heißt nicht, dass Frauen jede Last der Männer übernehmen müssen wie auch umgekehrt.
Keine Frau darf jemals hoffen, dass der Mann einst das Kind austrägt. Übrigens, eine jede Schwangerschaft ist wie jeder Kriegseinsatz ein Risiko für das Leben. War es schon immer. Und wer angesichts dieser natürlichen Unterscheidung der Geschlechter gleich mit dem Schwarz-Weiß-Denken „Frau zurück an den Herd“ kommt, dem möchte ich sagen: Die berufliche Verwirklichung ist eine Sache der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gestaltung. Die Wehrpflicht aber ist die Frage einer Pflicht. Keine Frau – und auch kein Mann – wird gezwungen, Vollzeit zu arbeiten. Jeder kann heute arbeiten, wie er es eben schafft.
Und es gibt sie ja schon seit Jahrzehnten, die freiwilligen Dienerinnen der Bundeswehr. Offizierinnen, Unteroffizierinnen, Mannschafter. Pflicht kann gerecht sein – wenn sie Männer trifft, die historisch von Schutzpflichten geprägt sind. Aber Frauen zwangsweise zu verpflichten, hieße, die gottgewollte Unterschiedlichkeit zu leugnen. Im Ernstfall entsteht automatisch der Kompromiss. Denn was ist die Tatsache? Der Mann führt Krieg, kommt verletzt zurück (wenn er zurückkommt), und es pflegt ihn ganz der natürlichen Ordnung gegeben – wer? Die Frau.
Die Hauptstadt diskutiert laut über die neue Wehrpflicht, doch die eigentliche Frage lautet leise: Vertrauen wir noch darauf, dass unsere Unterschiede gewollt und gut sind? Oder wollen wir so tun, als seien Frauen nur dann vollwertig, wenn sie marschieren wie Männer?




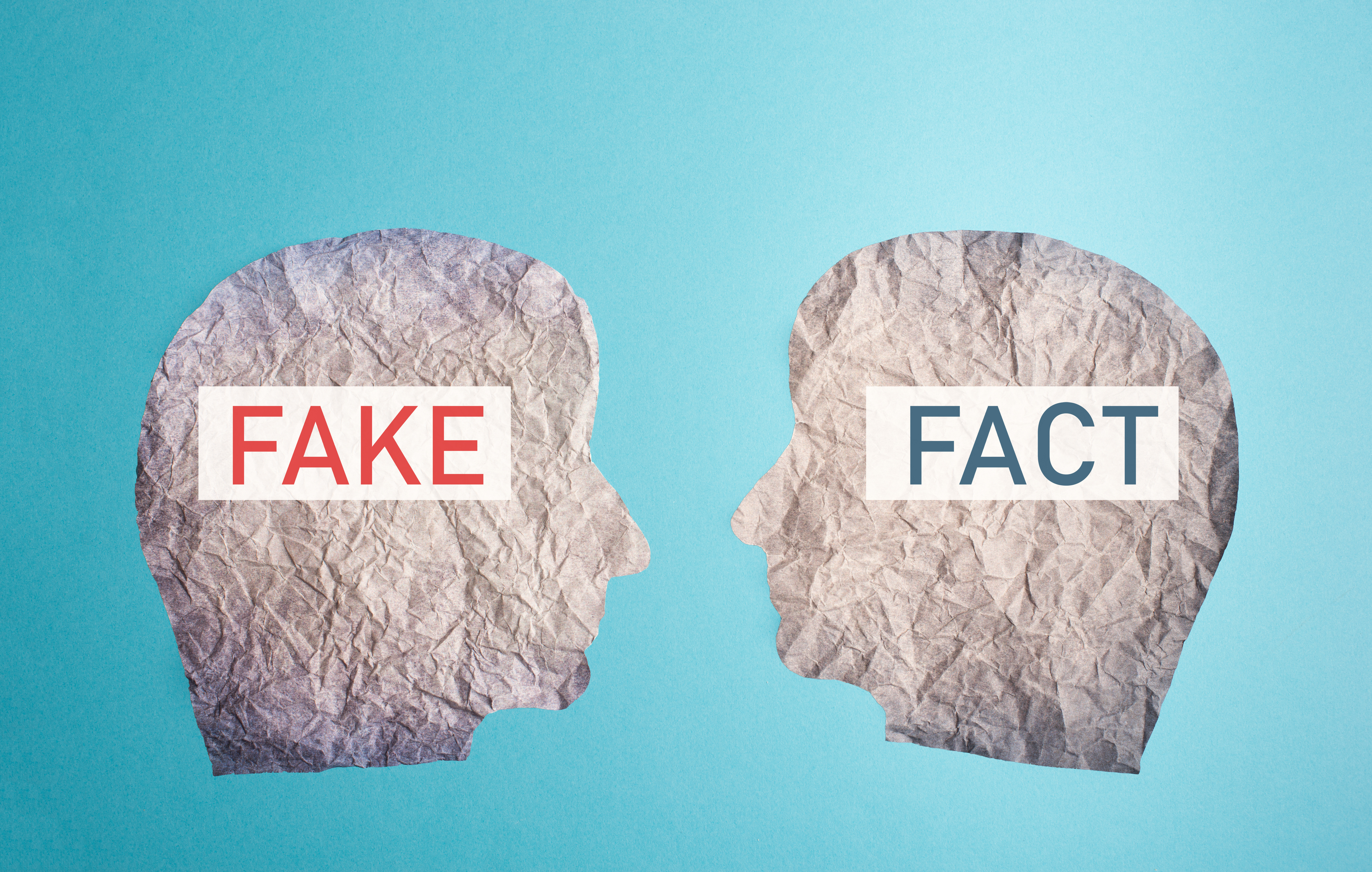

Kommentare
Was die Autorin hier beschreibt, nennt man "Gender Empathy Gap": Wir verbieten das Schreddern männlicher Küken, aber bei männlichen Menschenkindern halten wir es für normal (auch schon die im Frieden mit der Wehrpflicht verbundenen massiven Grundrechtseinschränkungen). 😢
Um nichts anderes geht es nämlich bei der Wehrpflicht als um KANONENFUTTER, weil zur modernen Kriegsführung mit komplexen Waffensystemen gut ausgebildete Berufssoldaten gehören: https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/soeder-bei-lanz-deutschland-braucht-wehrpflichtige-fuer-die-front-86901686.bildMobile.html.
Und im zivilen Leben geht es mit der nach Geschlecht abgestuften Menschenwürde so weiter: Wenn ein Mann wie der Mannheimer Polizist Rouven Laur seine Pflicht tut und dabei brutal ermordet wird, lachen weibliche Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus. Wenn in Aschaffenburg ein Messerstecher einen kleinen Jungen und zwei Männer, die zu Hilfe eilen, absticht, ätzt die ach so fromme Julia Klöckner auf X pauschal über Männer (https://x.com/JuliaKloeckner/status/1882084212985171971) und wird zur Belohnung ins zweithöchste Staatsamt befördert. Kein Wunder: Ihre christliche Partei forderte im Wahlkampf 2025 mehr Gender-Medizin und mehr medizinische Dienstleistungen für Frauen. Dass 3/4 der Suizide auf Männer gehen, u.a. weil Depressionen bei Männern seltener erkannt und behandelt wird, scheint die Unionschristen nicht zu stören. Und wenn man als Kind Schulprobleme hat, ist man als Mädchen besser dran: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/geschlechterrollen-lehrer-helfen-eher-ausgegrenzten-schuelerinnen-18068894.html. Kein Wunder, dass sich da Eltern lieber eine Tochter als einen Sohn wünschen: https://www.faz.net/aktuell/stil/eltern-familie/eltern-wollen-lieber-toechter-als-soehne-was-ist-bloss-so-schlimm-an-jungs-110436372.html. 😢
Die Stelle aus Genesis heißt vollständig: "Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie." Von "Kanonenfutter" vs. "Muttergottheit" steht da nichts. Die Menschenwürde und das Recht auf Leben und körperlicher Unversehrtheit leiten sich aus der Gottesebenbildlichkeit ab, nicht (wie z.B. im Nationalsozialismus) aus der reproduktiven Nützlichkeit.
Wie also bitte erklären christliche Eltern ihren Kindern, dass die Töchter zu Recht alle Segnungen des demokratischen Rechtsstaats genießen, aber nur die Söhne dafür töten und sterben müssen, wenn es ernst wird, diesen zu verteidigen??!! 😢
Ich denke, der Ansatz hier ist falsch. Frauen sind schon lange nicht mehr dabei mit 18 Kinder zu bekommen und Wehrdienst bedeutet nicht Leute rumzuschleppen und beim Panzer alleine Ketten zu wechseln. Wehrdienst bedeutet vorbereitet zu sein. Seine Grenzen zu kennen und auch Kenntnisse zu erwerben, die man normalerweise nicht hätte. Im Falle des Falles könnte man so zum Beispiel auch im Wald zurechtkommen oder eine Waffe bedienen. Wehrdienstleistende werden ja nicht im Krieg verheizt und kommen eventuell auch nie in einen Krieg. Dennoch könnte es im Kriegsfall auch für zuhause bleibende Frauen einmal nötig sein in der Wildnis für ein paar Tage zurechtzukommen. Wenn zum Beispiel die Stadt angegriffen wird und man flüchten muss. "Ich weiß aber nicht, wie das geht" ist dann vermutlich das Schlechteste, was man von sich geben könnte.
Das Thema Kinder wird ohnehin immer unwichtiger. Eine Großfamilie hat kaum jemand noch. Wer mit über 30 mal ein Kind bekommen will, der hat auch nicht mehr die Wirkung auf die "Erhaltung des Volkes" wie früher. Denn natürlich wurde man ja nicht ausgenommen, weil man vielleicht mal Kinder bekommen würde. Man musste nicht zum Wehrdienst, weil man meist schon Kinder hatte oder zumindest drauf und dran war welche zu bekommen. Da wurde man natürlich zuhause gebraucht.
Aus meiner Sicht kommt aus Gleichberechtigung auch "Gleichbepflichtung". Die emanzipierte Frau von heute sucht sich gern die guten Sachen aus, ohne die schlechten Sachen anzunehmen. Firmenvorstände müssen einen Frauenanteil bekommen, Müllmänner dürfen alle gerne männlich sein. Frauen und Mädchen werden bei der Berufsfindung und bei Positionen unterstützt, obwohl sie schon in größerer Zahl mit besserem Ergebnis Schule und Studium verlassen. Männer fördern ist aber furchtbar unpopulär, weil die es ja schon "immer einfach" haben. Darum auch eine hohe Zahl an Suiziden, Toden auf der Arbeit und als Opfer von Straftaten.
"Eine Wehrpflicht für Männer halte ich grundsätzlich für sinnvoll. Man darf auch nicht vergessen, dass sie zu einer positiven charakterlichen Formung von jungen Männern viel beitragen kann: Man lernt Dinge wie Gemeinschaftssinn und Selbstüberwindung. Wer gelernt hat zu dienen, wird sich später auch leichter tun, andere im Beruf gut zu führen."
Oh, mein Gott! 😉
Mit diesem Statement beweisen m.E. 100%ig, dass SIE NICHT BEI DER BUNDESWEHR GEDIENT HABEN! Oder höchstens in einer harmlosen Sonderfunktionen wie Ordonanz oder Schreibdtube. Sie reden - mit Verlaub - wie ein Blinder von der Farbe, wie ein Junggesell vom Kindernkriegen.
Mag natürlich schon möglich sein, dass man beruflich Karriere macht, wenn man zu jedem Schwachsinn und jeder Boshaftigkeit "Jawoll" sagt und wegsieht, wenn Kameraden/Kollegen gequält/gemobbt werden ... 😢
Schon lange wäre es Aufgabe der Politik gewesen, Deutschland soweit militärisch aufzurüsten bis die volle Abwehrbereitschaft erreicht ist. Nicht wegen Macht oder Imperialismus, sondern um sich im Ernstfall adäquat verteidigen zu können. Das ist so, wie wenn man in einer Wohnung eine stabile Haustür einbaut: Einfach rationales und normales Verhalten. Stattdessen galt in etwa das Motto: "Für unsere Verteidigung sind die anderen zuständig. Sollte es einmal brenzlig werden, werden die Amerikaner schon kommen und uns retten." Das ist tatsächlich eine haarsträubende Einstellung, die ein grelles Licht auf mentale Schieflagen in der Bundesrepublik wirft (man denke etwa an Churchills Vision: "Ich will die Deutschen fett, aber impotent").
Eine Wehrpflicht für Männer halte ich grundsätzlich für sinnvoll. Man darf auch nicht vergessen, dass sie zu einer positiven charakterlichen Formung von jungen Männern viel beitragen kann: Man lernt Dinge wie Gemeinschaftssinn und Selbstüberwindung. Wer gelernt hat zu dienen, wird sich später auch leichter tun, andere im Beruf gut zu führen. Der Wehrdienst kann also schon Tugenden vermitteln, die fähig machen im Leben zu bestehen.
In der jetzigen Situation befürworte ich eine Wehrpflicht aber absolut nicht, egal ob Männer oder Frauen. Denn sie dient hier nicht dem eigentlich Zweck der Bundeswehr, nämlich der Landesverteidigung, sondern fremden Interessen (meine Überzeugung).
@EUM Der Wehrdienst kann also schon Tugenden vermitteln, die fähig machen im Leben zu bestehen.
Ich bin auch für die Wiedereinführung des Wehrdienstes, aber bestimmt nicht aus Gründen der Volkserziehung... Sekundärtugenden kann man überall lernen, beginnend mit dem Elternhaus.
... sondern fremden Interessen (meine Überzeugung).
Ja, welche denn? Immer dieses geheimnistuerische Geraune.
Klingt zwar krass, aber so wird's dann wohl um unsere Zukunft bei der angeblichen Gleichberechtigung bestellt sein:
Eine Frau, die zur Waffe greift, muß notfalls auch bereit sein, die Kinder ihrer Freundin zu erschießen; und umgekehrt dto.
@Apostel45 Genau so ist es leider ... und von Männern hat man das schon immer mit großer Selbstverständlichkeit verlangt!
Immer wenn ich mich mal wieder über die besonders gute Zusammenarbeit mit einem meiner Lieblingskollegen, der Wehrpflichtiger bei der NVA war, freue, danke ich Gott, dass der "Kalte Frieden" so gut und lange gehalten hatte.