Streit ist nicht gleich Streit
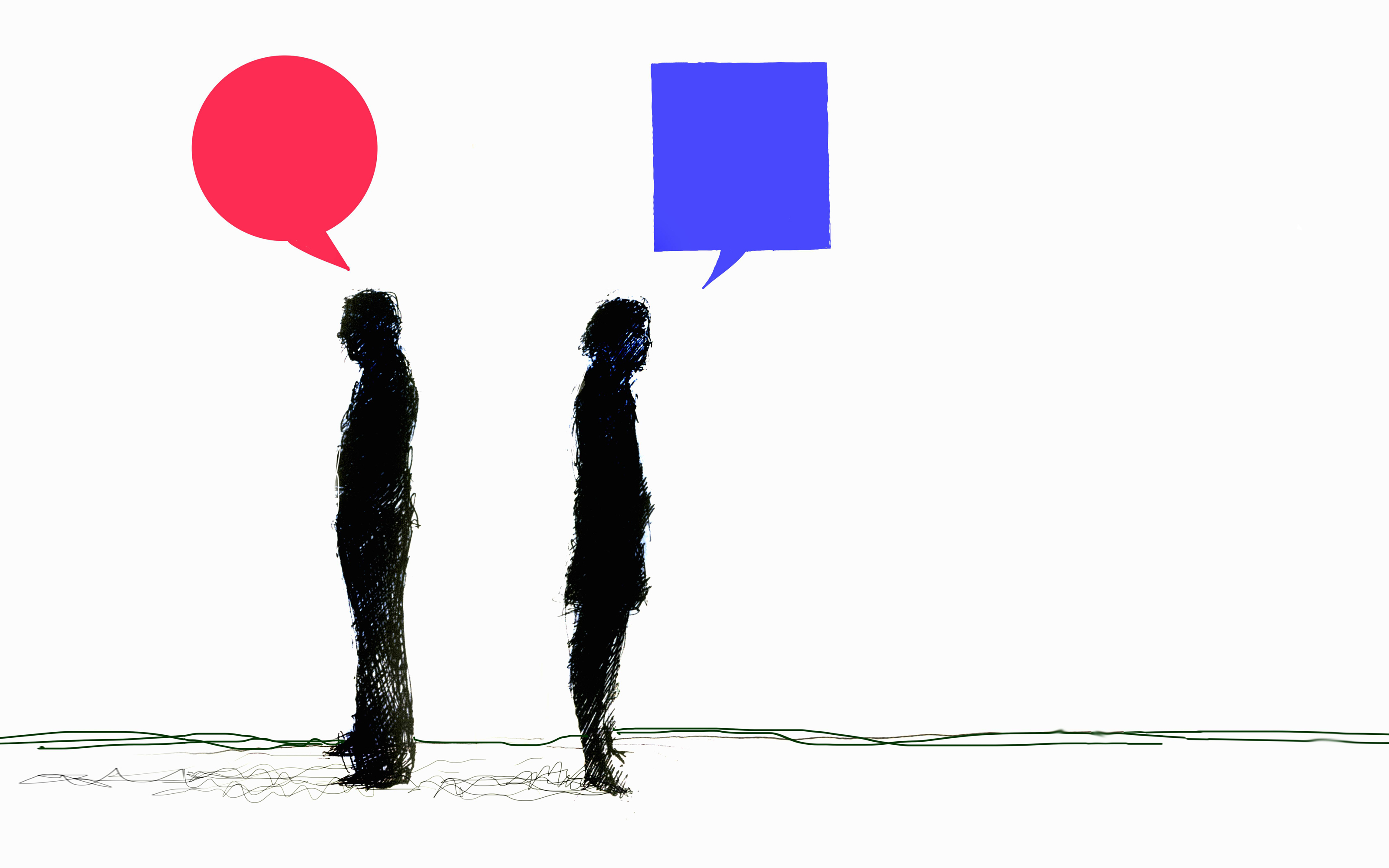
Es geht hoch her in den Debatten, insbesondere im digitalen Raum. Die Gefahr, dass alles aus dem Ruder läuft, ist hoch. Auffallend ist, dass die hochemotionalen Verbalschlachten stark infantilisiert sind, weil sie meist auf einem Gut-Böse-Denkmuster basieren, das auch in Märchen bedient wird. Schnell rutscht der Kampf auf Sandkastenniveau, mit Reflexen wie „Der hat aber angefangen“ und „Du bist nicht mehr mein Freund“. Permanente Rechthaberei, der Drang zur Diffamierung, keinerlei Kompromisse. Man wirft sich sinnbildlich auf den Boden wie ein Kind, das im Supermarkt nicht den ersehnten Schokoriegel bekommt.
Besonnenheit, Selbstreflexion und Komplexitätsbewusstsein, die einen reifen Menschen ausweisen würden: Fehlanzeige. Zu beobachten ist das auch bei Politikern, die sich in aller Öffentlichkeit fetzen und dabei wahrlich unterirdisch aufführen.
Gewiss, Streit lässt sich nicht vermeiden. Keiner von uns ist buddhistisch erleuchtet und schwebt mit stetem Gleichmut über den Dingen. Nun ist aber Streit nicht gleich Streit. Konfliktstile lassen sich ändern, Dissonanzen so bewältigen, dass es einen guten Gang nimmt. Weil es eben nicht darum geht, recht zu haben und den Gegner rhetorisch zu besiegen. Gerade eine Gesellschaft, die permanent erhitzt ist, sollte ihre Unfähigkeit, gut zu streiten, unbedingt überwinden. Bevor man übrigens glaubt, davon nicht betroffen zu sein, darf man sich ruhig selbst ins Visier nehmen.
Übrigens auch dann, wenn man selten in Auseinandersetzungen gerät, denn vielleicht liegt es daran, dass man das nicht deshalb tut, weil man besonders friedliebend wäre, sondern weil man schlichtweg Angst vor Konflikten hat. Der harmonieliebende Mensch braucht Harmonie um jeden Preis, was dazu führt, dass er permanent mit Ausweichmanövern beschäftigt ist. Es wird also alles getan, Streit, der eigentlich geführt werden muss, zu verunmöglichen. So fällt gar nicht erst auf, dass man nicht in den Ring steigt – weil man es überhaupt nicht kann.
In Beziehung bleiben, auch wenn man den anderen zum Mond schießen könnte
Denn, nein, Streit per se ist nichts, was es zu vermeiden gilt. Vielmehr geht es darum, dabei so vorzugehen, dass man es konstruktiv tut. Also dadurch Räume öffnet, statt sie zu verschließen. Und ja, natürlich fällt das schwer, weil das gegenteilige Muster etabliert ist. Laut einer Definition sind Konflikte Kampfsituationen zwischen Partnern mit gegenteiligem Interesse. Jeder will sich durchsetzen, jeder will den anderen überzeugen, dass er richtig liegt. Aber geht es wirklich darum? Am Anfang steht die Spannung, und so wie bei einem Gewitter muss es sich eben manchmal zwischen Menschen entladen. Bereits Aristoteles wies darauf hin, dass ein „Drama“ die Möglichkeit einer Katharsis, also einer Bereinigung mit sich bringen würde.
Wer ein „gutes Leben“ führen wolle, der muss auch den Streit wollen, davon war der griechische Philosoph überzeugt. Nicht indem er ständig Streit provoziert, aber indem er Streitsituationen nicht aus dem Wege geht. Denn hier liege auch die Chance auf Veränderung – und Annäherung. Selbst wenn es sich erst einmal wie Trennung anfühlt. Mag man seinen Kontrahenten auch zum Mond schießen wollen, so sollte man dennoch immer in Beziehung bleiben. Der Grund: Der Konflikt ist in der Beziehung entstanden und lässt sich nicht lösen, wenn einer die Kommunikation abbricht. Wer erstmal eine Auszeit braucht, der soll sie sich freilich nehmen. Etwa so: „Es ist gerade schwierig für mich. Ich muss raus aus der Situation, aber ich komme später wieder, dann reden wir weiter.“
Auch Svenja Flaßpöhler wirbt mit ihrem Buch „Streiten“ dafür, nicht in etablierte Muster zu verfallen, wenn es untereinander knallt. Auch für sie, so schreibt die deutsche Philosophin, bleibe es zwar „schwer erträglich, dass Menschen radikal anders denken. Dass sie sich an anderen Werten orientieren, die ich für falsch und gefährlich halte“, doch zugleich wolle sie sich dem Gegenüber nicht verschließen. Wer nicht mal mehr streitet, so macht sie deutlich, gibt den anderen als Menschen auf. Dadurch räumt auch sie mit der einseitigen Betrachtung auf, Streit wäre ausschließlich ein Entzweiungsvorgang. „Zu streiten heißt, ein Gegenüber nicht kalt als Feind abzustempeln, sondern die Mühen der Argumentation auf sich zu nehmen“, erläutert sie. Dadurch halte man Verbindung zum anderen.
Streiten kann Entwicklungen voranbringen
Gewiss, es sei immer auch ein Tänzeln über dem Abgrund, denn die Entscheidung, ob man die Verbindung hält, kann im Laufe eines Gefechts auch abschlägig getroffen werden. Dennoch sollten wir es immer wieder wagen, so Flaßpöhler, auch und gerade um des gesellschaftlichen Zusammenhalts willen. Darauf verweist übrigens auch ein Zitat von Sigmund Freud: „Bindung entsteht nur, wo der Widerspruchsgeist nicht unterdrückt wird. Nur wo Aggressionen zur Sprache kommen, kann ihre zerstörerische Kraft in sozialen Zusammenhalt verwandelt werden.“
Zudem bringt Streit oft auch Entwicklungen voran. Heraklits Aphorismus, Krieg sei „der Vater aller Dinge“, was meint, er bringe Fortschritt hervor, lässt sich auch auf die zwischenmenschlichen Kriege übertragen. Diese positive Betrachtung soll allerdings nicht dazu verführen, das dadurch hervorgebrachte Leiden auszublenden. Anders gesagt, der Text intendiert kein Lob des Bellizismus, weder im Mikro- noch im Makrokosmos.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Halten wir uns im Bewusstsein: Es liegt in unserer Hand, inwiefern Streit ins Destruktive kippt, inwieweit er uns schadet statt uns nützt. Betrachten wir ihn zuallererst als eine rein sachliche Information, dass etwas im Argen liegt. Nicht selten sind es sogar wertvolle Hinweise auf eigene lebensgeschichtliche Themen, die wir mit uns herumschleppen. Die Reiberei mit dem anderen lässt sich also als eine Art Erinnerungshilfe einstufen und als Chance, da endlich mal ranzugehen. Wenn man bei sich die Ursache dafür sucht, dass man gerade unausgeglichen ist, anstatt dem anderen die Schuld zuzuschieben, nimmt das meist die Schärfe heraus.
Eine andere Meinung ist Konsequenz unserer Unterschiedlichkeit
Streit erinnert uns auch daran, dass der andere ein Individuum ist und seine eigene Sicht hat. Man sollte eine andere Meinung deshalb nicht als Angriff werten, sondern als logische Konsequenz unserer Unterschiedlichkeit. Er bietet eine nächste Gelegenheit, einander besser kennenzulernen. Wenn man mit Interesse und Neugier an die Frage herangeht, warum der andere so argumentiert, und nicht mit einer Abwehrhaltung, dann ist schon viel gewonnen.
Auch der Verzicht auf Vorwürfe und auf Rechthabenwollen bringt eine entspannte Atmosphäre in sonst destruktiv verlaufende Prozesse. Wie man Konflikte konstruktiv führt, zeigt unter anderem der amerikanische Kommunikationspsychologe Marshall B. Rosenberg mit seiner Methode der Gewaltfreien Kommunikation. Es lohnt auch, von philosophischen Diskursen zu lernen. Erstmals bei Platon findet sich eine dialektische Herangehensweise. Rede und Gegenrede erzeugen demnach einen Prozess, an dem am Ende eine Erkenntnis steht. Ziel ist es also nicht, dem anderen seine Sichtweise aufzustülpen, sondern gemeinsam etwas ergründen zu wollen. Es geht also um die Sache an sich.
Ohnehin gilt es zu prüfen, ob man das Thema längst verlassen hat und nur noch gegen den anderen austeilt. Gut also, wenn die Selbstreflexion immer mitläuft. Und auch wenn man beizeiten in alte Muster verfällt – nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Das Zitat ist zwar abgedroschen, aber es stimmt: Übung macht den Meister. Und jeder, der hier Meisterschaft erlangt, wird gebraucht. Dringend.





Kommentare
Alles fängt mit der Diktion an, also die richtigen Worte zu finden, wenn Meinungsverschiedenheiten bestehen, die meist nach wenigen Worten / Sätzen absehbar bzw. erkennbar sind. Demzufolge würde ich das Wort 'Streiten' aus meinem Vokabular streichen wollen und es mit dem vorher schon genannten 'Meinungsunterschied' ersetzen. Streiten wird nämlich oftmals gleichgesetzt mit Statements, die auch körperliche Auseinandersetzung nicht scheuen, was absolut zu vermeiden ist. Meine Schluss-Worte sind dann meist die Feststellung, dass wir zwar nicht zueinanderkommen, ich jedoch seine anderweitige Ansicht insofern toleriere, wie ich ihm jederzeit die Tageszeit entgegenbringen werde / würde, ihn also grüße, wenn ich ihn wieder treffe. Das hier Abgebildete sage ich aus männlicher Sicht, da ich divergierende Diskussionen mit Frauen tunlichst vermeide :-)
Vo dieser Coach-Schneeball-Sekte um "Gewaltfreie Kommunikation" halte ich ja nun gar nichts.