Rituelle Gewalt: Das böse Schweigen

Sonntagabend, 26. Oktober 2025. Herbstwetter, leichter Regen in der Zürcher Altstadt. Vor dem Kino Stüssihof sammelt sich ein Publikum, das eher ruhig und andächtig wirkt. Bald beginnt die Vorstellung des Dokumentarfilms „Blinder Fleck“ der Bremer Regisseurin Liz Wieskerstrauch. Der Film thematisiert organisierte, ritualisierte sexualisierte Gewalt an Kindern in Deutschland.
Darunter versteht man in der Regel Fälle, in denen mehrere Täter gemeinschaftlich, planmäßig und unter ideologischen oder kultähnlichen Bezügen sexuelle Gewalt ausüben. Angesichts der Thematik passt die zurückhaltende Grundstimmung des Publikums, das verständlicherweise vor der Vorstellung keine Freudensprünge macht. Der Saal füllt sich rappelvoll, zusätzliche Stühle müssen her.
Der Film ist spendenfinanziert und wird als Kinotour gezeigt. Obwohl die Regisseurin seit Jahren für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten arbeitet, war diesmal kein Sender beteiligt. Stattdessen unterstützt der Schweizer Verein CARA („Care About Ritual Abuse“ – Fürsorge bei ritueller Gewalt) die Verbreitung. Der Verein versteht sich als Aufklärungs- und Vernetzungsplattform für Betroffene von rituellem Missbrauch und organisierter Gewalt. Vor zwanzig Jahren hatte sie noch Platz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefunden.
(Kein) Wirbel um das Thema
Vorneweg: Es gibt stark abweichende Einschätzungen – etwa die SRF-Dokureihe „Satanic Panic“ von 2023, die keine belastbaren Belege für satanistische und mafiös organisierte Täterzirkel finden konnte und vor suggestiven Therapien warnt. Zugleich kritisierte der Schweizer Medienwatchdog „fairmedia“ das SRF für aus seiner Sicht teils abwertende Darstellung von tatsächlich oder vermeintlich Betroffenen in der Dokureihe.
Auch geht die Mehrheit der Fachwelt derzeit davon aus, dass für organisierte, rituell begründete Tätergruppen keine empirischen Beweise vorliegen, wenngleich einzelne Betroffene glaubhafte Traumafolgen zeigen.
Im Prinzip ist das Thema aber längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen – im journalistischen Milieu ohnehin. Dort wird über „rituelle Gewalt“ entweder seriös berichtet, sie wird als Lügenerzählung zerrissen oder vollständig ignoriert – so wie die Verfasserin dieser Zeilen bereits Absagen zu diesem Thema erhalten hat.
Doch was ist so seltsam an „ritueller Gewalt“, dass gewisse Redaktionen sich lieber davor drücken, darüber zu schreiben? Ist es das fehlende Prestige, das dieses Thema mit sich bringt? Niemand will dafür bekannt sein, als Experte für verstörende Erzählungen von Traumapatienten zu gelten. Und in der Journalistenblase ist das Thema auch nicht hoch angesehen.
Denn jede Redaktion läuft Gefahr, als Fake-News-Schleuder wahrgenommen zu werden, sobald „rituelle Gewalt“ Teil des Redaktionsplans wird. Das merkt auch Regisseurin Wieskerstrauch am Ende der Filmvorstellung in der anschließenden Diskussion an.
Was ist rituelle Gewalt?
Dem Opfer – meist weiblich – wird durch eine Autoritätsperson auf sexuelle Weise seelischer und körperlicher Schaden zugefügt. Doch dabei bleibt es nicht. Bei ritueller Gewalt kommt ein ideologischer Aspekt hinzu: Nach den Schilderungen der Betroffenen gehört die Täterperson einem kultähnlichen Kreis an, in dem die Übergriffe als Teil einer quasi-religiösen oder ideologisch aufgeladenen Handlung stattfinden. Dabei soll es sich laut Aussagen der Opfer nicht nur um Einzeltäter handeln, sondern um Gruppen, in denen mehrere Personen an den Misshandlungen beteiligt sind.
Die geschilderten Szenen erinnern in ihrer Brutalität und Inszenierung oft an extreme Darstellungen aus Horrorfilmen – werden von den Betroffenen jedoch real erlebt und weitergegeben. Viele Opfer berichten, dass das Erlebte psychisch kaum auszuhalten ist und sie infolgedessen eine dissoziative Identitätsstörung (DIS) entwickeln – eine anerkannte psychische Erkrankung, bei der sich verschiedene Persönlichkeitsanteile bilden, um traumatische Erfahrungen abzuspalten und den Alltag dennoch zu bewältigen. Man entwickelt also eine Art zweites „Ich“, damit man weiterhin im Alltag funktionieren kann.
Einige Therapeuten vertreten zudem die Ansicht, dass diese Spaltung durch die Täter gezielt herbeigeführt oder verstärkt wird – eine These, die innerhalb der Fachwelt jedoch kontrovers diskutiert wird und bislang nicht als wissenschaftlicher Konsens gilt.
Jenseits dessen, was man sich vorstellen kann
Alle im Folgenden beschriebenen Fälle stammen aus dem Film „Blinder Fleck“. Sie beruhen auf Aussagen der Betroffenen sowie auf im Film dokumentierten Unterlagen.
Die Anfangsszene, eine nachgestellte Situation, in der ein kleines Mädchen im Kindergartenalter von einer Polizeikommissarin befragt wird, zeigt den Ernst des Films von Beginn an. Das Mädchen erzählt von sexuellen Übergriffen, die ihr eigener „Papa“ ihr zugefügt habe. Außerdem habe er sie an zehn weitere Männer weitergereicht, die im Wald in dunklen Kapuzen und schwarzen Unterhosen ihr Unwesen an ihr getrieben hätten. Die Erzählerstimme klingt wie die Mutter des Kindes, die den Fall schmerzvoll schildert.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Obwohl das Kind medizinisch untersucht und dabei eine massive Rektumserweiterung im Röntgenbild festgestellt wurde und obwohl ein auffälliges Verhalten des Kindes ab einem bestimmten Zeitpunkt beobachtet wurde, reichte das nicht für eine Verurteilung. Nicht nur das: Das Kind wurde dann beim Vater zwangsplatziert.
Laut Film handelt es sich bei diesem Beispiel um einen konkreten Fall, bei dem das Verfahren später aufgrund der diffusen Aussagen des Kindes eingestellt wurde. Die Filmemacherin Wieskerstrauch verweist darauf, dass trotz medizinischer Auffälligkeiten keine belastbaren Beweise für eine Verurteilung vorlagen. Nach einem langen juristischen Kampf durfte das Mädchen dann wieder bei der Mutter wohnen, wie Wieskerstrauch in der anschließenden Publikumsdiskussion berichtet.
In anderen Opfererzählungen des Films treten die Traumapatienten – alles Frauen –direkt vor die Kamera. Teilweise wirken ihre Schilderungen wie bizarre Räubergeschichten. Eine Dame erzählt, wie sie ein Kleinkind tötete, nach dem der Pfarrer, der sie ein Leben lang missbrauchte, ihr diese Schandtat befahl. Für das Publikum kaum zu verarbeiten.
Man versteht die Worte, kann sich jedoch kaum vorstellen, warum gewisse Personen in der Mehrzahl von sich sprechen: „Wir wurden dazu aufgefordert.“ Selbst Menschen mit lebendiger Fantasie kommen bei den Berichten ins Stocken. Die Berichte beruhen auf Aussagen der Betroffenen sowie den Recherchen der Regisseurin. Laut ihr konnten die geschilderten Taten in keinem der gezeigten Fälle juristisch abschließend belegt werden.
Kaum beweisbar
Gemäß den Fachleuten, die im Film auftreten – aus Recht, Wissenschaft, Medizin und Polizei – rühren die diffusen Erzählungen daher, dass die Erinnerungen infolge der dissoziativen Störungen fragmentiert sind. Sie seien daher kaum brauchbar für eine kriminalistische Untersuchung, geschweige denn als Beweismittel.

Der Gedächtnisforscher Hans J. Markowitsch geht davon aus, dass viele Erinnerungen von Menschen mit dissoziativer Identitätsstörung auf tatsächlichen Erlebnissen beruhen.

Der Profiler Axel Petermann untersuchte einen möglichen Fall ritueller Gewalt, konnte die Aussagen der Zeugin jedoch nicht bestätigen.

Die im Film zu Wort kommende Rechtsanwältin Ellen Engel sagt zudem, dass ihr die besonders grausamen Gräuelerzählungen Bauchschmerzen bereiteten, weil sie versucht habe, einige Aussagen zu überprüfen – jedoch ohne Erfolg. Sie habe sich aber an Anzeigen beteiligt, bei denen die Straftat nach gängiger Praxis habe untersucht werden können.
Zwischen Zweifel und Verdrängung
Die fehlende Beweislast in nahezu allen dokumentierten Fällen befeuert die Skepsis gegenüber dem Phänomen der „rituellen Gewalt“. Es scheint schwer vorstellbar, dass Tätergruppen über Jahrzehnte hinweg so perfekt agieren, dass keine Beweise zurückbleiben. Andererseits gibt es Betroffene mit klaren Traumafolgen, die unabhängig voneinander von ähnlichen Erlebnissen berichten – und deren Leid ernst genommen werden sollte, selbst wenn ihre Schilderungen bizarr klingen. Ob sich alle Details ihrer Erfahrungen beweisen lassen, ist dann erst einmal zweitrangig. Hilfe kommst zuerst.
Seit der Veröffentlichung der SRF-Dokureihe „Satanic Panic“ in der Schweiz hat die Debatte zusätzlich an Schärfe gewonnen. Nach Aussage von Wieskerstrauch berichten Betroffene, dass sie heute schwerer Therapieplätze finden.
Die Verantwortung klopft an
Wenn die Erzählungen der Betroffenen auch nur ein Fünkchen Wahrheit enthalten, ist es schlicht ein Akt der Menschlichkeit, diese Missstände sichtbar zu machen.
Mit anderen Worten: Nicht darüber zu berichten wäre pietätlos – und widerspräche zugleich einem rechtlichen Grundgedanken. Sowohl das Schweizer als auch das deutsche Strafrecht kennen das Prinzip, dass Unterlassen strafbar sein kann, wenn jemand verpflichtet ist zu handeln. Die Tatbestände „Unterlassung der Nothilfe“ (Art. 128 StGB CH) und „Begehen durch Unterlassen“ (Art. 11 StGB CH / § 13 StGB DE) können strafrechtlich verfolgt werden. Diese Vorschriften erinnern daran, dass Wegsehen – auch jenseits juristischer Konsequenzen – eine Form moralischen Versagens gegenüber dem Leid anderer sein kann.
Zur Person Liz Wieskerstrauch: Die Frau hinter der Kamera
Liz Wieskerstrauch wurde 1955 in Nürnberg geboren. Sie ist Autorin, Regisseurin und Coach und setzt sich intensiv mit gesellschaftlichen Tabuthemen auseinander. Nach ihrem Studium der Sozialpädagogik, Literatur und Politik begann sie 1982 ihre freiberufliche Laufbahn als Schriftstellerin. Seit 1989 arbeitet sie als Filmautorin und Regisseurin, unter anderem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Für ihren ersten Film zum Thema „Die Seele brennt – Annäherung an eine multiple Persönlichkeit“ (HR 2000) erhielt Wieskerstrauch den Film- und Fernsehpreis des Hartmannbundes. Es folgten der Zweiteiler „Höllenleben – Eine multiple Persönlichkeit auf Spurensuche“ (2001, für den Adolf-Grimme-Preis nominiert) sowie „Höllenleben – Der Kampf der Opfer“ (2003), produziert vom Norddeutschen Rundfunk und am 24. Juni 2003 in der ARD ausgestrahlt. Der Film erzählt die Geschichte von Nicki, einer Frau, die durch rituellen Missbrauch schwer traumatisiert wurde.
Zwischen 1993 und 1997 war Wieskerstrauch stellvertretende Vorsitzende des Verbands deutscher Schriftsteller.
Auch die Bibel kennt kein Pardon gegenüber einer Haltung des Wegsehens. Im Buch der Sprüche wird der Leser an die Allwissenheit Gottes erinnert, der Gleichgültigkeit vergelten wird:
„Rette die, die zum Tode geschleppt werden, und halte die zurück, die zur Schlachtung hinwanken! Wenn du sagst: Siehe, wir wussten nichts davon – meintest du, der die Herzen prüft, merkt es nicht? Und der auf deine Seele achtet, weiß er es nicht und vergilt dem Menschen nach seinem Tun?“ (Sprüche 24, 11–12).
Weder die Gesetzgebung noch die biblischen Gebote sollen hier implizieren, dass eine Nicht-Berichterstattung über „rituelle Gewalt“ automatisch strafbar wäre – weder juristisch noch moralisch. Doch beide erinnern daran, dass die Prinzipien eines funktionierenden Zusammenlebens auf aktiver Verantwortung und Mitgefühl beruhen – nicht auf Unterlassung.
Die Sache mit der Religion
Ein weiterer Aspekt betrifft die kulturelle und religiöse Einordnung. In einer zunehmend säkularen Gesellschaft fällt es vielen Entscheidungsträgern und Medienschaffenden schwer, sich vorzustellen, dass Sexualstraftäter ihr Handeln über quasi-religiöse oder okkulte Ideologien rechtfertigen könnten. Auch gläubige Menschen tun sich oft schwer mit der Vorstellung, dass religiöse Symbole oder Rituale für destruktive Zwecke missbraucht werden.
Um mögliche Täterstrukturen zu verstehen, braucht es daher zumindest ein gewisses Verständnis für Denkweisen, die in okkulten oder pseudoreligiösen Kontexten entstehen können. In manchen Ländern werden entsprechende Praktiken sogar als Teil traditioneller Religionen verstanden – dort fehlt es nicht an Vorstellungskraft, wenn solche Kulte mit kriminellen Handlungen vermischt werden.
Die Geschichte zeigt, dass viele Formen von Gewalt erst spät gesellschaftlich und wissenschaftlich anerkannt wurden. Jahrzehntelang galten etwa sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt oder Menschenhandel als Randphänomene, denen man kaum Glauben schenkte. Erst durch Forschung, Medien und die Stimmen der Betroffenen wurde sichtbar, dass es sich um weitverbreitete, systematische Vergehen handelt.
Auch psychische und emotionale Gewalt oder institutioneller Missbrauch in Kirchen, Heimen und Sportvereinen wurden erst spät als reale Traumata erkannt. In diesem Licht erscheint die Debatte über rituelle oder organisierte Gewalt weniger als Ausnahme, sondern als wiederkehrendes Muster gesellschaftlicher Verdrängung.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

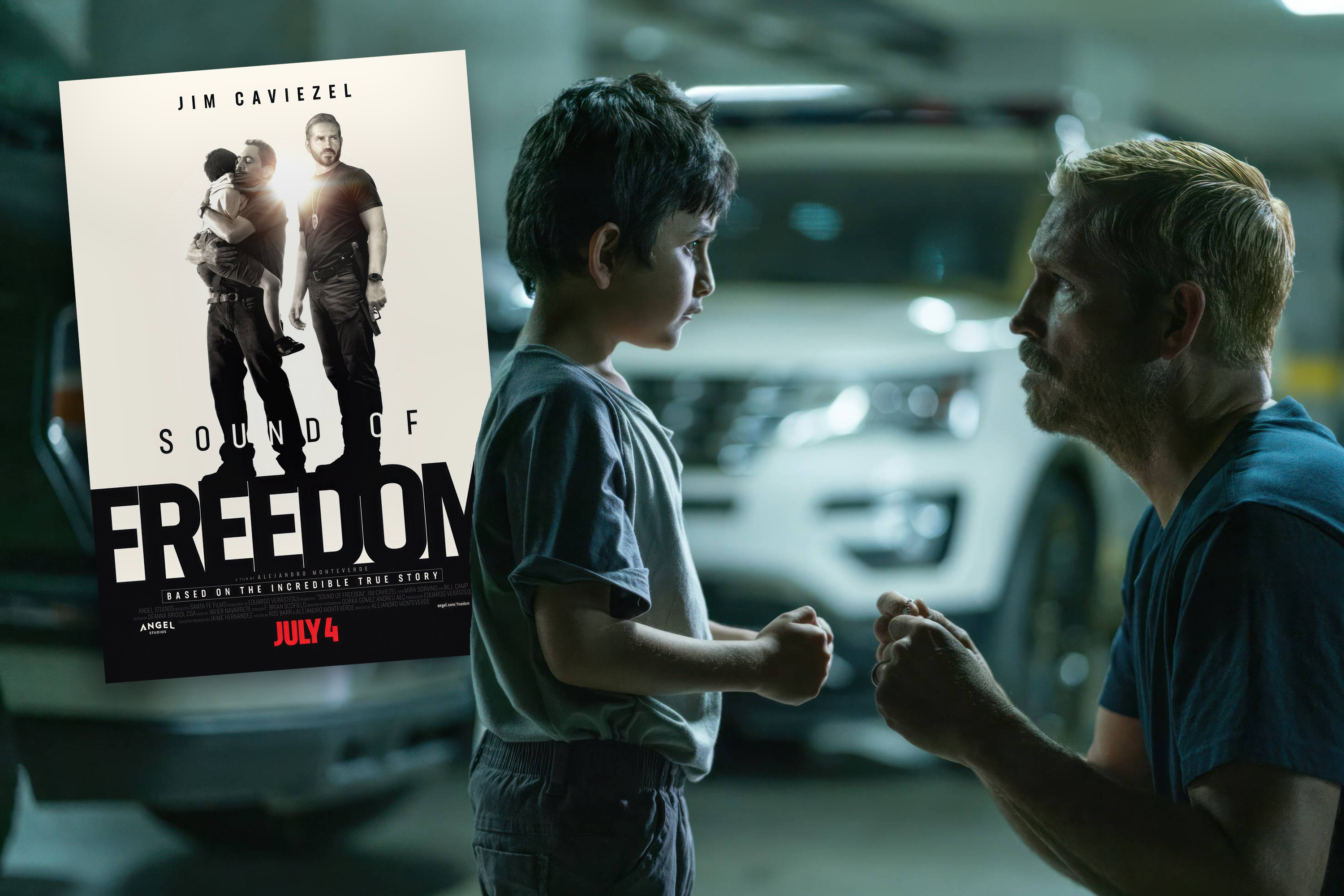



Kommentare
Natürlich sprechen wir hier von Realitäten. Man muss nur die Augen aufmachen. Etwa die Verquickung von Antifa und Satanismus wird in den USA, aber auch in Deutschland immer offensichtlicher. Der Exorzist Gabriele Amorth hat es einmal so gesagt: Das Böse versucht überall dort, wo Macht ausgeübt wird, seinen Einfluss auszuüben. Der primäre Ort der Macht ist natürlich die Politik. Menschen, die ein wenig spirituell sensibel sind, merken es ja auch: Wir haben es hier nicht einfach mit Dummheit oder Inkompetenz zu tun, sondern mit realen dämonischen Einflüssen. Sogar von Nicht-Christen hört man oft solche Aussagen. Es ist deswegen sehr stark davon auszugehen, dass struktureller ritueller Missbrauch mit politischen Verwicklungen existiert.
Die Medien heute arbeiten vor allem visuell. Das heißt, man zeigt etwas. Wie so oft wird aber gerade die Realität nicht gezeigt, sondern vertuscht. Der eigentliche Sinn von Medien und Journalismus wird so auf den Kopf gestellt. Ein bekannter deutscher "Comedian" widmete dem Thema "ritueller Missbrauch" sogar einen eigenen Sendebeitrag. Da sollte dann gezeigt werden, wie lächerlich die ganze Sache doch ist. Das ist leider ein sehr effektiver Psycho-Trick: Derjenige, der die Wahrheit sagt, soll sich lächerlich fühlen. Viele schweigen dann deswegen, weil dieses Gefühl so unangenehm ist. Man sollte sich hiervon aber nicht ins Bockshorn jagen lassen. Es ist so, wie Inge Thürkauf es einmal gesagt hat: "Als Christen heute müssen wir die Angst verlieren, uns lächerlich zu machen."
Danke für den Hinweis, ich werde mir den Film ansehen.
Das Thema ist schwierig ähnlich wie das Thema Entführung durch Außerirdische, auch da sind Implantate vorhanden, aber die Leute werden nicht ernst genommen, was für das Thema ritueller Missbrauch eine Katastrophe war ist das was man in den USA in den 1980 Jahren Satanic Panic nannte, dieses durch Therapeuten befeuerte Phänomen in Hypnose Erinnerungen zutage zu fördern hat so skurrile Aussagen hervorgebracht wie Johannes Paul II. sei an solchen Ritualen beteiligt gewesen.
Leider haben viele Bücher zum Thema ritueller Missbrauch wie "Einmal Hölle und zurück" oder das Buch "Schwarzbuch Satanismus" dem Thema immens geschadet. Es steht zu hoffen, dass man das Leid dieser Menschen ernst nehmen wird und man endlich einmal einen Fall wirklich beweisen kann.
Ausgewogener Beitrag zu einem sehr schwierigen und kontroversen Thema
Ich empfehle Jedem den Film anzuschauen und zwar gibt es im Frühjahr 2026 eine zweite Tournee. Der Film ist komplett ausgewogen und neutral gestaltet und zeigt ein breites Spektrum an verschiedenen Standpunkten und Meinungen auf. Daher bevor Urteile gefällt werden - schaut ihn Euch an.