Gleichmacherei statt Gleichheit

Das Schweizer Bundesgericht hat entschieden: Die Studentenverbindung Zofingia diskriminiert Frauen, weil die Männer unter sich bleiben wollen. Das sei unzulässig, weil Zofingia „wichtige Netzwerke“ für die berufliche Karriere biete.
Was auf den ersten Blick nach einem Sieg für die Gleichberechtigung aussieht, ist in Wahrheit ein weiterer Schritt in Richtung einer Gesellschaft, die Freiheit mit Zwang verwechselt.
Das Gericht anerkennt in seinem Urteil zwar, dass private Vereinigungen grundsätzlich bestimmen dürfen, wen sie aufnehmen. Das Geschlecht, das Alter, Ausbildung und Beruf: Jeder Verein kann seine eigenen Regeln aufstellen. Aber – und hier liegt der Knackpunkt – wenn eine solche Vereinigung „entscheidende Bedeutung für die berufliche und gesellschaftliche Integration“ habe, dürfe sie niemanden ausschließen.
Zum Hintergrund: Die Zofingia, in voller Länge „Schweizerischer Zofingerverein“, ist eine nichtschlagende Studentenverbindung, die auf über 200 Jahre zurückblicken kann. Es gab sie schon, als 1848 der moderne Bundesstaat Schweiz entstand – und trug zu diesem wie viele andere Vereine maßgeblich bei. Damit gewann sie auch Einfluss. Es gab Zeiten, da bestand ein Viertel des eidgenössischen Parlaments aus Zofingia-Mitgliedern. Auch im Bundesrat, der Regierung, saßen immer wieder Farbenträger der Verbindung.
Zu erfolgreich geworden
Es war also eine Kaderschmiede, deren Einfluss dann allmählich zurückging, die aber nach wie vor Netzwerkqualitäten aufweist. Man kennt sich untereinander, man fördert sich gegenseitig. Das soll der Zofingia nun zum Verhängnis werden. Das Bundesgericht urteilt, es sei unzulässig, Frauen aus diesem Netzwerk auszuschließen, deshalb müssten auch sie aufgenommen werden.
Man kann es auch anders ausdrücken: Wer erfolgreich ist, verliert das Recht, seine eigenen Regeln zu machen. Das ist eine gefährliche Logik.
Denn was heißt das konkret? Wenn morgen ein Frauennetzwerk entsteht, das Juristinnen miteinander verbindet und ihnen zu großen Karrieresprüngen verhilft, dürfen dann Männer klagen, weil sie ausgeschlossen werden? Wohl kaum. Solche Netzwerke gelten dann als „förderlich für benachteiligte Gruppen“.
Wenn ein LGBTQ+-Verband eine interne Business-Plattform gründet, dürfen heterosexuelle Bewerber dann auf Aufnahme pochen? Natürlich nicht. Auch hier würde man sagen: Die Exklusivität erfüllt einen wichtigen sozialen Zweck.
Nur bei traditionellen, bürgerlichen Strukturen wie Zofingia gilt plötzlich: Ihr dürft nicht unter euch bleiben.
Warum nicht selbst aktiv werden?
Dabei geht es hier nicht um Diskriminierung im Sinne von Benachteiligung. Niemand hindert Frauen daran, selbst Verbindungen oder Netzwerke zu gründen. Sie dürfen sich organisieren, dürfen Mitgliedschaften anbieten, dürfen einflussreiche Plattformen schaffen – genau wie es Männer in der Zofingia einst taten. Das erfordert natürlich Arbeit und Zeit. Aber warum soll ein Netzwerk, das über 200 Jahre lang ausschließlich von Männern aufgebaut wurde, nun plötzlich Frauen offenstehen, die sich damit ins gemachte Nest setzen können?
> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Es gibt auch in der Schweiz kein Grundrecht auf Anschluss an ein bestehendes Netzwerk. Solche entstehen aus Initiative, Vertrauen, gemeinsamen Werten und manchmal auch aus der Entscheidung, unter sich bleiben zu wollen. Die Freiheit, sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen, verliert ihren Sinn, wenn man gezwungen wird, jeden aufzunehmen, der Zugang haben möchte. Das ist keine Gleichberechtigung. Das ist Gleichmacherei.
Man kann die Entscheidung der Zofingia, Männer zu bevorzugen, sympathisch finden oder nicht. Aber sie ist Ausdruck der Vereinsfreiheit. Und genau diese Freiheit ist es, die unsere pluralistische Gesellschaft ausmacht. Sie ermöglicht Vielfalt – nicht, indem sie alles vereinheitlicht, sondern indem sie Unterschiede zulässt.
Aufruf zum bequemen Leben
Das Bundesgerichtsurteil setzt einen gefährlichen Präzedenzfall. Es sagt in letzter Konsequenz: Sobald ihr Erfolg habt, gehört ihr der Allgemeinheit. Dann verliert ihr das Recht, euch eure Mitglieder auszusuchen. Das ist Enteignung auf sozialer Ebene.
Statt Vielfalt zu fördern, zwingt der Staat alle, nach dem gleichen Muster zu handeln. Und anstatt Frauen zu ermutigen, eigene erfolgreiche Netzwerke zu schaffen, vermittelt man ihnen die Haltung: Fordert den Zugang zu bestehenden Strukturen ein, statt selbst welche aufzubauen. Mit anderen Worten: Macht es euch einfach.
Das ist keine Emanzipation. Das ist bequem. Und es schwächt am Ende genau jene Gruppen, die man angeblich stärken will.
Die Schweiz war immer stark darin, Freiräume zu schützen. Ob das nun Schützenvereine, Frauenchöre, Studentenverbindungen oder Berufsfrauennetzwerke waren. Diese Vielfalt ist kein Problem – sie ist das Fundament einer offenen Gesellschaft.
Wenn wir beginnen, Erfolge zu bestrafen und Vereinsfreiheit zur hohlen Phrase zu machen, dann verlieren wir genau das, was unsere Gesellschaft stark gemacht hat: die Freiheit, Unterschiede zuzulassen. Und die Freiheit, eigene Wege zu gehen – statt fremde Pfade zu erzwingen.
> Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

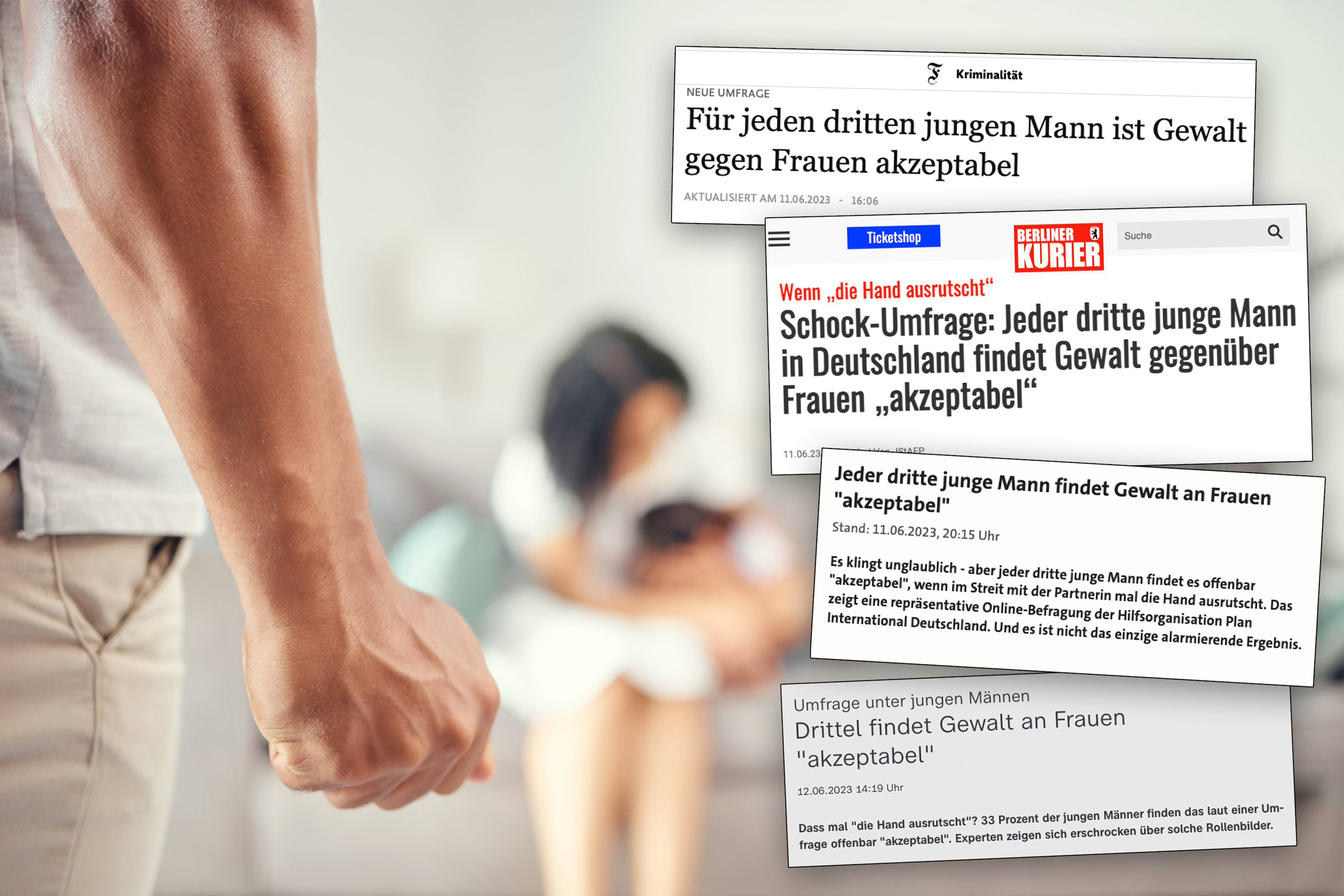
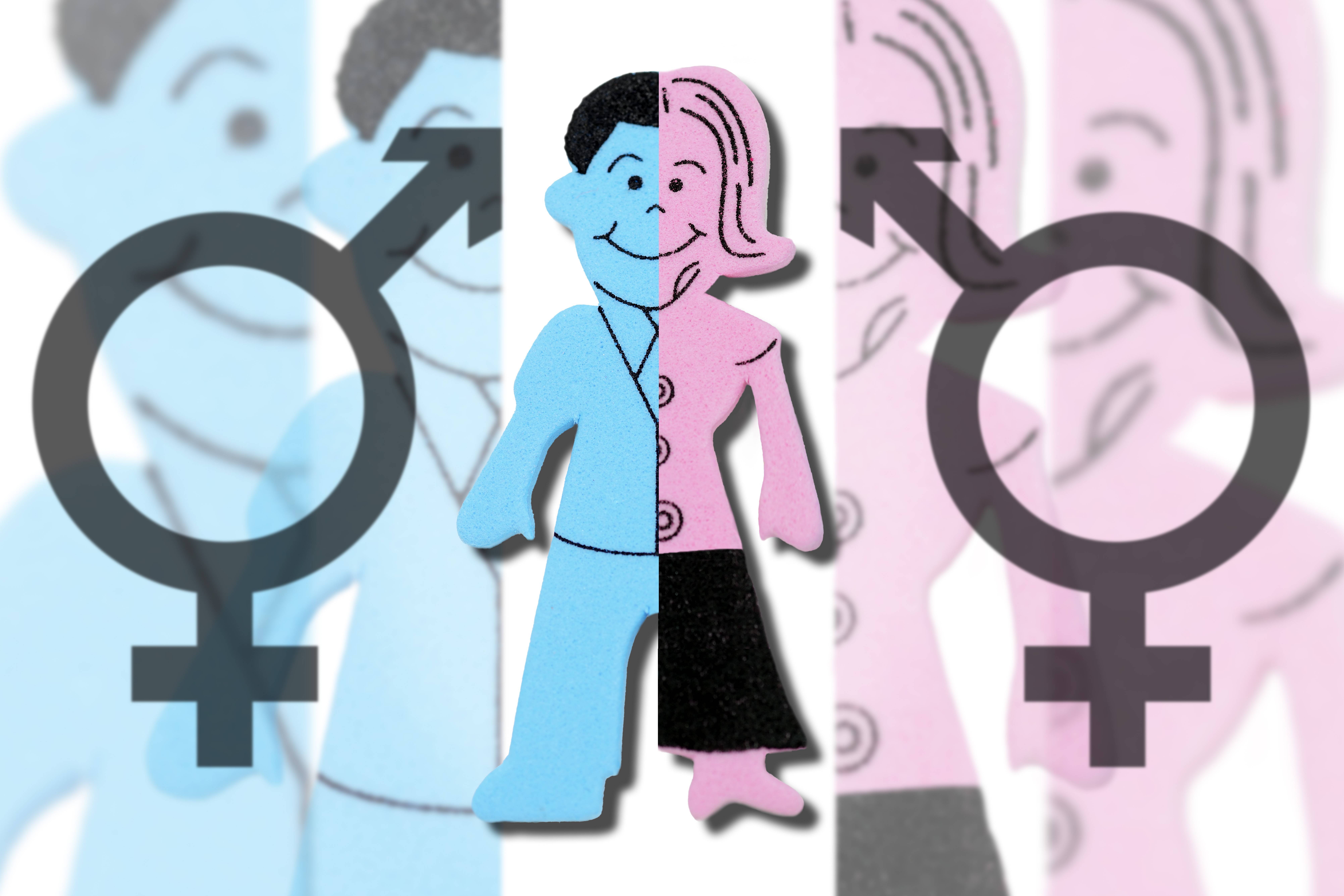

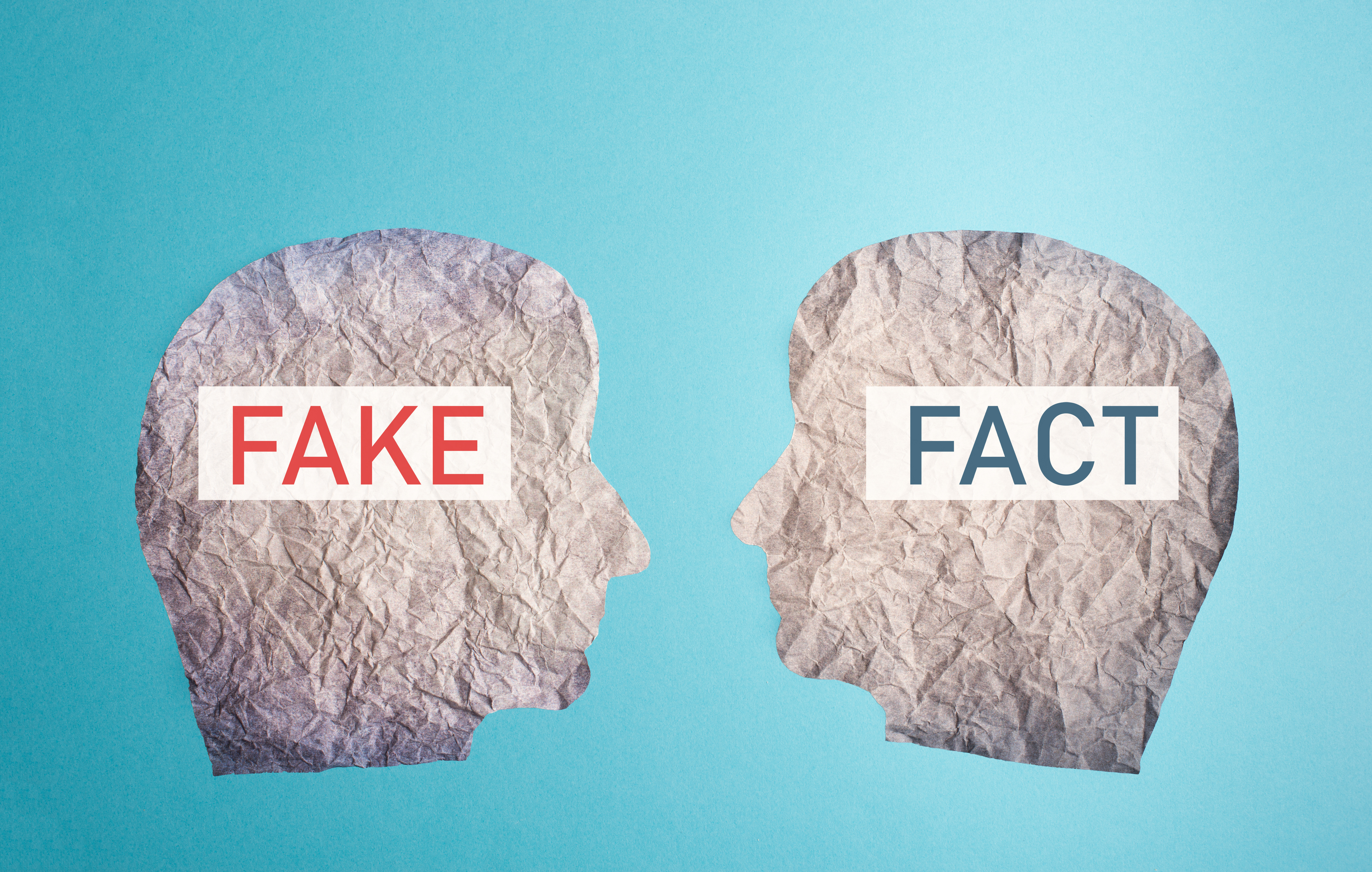
Kommentare
Die Erfahrung sagt, dass die Berichterstattung über Gerichtsurteile (womöglich aus zweiter oder dritter Hand) meist herzlich wenig damit zu tun hat, was tatsächlich drinsteht.
Wie immer dem aber auch in diesem Fall sei: Sagen Sie doch ganz ehrlich, welche Position Sie wirklich für die Frau in der Gesellschaft vorsehen, Herr Millius. Zu sagen, die Frauen sollten sich doch bitte selber ihre Netzwerke bilden und sich nicht ins gemachte Nest setzen, während die alten Herren aus der Verbindung quasi schon überall herum sitzen, ist angesichts der Realität in Politik und Wirtschaft maximal unaufrichtig. Dafür muss man sich nicht das Schlagwort "Feminismus" auf die Stirn pappen oder auf irgendwelche kulturmarxistische Richter zeigen, sondern das versteht man auch als Katholik. Wenn man denn will.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei dem Urteil nur darum, dass die Verbindung an der Uni in Lausanne keine Räume mehr bekommen darf, wenn sie sich nicht für Frauen öffnet. Damit würde der Uni Leitung recht gegeben. Als Präzedenzfall können nun auch andere Unis solche Regeln einführen, was nur dazu führt, dass diese Veranstaltungen in anderen Lokalen stattfinden werden.
Das Resultat ist, dass die Uni-Kultur noch einseitiger nach links verschoben wird. Das ist keine wirklich erstrebenswerte Entwicklung.
Was an einem Verein ohne Frauen interessant sein soll, habe ich bei der Verbindungsvereinsmeierei sowieso nie verstanden.