Kinder als Projekt

Vor fast genau acht Jahren berichtete das Nachrichtenportal Swissinfo über ein lesbisches Paar, das sich den Kinderwunsch erfüllt hatte. In anklagend klingenden Worten wurde das Schicksal der beiden Frauen beschrieben. Wie ihnen der Staat und die Rechtslage Knüppel zwischen die Beine warfen, wie sie nur mit komplizierten Kunstgriffen Nachwuchs bekommen konnten. Damals hatten homosexuelle Paare kein Recht auf Zugriff zu Fortpflanzungsmedizin; 2022 wurde ihnen die Möglichkeit eingeräumt, zu Samenspenden zu greifen.
Der Titel des Beitrags ist im Nachhinein schon fast prophetisch. Er lautete: „Unser Sohn kam mit FedEx und nicht mit dem Storch.“ Inzwischen klingt die Geschichte, die 2017 wohl viele Leser berührte, in der Tat eher wie ein Rechtsstreit um ein falsch zugestelltes Paket. Einer, mit dem sich nun sogar das Bundesgericht befassen muss. Es geht um eine zerbrochene Liebe und Kinder – inzwischen kam ein zweites dazu – die darunter leiden.
Eine Familie um jeden Preis
Das kann ohne Frage auch in einer „klassischen“ Beziehung passieren. Aber die Fehde wird hier zum Präzedenzfall, weil nun darum gestritten wird, wer wie viel „Mutterrechte“ an welchem Kind hat. Es wird das abschließende Urteil in einem „Familienprojekt“ sein. So bezeichnen die beiden Frauen das Ganze laut Medienberichten selbst.
Vor Jahren kaufte das Paar bei einem Anbieter in Dänemark eine Samenspende und reservierte sicherheitshalber gleich fünf weitere desselben Spenders. Das erste Kind kam, als alles noch gut lief. Die zweite Befruchtung nahmen sie vor, als die Beziehung bereits zerrüttet war. Das Kind kam 2018 zur Welt.
Denn, so die These: Man muss sich ja für ein gemeinsames „Projekt“ nicht zwingend lieben. Die Kinder, so erklären die Frauen, wüssten, dass sie nichts mehr verbinde. Oder anders ausgedrückt: Sie können inzwischen erahnen, dass sie das Ergebnis eines „Projekts“ sind. Eines, das sich wohl am besten mit „eine Familie um jeden Preis“ beschreiben lässt.
Ein Fall von „Diskriminierung“?
2020 ging die Beziehung dann vollends in die Brüche. Mit dem Ergebnis, dass nun Richter entscheiden müssen, welche Rolle diejenige Frau spielen soll, die das zweite Kind nicht zur Welt gebracht hat; sie möchte es adoptieren, was ihr die Ex-Partnerin verwehren will. Ein Fall von Diskriminierung, findet die Frau, die um das Adoptionsrecht kämpft. Denn in einer heterosexuellen Beziehung wäre sie nun als Mutter anerkannt.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Das ist sicherlich richtig. Nur hätte sie es in einer solchen Beziehung auch selbst zur Welt gebracht. Der Fall zeigt, was passiert, wenn man glaubt, in einer rechtlich nicht eindeutigen Konstellation auf dem bestehen zu können, was in der traditionellen Rechtsprechung klar geregelt ist. Das Paar hatte die Partnerschaft nie eintragen lassen. Deshalb lassen sich nicht automatisch bekannte Rechte ableiten.
Das Bundesgericht wird klären müssen, ob für die Frau, die das Kind nicht zur Welt gebracht hat, ein Recht auf persönlichen Kontakt zu diesem besteht. Eines der Kriterien: Es muss dem Kindeswohl dienen. Aber lässt sich juristisch klären, was das Beste für ein Kind ist, das von Anfang an Teil eines „Projekts“ war?
Als wäre es eine Modelleisenbahn
Es ist für viele eine schöne Vorstellung, eine Familie zu haben. Nicht immer klappt das – auch in heterosexuellen Beziehungen. Hier wollten sich zwei Frauen diesen Wunsch erfüllen, für den sie die biologischen Voraussetzungen nicht erfüllten. Mit Kniffs und der Hilfe eines Lieferdienstes mitsamt Umleitung des Pakets auf rechtlich sicheren Boden und etwas Schmuggelaufwand schafften sie es dennoch. Mit dem Ergebnis, dass nun das Bundesgericht darüber entscheiden muss, wie es weitergeht.
Entscheidend könnte die Ausgangslage bei der zweiten Befruchtung sein. Die austragende Frau sagt, das Kind sei „ihr persönliches Projekt“ gewesen. Ihre damalige Partnerin spricht von einem „gemeinsamen Projekt“. Die Wortwahl enthüllt viel. Es klingt, als hätte ein Paar im Keller eine gemeinsame Modelleisenbahn aufgebaut und streite nun nach der Trennung darum, wer künftig damit spielen darf.
Wer gemeinsame Kinder als Projekt begreift, und das sogar noch, wenn die Beziehung bereits zerrüttet ist, macht sich wohl nicht übermäßig viele Gedanken über deren Wohl. Es geht um die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Das mag auch bei vielen Paaren in einer traditionellen Konstellation der Fall sein; es ist nicht selten, dass zerstrittene Paare versuchen, auf diese Weise zu retten, was zu retten ist. Aber das ist eher ein Akt der Verzweiflung als eine gezielte Projektarbeit.
Kinder als Opfer eines „Projekts“ - und das ein ganzes Leben lang
Dass das höchste Gericht der Schweiz den weiteren Verlauf eines Vorgangs einer von Beginn an als „Projekt“ betitelten Zeugung bestimmen muss, zeigt, welche Türen aufgestossen werden beim Versuch, alles, was technisch möglich ist, auch zuzulassen. Der aktuelle Fall dürfte nicht der letzte sein.
Dereinst werden die betroffenen Kinder in einem Alter sein, in dem sie nachlesen können, was ihre ursprüngliche Bestimmung war: Teil eines Projekts zu sein. Vielleicht ist das bei einigen von uns auch der Fall. Nur müssen die meisten nicht damit leben, dass das sogar offiziell gerichtlich festgestellt wird.


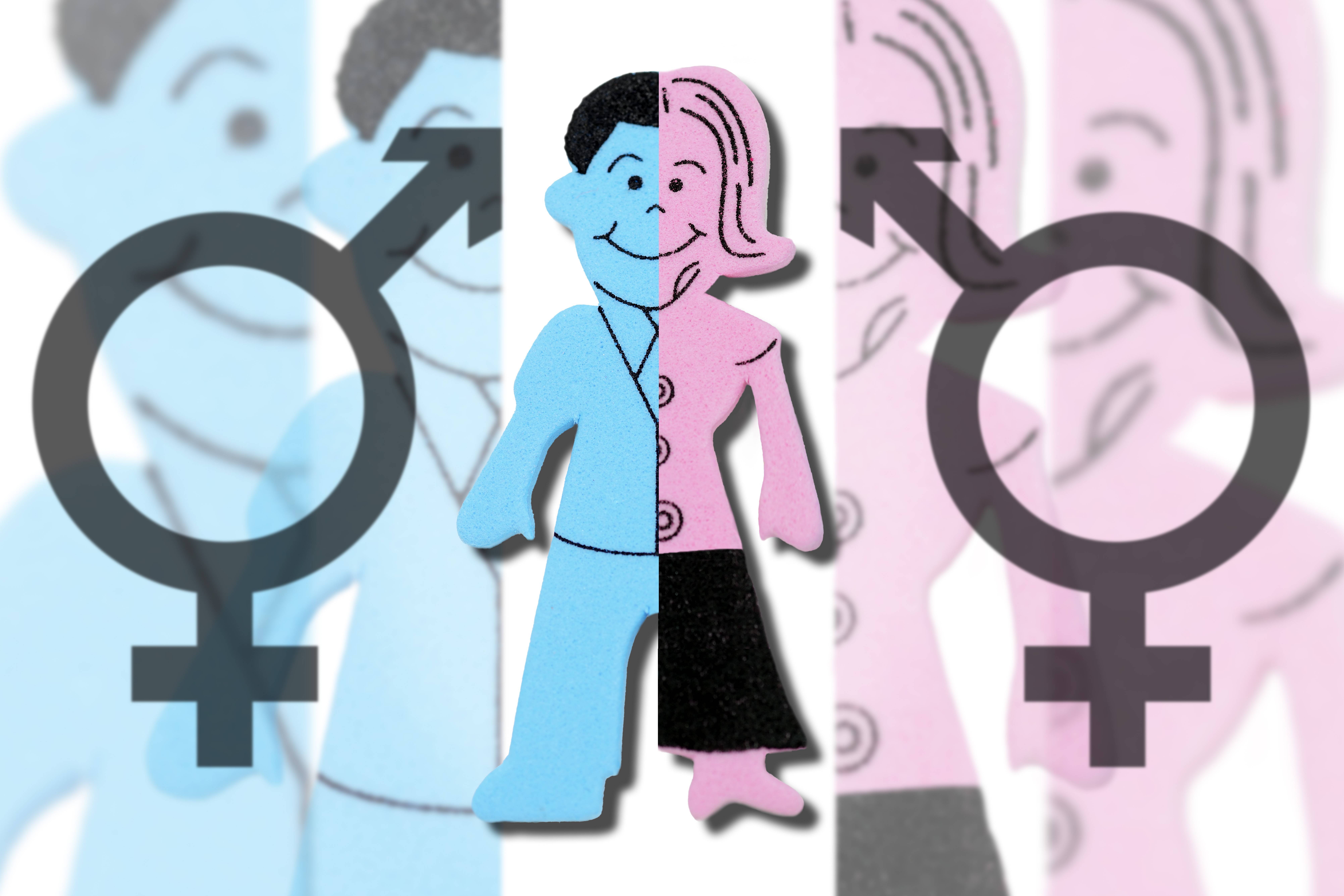


Kommentare
Was soll dieser Artikel aussagen? Zahlreiche Sorgerechtsstreitfälle bei Heterosexuellen Paaren belegen, dass es da auch nicht besser läuft.
Sich dabei an einer Formulierung abzuarbeiten ist nicht zielführend und hinterlässt einen leicht braunen Geschmack beim Lesen.
Der Gesetzgeber hat die Rechtsnormen so anzupassen, dass solche Problemen minimiert werden.