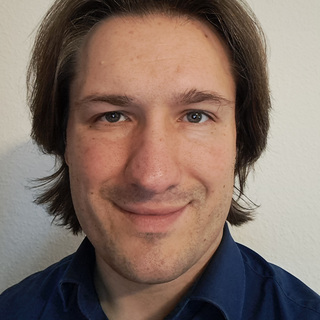Tugend will gelebt werden

In den letzten Jahren ist Virtue Signalling – das öffentliche Zurschaustellen der eigenen moralischen Aufrichtigkeit – zu einer beliebten Tätigkeit online wie offline geworden, häufig in Kombination mit Gratismut.
Dieser Trend enthält Licht und Schatten. Positiv muss man hier festhalten, dass „Virtue“ – also zu Deutsch „Tugend“ – wieder ein gesellschaftliches Thema geworden ist. Lange Zeit herrschte doch eine von Papst Benedikt XVI. als „Diktatur des Relativismus“ gegeißelte ethische Beliebigkeit, in der Werturteile verpönt waren.
Virtue Signalling ist ein Zeichen dafür, dass der gesellschaftliche Wind im Drehen begriffen ist. So ganz verschwunden ist der emotivistische Relativismus, nachdem die eigenen emotionalen Befindlichkeiten die einzige Richtschnur für die je eigene Wahrheit sind, die bitte ja nicht in Frage gestellt werden darf, noch nicht. Doch das Bewusstsein dafür, dass eben doch nicht alles beliebig, gleich-gültig ist, wächst.
Haben oder Sein?
Dies lässt sich auch noch in einer weiteren Hinsicht beobachten. Tugenden existieren nicht losgelöst in einem luftleeren Raum. Sie sind verknüpft mit Vorstellungen von einem guten Leben, denn ihr Vorhandensein ist Voraussetzung für das gutes Leben. Die Vorstellung, die man von einem guten Leben hat, bestimmt also, welche Tugenden man für erforderlich hält. Die Aussage „Geiz ist geil!“ signalisiert: Ich begreife Geiz als eine Tugend.
Zugrunde liegt dem eine Vorstellung vom guten Leben, das sich über das Haben, das Besitzen definiert, nicht über das Sein. Nur vor diesem Hintergrund wird verständlich, weshalb Geiz eine Tugend sein soll. Gerechtigkeit ist dann eine Tugend, wenn man den Menschen als soziales Wesen begreift, zu dessen gutem Leben es gehört, in Beziehungen zu leben; Beziehungen, die es für ihr Aufblühen brauchen, dass die an ihr Beteiligten miteinander gerecht umgehen.
Das Konzept eines guten Lebens ist im Abendland seit Aristoteles bekannt. In den letzten Jahren hat es gerade in politisch eher linksgerichteten Kreisen, aus Lateinamerika als „buen vivir“ (re)importiert, wieder neuen Anklang gefunden.
Dass Tugend und die Suche nach dem guten Leben wieder en vogue sind, ist ein gutes Zeichen, wobei über die Frage, worin das gute Leben besteht und welche Tugenden es hierfür braucht, sicher noch gestritten werden muss.
Soziale Praktiken und Strukturen prägen unser Denken und Tun
Der angesprochene Schatten liegt mehr im zweiten Teil des Begriffes „Virtue signalling“. Es ist durchaus ein Defizit dieses Trends und symptomatisch für die Internetkultur, in der er seinen Ausgang nahm, dass es mehr auf Optik und Performance ankommt als auf Substanz, mehr auf Schein als auf Sein. Tugend will nicht so sehr, ja eigentlich überhaupt nicht, gezeigt, sondern gelebt werden. Es ist der Unterschied zwischen einem guten Leben und einem nur dem Schein nach guten Leben.
Hierbei muss aber bedacht werden, dass auch die relativistische Vergangenheit beileibe nicht so wertneutral war, wie sie sich gab. Soziale Praktiken und Strukturen prägen unseren Charakter. Ihnen liegt eine unausgesprochene Vorstellung vom guten Leben zugrunde und diese kommunizieren sie auch: „Seht her, so handelt man – und nicht etwa anders“, sagen sie Teilnehmern wie scheinbar unbeteiligten Beobachtern. Auf diese Weise stabilisieren sie sich und lehren zugleich die Menschen eine bestimmte Sicht auf sich selbst und die Welt.
Zum Beispiel kann man fragen, ob nicht ein renditegetriebenes Wirtschaftssystem daran gewöhnt, alle Bereiche des Lebens, zum Beispiel auch die eigene Ehe, unter Renditegesichtspunkten zu bewerten und den Ehepartner „abzustoßen“, wenn er nicht mehr hinreichend Rendite abwirft. Das soll explizit nicht heißen, dass Menschen im Vorfeld einer Scheidung tatsächlich bewusst eine Renditeberechnung anstellen würden (wobei man es leider auch nicht ausschließen kann). Die Gefahr besteht eher darin, dass durch Gewöhnung die dahinterstehende Logik so natürlich und selbstverständlich erscheint, dass sie die Entscheidungsfindung wie von selbst lenkt, ohne dass man sie hinterfragt.
Genauso kann eine Situation, in der man (fast) alles kaufen kann, es früher oder später plausibel erscheinen lassen, dass nichts dagegenspricht, sich auch Sex oder ein Kind zu kaufen.
Andere Verhaltensweisen einüben
Eine Kultur des Lebens wird wohl eher weniger durch eine soziale Praxis des Kaufens und Verkaufens gefördert. Das soll nicht heißen, dass man auf diese Praxis verzichten sollte. Eher wird dies aber wohl eine soziale Praxis des Schenkens leisten. Eine solche kann sicher nicht von oben verordnet werden. Und ebenso sicher darf sie nicht verwechselt werden mit staatlicher Umverteilung – einem „Geben aus Pflicht“, wie Papst Benedikt XVI. es in „Caritas in Veritate“ (Abschnitt 39) nannte.
Aber zweifellos braucht eine soziale Praxis des Schenkens, so sie denn charakterbildend sein soll, Strukturen, in denen sie sich entfalten kann. Wo Staat und Markt sich den sozialen Raum untereinander aufteilen, bleibt für eine soziale Praxis des Schenkens kaum noch Platz (vgl. auch hier wieder „Caritas in Veritate“, 39).
Eine soziale Praxis des Schenkens meint alles, was unentgeltlich erfolgt. Bereiche, in denen eine solche Praxis bereits heute gelebt wird – abgesehen von Ehe und Familie, in der sie, idealerweise zumindest, das gesamte alltägliche Miteinander durchziehen –, finden sich etwa in der IT, wo Anwender Free and Open Source Software, wie das Betriebssystem Linux, weltweit kostenlos nutzen und unentgeltlich weiterentwickeln.
Im analogen Leben wäre etwa an die solidarische Landwirtschaft zu denken. Hier bezahlen die Mitglieder nicht einen durch den Markt definierten Preis für ein bestimmtes Produkt. Stattdessen sichert eine Gemeinschaft dem Landwirt zu, dessen (voraussichtliche) Kosten für ein Jahr zu decken, und erhält dafür die entsprechenden Erträge, die aber natürlich in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren können.
Tugenden fördern, Lastern entgegenwirken
Für eine Praxis des Schenkens im Unterschied zu einer Praxis des Kaufens ist hier entscheidend, dass Geldzahlung und Umfang der Leistung voneinander entkoppelt werden. Das heißt: Die Geldzahlung erfolgt unabhängig davon, dass überhaupt irgendeine Leistung zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich erbracht wird. Das Geld wird erst einmal sozusagen geschenkt. Falls der Landwirt hierzu später in der Lage ist, „schenkt“ er später dafür seine Erträge zurück. In manchen „Solawis“ wird der Schenkcharakter noch zusätzlich dadurch betont, dass Mitglieder unentgeltlich auf dem Bauernhof aushelfen.
Noch ein weiteres Beispiel hierfür, wie soziale Praktiken den Charakter formen: Die Verfügbarmachung von Verhütungsmitteln senkt die Hemmschwelle für das Eingehen sexueller Beziehungen und begünstigt damit das Laster der Unkeuschheit – mit potentiell tödlichen Folgen.
Unsere sozialen Praktiken und Strukturen können uns also entweder zu Lastern oder zu Tugenden erziehen. Was es daher eigentlich bräuchte, wäre ein Virtue Mainstreaming: eine Anpassung unserer sozialen Strukturen und Prozesse, so dass sie Tugenden fördern und Lastern entgegenwirken. Gesetzesvorhaben sollten daher, wie es bereits beim Gender Mainstreaming im Hinblick auf die Geschlechter geschieht, standardmäßig auf ihre Auswirkungen auf das Tugendleben der Menschen – beispielsweise hinsichtlich der Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Besonnenheit – überprüft und gegebenenfalls abgeändert oder ganz verworfen werden.
Was ist ein gutes Leben, welche Tugenden erfordert es?
Gesetzesvorhaben, die den Einzelnen beispielsweise von den negativen Konsequenzen seiner Handlungen abschirmen, begünstigen etwa unkluge Entscheidungen – und machen infolge dann auch unklug. Maßnahmen, die zur Folge haben, dass – wie man so schön sagt – Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden, begünstigen das Laster des Wagemuts und wären damit abzulehnen.
Auf der anderen Seite können auch bestehende Praktiken und Strukturen auf ihre Auswirkungen auf das Tugendleben überprüft und daraus neue Gesetzesvorhaben abgeleitet werden, die auf eine Stärkung des Tugendlebens zielen, etwa durch die Einschränkung des Zugangs zu Verhütungsmitteln.
Bevor man zum Virtue Mainstreaming schreiten kann, muss man natürlich zunächst einmal darüber Klarheit erlangt haben, was ein gutes Leben beinhaltet und welche Tugenden es überhaupt erfordert. Hierüber muss man diskutieren. Die Zeiten dafür waren schon lange nicht mehr so gut wie heute.