„Meinungsfreiheit stirbt nicht am Verbot, sie verdorrt im Klima der Selbstzensur“

Jakob Schirrmacher treibt eine Sache besonders um: die Verteidigung der Meinungsäußerungsfreiheit. Und die steht, das wird der Sohn des legendären FAZ-Herausgebers Frank Schirrmacher nicht müde zu sagen, unter gehörigem Druck von einem Komplex aus Politik, Technologieunternehmen, Medien und sogenannten Nichtregierungsorganisationen.
Unter dem Vorwand des Kampfes gegen Desinformation würden zusehends legitime Meinungsäußerungen verdrängt und unterdrückt. Prominente Fälle schaffen es in die Medien, zumeist liberal-konservative. Doch während es auf der anderen Seite rund 100 NGOs gebe, die sich gegen „Hass und Hetze“ im Internet starkmachen, fehle es an einer organisierten Gegenbewegung, die sich für Meinungsfreiheit einsetze. Bisher.
Denn am vergangenen Wochenende hat ein neuer Verein das digitale Kampffeld betreten. Jakob Schirrmacher hat zusammen mit prominenten Streitern gegen die schleichende Verengung des Sagbaren den Verein „Free Speech Aid“ gegründet. Mit dabei: Don Alphonso, Joana Cotar und Tom Bohn. Im Corrigenda-Interview spricht Schirrmacher darüber, wie die heutige Zensurpolitik ganz ohne Verbote wirke, was man dagegen tun könne und warum es dabei um nichts weniger als die Demokratie gehe.
Herr Schirrmacher, Sie haben vor wenigen Tagen zusammen mit Mitstreitern den Verein „Free Speech Aid“ ins Leben gerufen. Auf der Website heißt es: „Wir dokumentieren Zensurmaßnahmen, analysieren ihre Mechanismen – und unterstützen Menschen, deren Grundrecht auf freie Meinungsäußerung bedroht ist.“ Ist die Meinungsäußerungsfreiheit wirklich bedroht? Wenn man in die sozialen Medien blickt, hat man den Eindruck, die Menschen äußerten sich so frei wie nie.
Die vielzitierte Freiheit, sich „so frei wie nie“ zu äußern, ist eine trügerische Freiheit. Sie meint die technische Möglichkeit, nicht die soziale oder institutionelle Erlaubnis. Wir erleben heute einen paradoxen Zustand: Nie war es einfacher, öffentlich zu sprechen – und nie war die Angst größer, das Falsche zu sagen. Die eigentliche Bedrohung geht nicht mehr von einem klassischen Zensor aus, sondern von einem dichten Netz aus informellen Sanktionen, Plattformrichtlinien, politischen Anreizen, algorithmischer Sichtbarkeitssteuerung und einem moralischen Klima, das Nonkonformität mit Abweichung verwechselt. Die Meinungsfreiheit stirbt nicht an einem Verbot – sie verdorrt im Klima der Selbstzensur.
Im Grundgesetz steht: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ Wollen Sie damit sagen, ausgerechnet die Politiker verletzten dieses grundgesetzlich garantierte Recht?
Politiker, die sich auf den Wortlaut des Grundgesetzes berufen, müssen sich auch an dessen Geist messen lassen. Wenn dieselben politischen Akteure Gesetze erlassen, die „Desinformation“ oder „digitale Gewalt“ bekämpfen sollen – und damit Plattformen verpflichten, Inhalte zu löschen –, dann ist das eine Delegation der Zensur. Sie findet nicht direkt statt, sondern ausgelagert, subtilisiert und technokratisch codiert. Das Grundgesetz schützt nicht nur vor einem Redeverbot per Gesetz – es schützt vor einem Klima, in dem nur noch die Mehrheitsmeinung legitime Existenzberechtigung hat.
„Demokratie lebt nicht vom Schutz sensibler Seelen, sondern von der Konfrontation“
Der Name „Free Speech Aid“ erinnert an „HateAid“, eine Organisation, die auch schon mal gegen Meinungsfreiheit vorgeht. Doch auch sie gibt vor, Menschenrechte im Internet zu schützen. Was unterscheidet Ihren Verein von „HateAid“?
HateAid stellt sich auf die Seite derer, die sich durch Sprache bedroht fühlen. Free Speech Aid stellt sich auf die Seite derer, deren Sprache als Bedrohung dargestellt wird. Die Grenze ist schmal – aber entscheidend. Wir treten nicht für Beleidigung ein, sondern für das Recht, nicht automatisch als Täter zu gelten, nur weil man eine unbequeme Meinung äußert.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Während HateAid die Logik des Schutzes verinnerlicht hat, vertreten wir die Logik der Robustheit: Demokratie lebt nicht vom Schutz sensibler Seelen, sondern von der Konfrontation widerstreitender Weltbilder.
Sie haben vor kurzem ein Buch über Desinformation veröffentlicht. Darin warnen Sie vor der Gefahr, dass der Kampf gegen Desinformation zur Zensur wird. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen legitimer Moderation und unzulässiger Einschränkung der Meinungsfreiheit?
Moderation ist notwendig – Zensur beginnt dort, wo die Moderation politisch wird. Eine Plattform darf Spam löschen, Pornografie verstecken, Drohungen filtern. Aber wenn sie beginnt, Meinungen zu klassifizieren, Narrative zu bevorzugen, „Fakten“ exklusiv zu definieren und dabei mit Regierungen, Trusted Flaggern und NGOs kooperiert, dann verlässt sie den Boden der Neutralität. Dann wird aus Content-Moderation ein Regime der diskursiven Steuerung.
Nennen Sie uns bitte ein Beispiel.
Nehmen Sie den Fall der Depublizierung eines Textes von Maxim Biller in der Zeit. Oder die Hausdurchsuchung wegen eines Tweets, den netzpolitik.org jüngst dokumentiert hat. Oder das staatlich geförderte Netzwerk von Trusted Flaggern in der EU, die mit dem Segen der Kommission Inhalte melden, die „nicht illegal, aber schädlich“ sind. Es ist ein Ökosystem der Mikrozensur entstanden, das sich nicht wie ein Verbot anfühlt – aber wirkt wie eines.
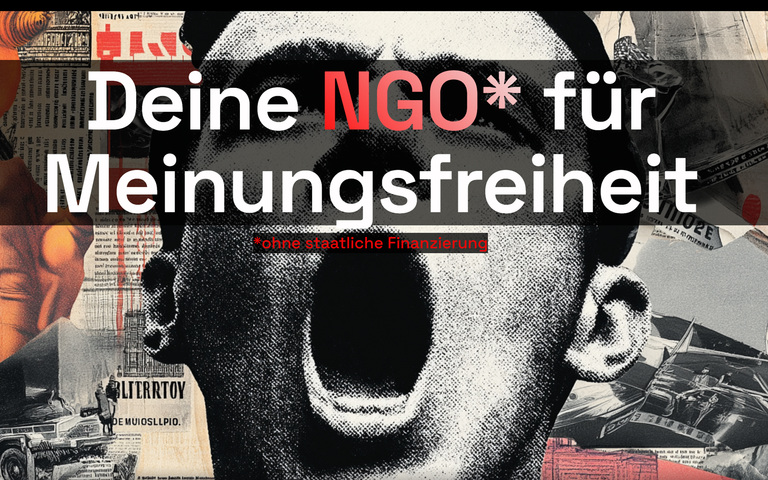
Im Buch sprechen Sie vom „Censorship Industrial Complex“. Was meinen Sie damit?
Der Begriff beschreibt ein systemisches Geflecht aus Regierungen, Technologieunternehmen, NGOs, Medien und sogenannten Faktenprüfern, das vorgibt, die Demokratie zu schützen – und in Wirklichkeit ihre Grundlagen schleichend untergräbt.
Es ist ein Komplex, weil es keine zentrale Instanz gibt. Die Zensur ist nicht autoritär, sondern verteilt – aber umso effektiver. Sie funktioniert wie ein ökonomischer Sektor: mit Budgets, Zielvorgaben, Förderprogrammen und einem normativen Konsens, dass abweichende Meinung gleichbedeutend mit Gefahr sei.
„Digital Services Act“: „Tut alles, was autoritäre Regime versuchten“
Ein oft auch von Ihnen genanntes Schlagwort ist der EU-„Digital Services Act“ (DSA). Was ist so gefährlich daran, wenn die EU-Staaten ausländische Digitalunternehmen regulieren?
Der DSA institutionalisiert eine Form der Vorzensur. Er verpflichtet Plattformen, innerhalb von Stunden auf anonyme Meldungen von staatlich zertifizierten Flaggern zu reagieren – ohne richterliche Kontrolle, ohne Öffentlichkeit. Dabei werden die Kategorien immer weiter ausgedehnt: von illegaler Hassrede zu „Desinformation“, von Terrorpropaganda zu „sozialer Polarisierung“. Der DSA tut das, was alle autoritären Regime versuchten – nur diesmal im Namen der Demokratie.
Sie plädieren für Gegenrede statt Zensur. Wie kann eine Gesellschaft, die zunehmend in Filterblasen gespalten ist, eine konstruktive Gegenrede fördern?
Gegenrede setzt Sichtbarkeit voraus. Aber die Plattformlogik bevorzugt Eskalation, nicht Argument. Wir müssen also Gegenöffentlichkeiten fördern, Räume für Streit kultivieren und die Architektur digitaler Kommunikation selbst in Frage stellen. Es reicht nicht, auf Plattformen zu sprechen – man muss auch die Macht über ihre Regeln kritisieren. Der beste Schutz gegen Lüge ist nicht das Verbot, sondern eine digitale Agora, in der jede Stimme zählt – und keine durch Subventionsmacht dominiert.
Sie betonen, eine Demokratie müsse auch Lügen aushalten. Ist aber gerade eine Demokratie nicht darauf angewiesen, dass es über die sogenannte vierte Gewalt und über die neuen Medien eine Instanz für die Wahrheit gibt, weil der Wähler nur basierend auf einem umfänglichen Bild eine authentische Wahlentscheidung treffen kann?
Sie muss Lügen aushalten, weil sie sonst aufhört, Demokratie zu sein. Der Bürger ist kein Kind, das man vor dem Bösen schützen muss. Er ist das Subjekt des Souveräns. Eine Demokratie, die sich nur auf Wahrheit gründet, ist gefährlich nahe an einer Theokratie. Wahrheit ist kein Besitzstand – sie entsteht im Streit. Und wer den Streit über Wahrheit verbietet, verliert das Vertrauen in den Menschen. Der Glaube, die Gesellschaft könne nur durch Informationskontrolle stabil bleiben, ist nicht demokratisch – sondern zutiefst autoritär.
„Lüge ist schnell – aber nicht nachhaltig. Wahrheit braucht länger – aber wirkt tiefer“
Nehmen wir einmal an, auf X würde eine Gruppe von Menschen, die Ihnen nicht wohlgesonnen ist, skandalöse Lügen über Sie verbreiten. Mithilfe von KI können Unmengen an seriös aussehenden Accounts und Seiten gebaut werden, die schlimmste Verleumdungen über Sie verbreiten. Der Skandal wird von Medien aufgegriffen, und das Rad der Mediengesellschaft dreht sich. Bis sich alles aufklärt, vergehen Wochen. Weit mehr Menschen werden die Lügen über Sie gesehen haben als die Richtigstellung. Wären Sie nicht froh, wenn X an der Verbreitung dieser Lügen frühzeitig gehindert werden könnte?
Ich wäre entsetzt – aber nicht überrascht. In einer offenen Gesellschaft gibt es keinen perfekten Schutz vor Rufmord. Und dennoch: Die Antwort kann nicht darin bestehen, Plattformen zu verpflichten, alles zu löschen, was schädlich erscheinen könnte. Denn dieses Instrument wird irgendwann gegen uns alle eingesetzt. Die wahre Resilienz liegt in Medienkompetenz, in Öffentlichkeit, in Zeit. Die Lüge ist schnell – aber nicht nachhaltig. Wahrheit braucht länger – aber sie wirkt tiefer.
Zur Person Jakob Schirrmacher
Jakob Schirrmacher arbeitet als Dozent für Medienbildung, Digitalisierung und Sozialstrukturwandel sowie als freier Journalist. Er ist Spezialist für Digitalisierung, Medienpädagogik und Jugendmedienbildung. Im April 2025 erschien sein Buch „Desinformiere dich! Eine Streitschrift“. Im Juli gründete er zusammen mit weiteren Akteuren den Verein Free Speech Aid, der Fälle von digitaler Zensur dokumentiert, Unterstützung für Betroffene anbietet und politisch Druck für Meinungsfreiheit machen möchte.
Sind Sie ein „Free Speech Maximalist“?
Wenn Maximalismus bedeutet, dass ich der Meinung bin, die Grenze der Meinungsfreiheit sei dort, wo das Strafrecht beginnt – dann ja. Wenn Maximalismus bedeutet, dass ich nicht glaube, dass Gefühle ein Maßstab für die Legitimität von Gedanken sind – dann ja. Ich bin kein Fan der Meinungsfreiheit, ich bin ein Gläubiger. Nicht aus Naivität, sondern aus politischer Erfahrung.
Was raten Sie Eltern, wie Sie Ihre Kinder auf die Informationsflut im Internet, in der auch echte Desinformation mitschwimmt, vorbereiten können?
Erziehen Sie keine Informationskonsumenten – sondern Diskursakteure. Vermitteln Sie nicht nur Fakten, sondern das Werkzeug, sie zu überprüfen. Und vor allem: Leben Sie vor, dass es keine Schande ist, Unrecht zu haben. Nur wer denkt, darf sich irren. Wer nie irrt, hat vielleicht nie gedacht. Die größte Lüge ist die, dass man Kinder vor Lügen schützen könne. Die Wahrheit beginnt dort, wo man sich ihrer nicht sicher ist.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?
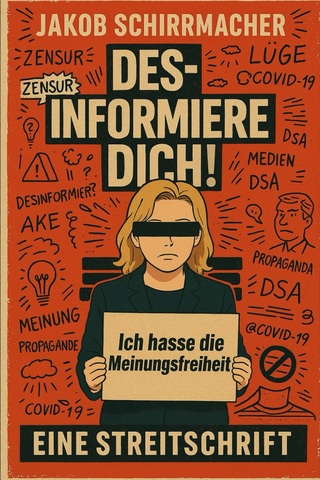






Kommentare
Findet bei uns Zensur statt? Hierfür wäre es zunächst wichtig, zu fragen: Was sind denn die Ergebnisse von Zensur? Wohin führt sie? Sie führt doch dazu, dass ein absolut homogenes Meinungsklima entsteht. Man schlägt die Zeitung auf, schaltet Fernseher oder Radio an - überall das Gleiche. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass heute viele ehemalige DDR-Bürger das Gefühl haben, dass sich die Geschichte exakt wiederholt. Es kann sein, dass es heute andere Zensurmechanismen gibt als früher, und das wäre zu erforschen. An ihrem Vorhandensein ist indes nicht zu zweifeln. Denn ein homogenes Meinungsklima entsteht nicht von allein, das muss gemacht werden. Wenn Menschen sprechen "wie ihnen der Schnabel gewachsen ist", dann hat man Meinungspluralismus, weil Menschen eben sehr unterschiedlich sind. Vielen scheint auch gar nicht bewusst zu sein, wie sehr man durch den Meinungsuniformismus der Demokratie den Boden wegzieht. Noch der frühere Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde hatte gesagt: "Demokratie mit abgeschotteter Information, Demokratie ohne die Möglichkeit öffentlicher Meinung kann nicht bestehen; sie bleibt Fassade für einen anderen politischen Gehalt."
Die Idee mag im Kern gut und richtig sein, sie geht aber von einem falschen Bild der Gesellschaft aus. Wenn die "wahre Resilienz" gegen Lügen oder Hass in einer entsprechend ausgeprägten Medienkompetenz liegen soll, dann wäre vielleicht mal ein Blick in die Vergangenheit nicht schlecht: seit bestimmt einigen Jahrzehnten ist bekannt, dass so einige der "Fakten" bzw. Artikel der Bild-Zeitung oder der Yellow-Press frei erfunden sind. Und dennoch werden diese Presseerzeugnisse noch immer in großen Mengen gekauft und gelesen (und offensichtlich für wahr bzw. vertrauenswürdig gehalten).
Wenn unsere Gesellschaft es also über einige Jahrzehnte hinweg nicht geschafft hat, sich eine Kompetenz gegenüber dieser klassischen Berichterstattung anzueignen, warum soll das dann im Bereich der digitalen Medien jetzt so leicht erreichbar sein, dass wir in diesem Bereich auf eine passende Gesetzgebung zur Eindämmung von Hass oder Desinformation verzichten können?!
Solange Algorithmen in der digitalen Welt die "sensationelle Lüge" als wichtiger propagieren als die "langweilige Wahrheit", solange braucht es Werkzeuge (Gesetze), um diese Desinformation einzudämmen, damit die Gesellschaft nicht an diesem "informellen Gift" verreckt.
Klingt alles sehr gut. Ich werde mir die Arbeit ansehen und dann, wenn sie die Erwartung erfüllt, auch unterstützen.