Das Ziel ist im Weg
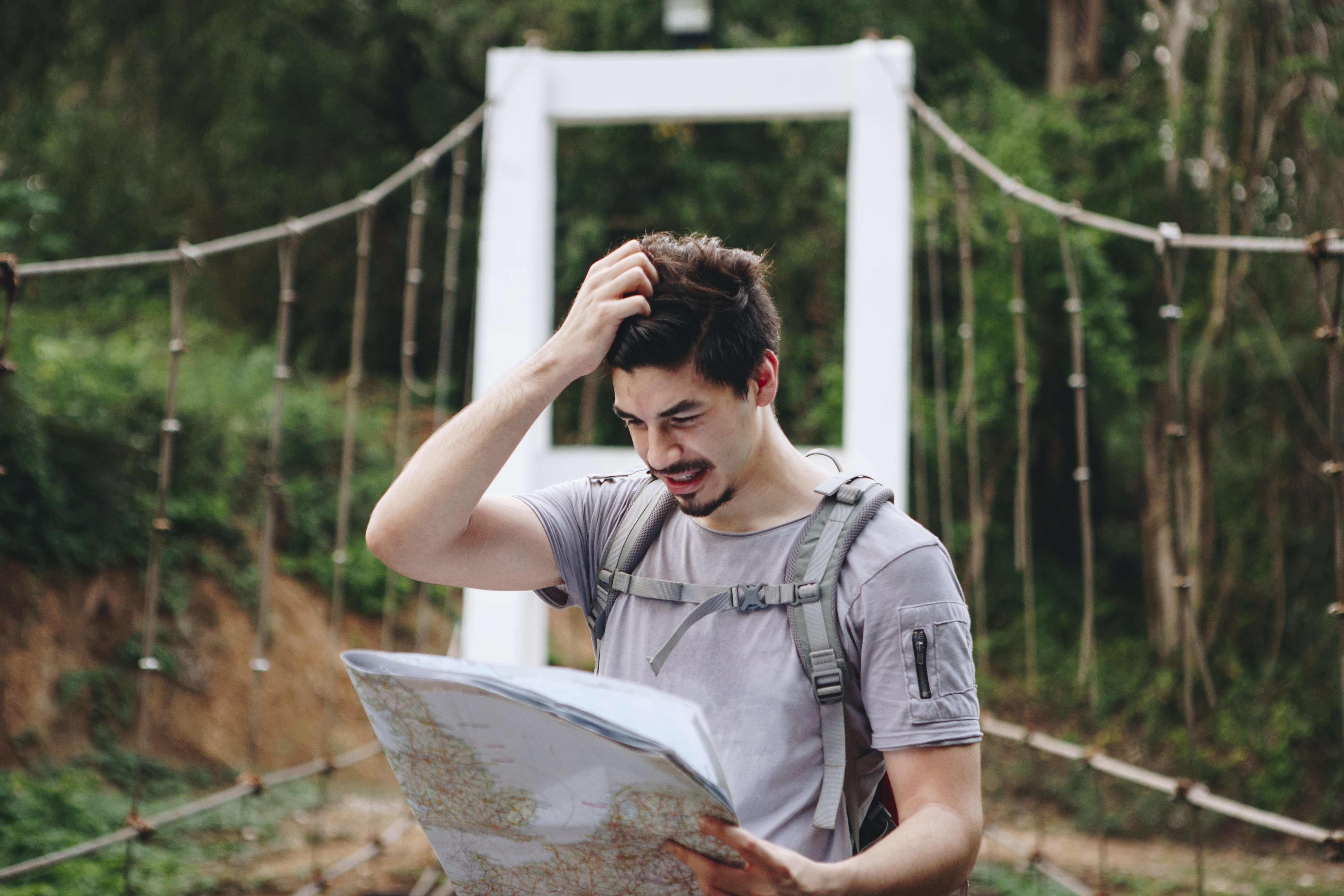
Wenn man nach den Gründen für das wachsende Desinteresse des Volkes an Volksparteien sucht, dann wird man oft darauf hingewiesen, die Politikverdrossenheit habe sich nicht zuletzt dadurch ausgebreitet hat, dass die Zielbestimmung der Politik und der von ihr lebenden Kaste zu unbestimmt und zu wenig aussichtsreich sei. Das Rein-in-die-Kartoffeln und Raus-aus-den-Kartoffeln, das wir täglich medial vermittelt bekommen, löst am Ende – nach Verwunderung und Aufgeregtheit – lautes Gähnen aus.
Staatsmännische Prophetien und markige Machtworte, die regelmäßig durch Wortbrüche und durch deren Kaschierung als Vermittlungsfehler entwertet werden, lassen bei der breiten Masse wenig bis nichts an Vertrauen auf eine Politik zur Erhaltung der Lebensqualität zurück. Besonders in Zeiten wie den gegenwärtigen verlangt es nach Kurswechseln, die den Kahn sichtbar von der Fahrt auf den drohenden Eisberg abwenden, statt auf Deck lediglich die Liegestühle zu verschieben.
Man fühlt sich auf Dauer betrogen von der Mannschaft, die sich nach offensichtlich absichtshaft falschen Versprechungen und deren planerischem Bruch auch noch beleidigt zeigt und die Fahrgäste beschimpft, weil sie nicht so blöd sind, wie man es sich gewünscht hatte. Denn die Wähler merken, dass etwas nicht stimmt. Sie sehen die Wand klaren Auges näherkommen und sind ohnmächtig, daran etwas mit den Mitteln zu ändern, die man ihnen zugesteht: durch demokratischen Einfluss auf die Zusammensetzung der Crew.
Niemand weiß scheinbar, wohin die Reise eigentlich gehen soll
Wählt man eine neue Mannschaft, von der man glaubt, sie sei in der Lage, ins Steuer zu greifen und die Ausrichtung zum Wohl der Passagiere zu ändern, wird anschließend so lange getrickst, bis die alten Seilschaften wieder mit neuer Uniform am Ruder sind. Über allem aber breitet sich das grundsätzliche Unbehagen darüber aus, dass nicht nur die Bereitschaft zur zielführenden Steuerung fehlt, sondern, viel fundamentaler, dass das Ziel an sich fehlt.
Niemand weiß scheinbar, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Die alten Grundlagen, zu entscheiden, was wahrhaft, edel und gut ist, sind längst den wechselnden Moden geopfert. Übriggeblieben ist das „Jetzt“ mit seinen Befindlichkeiten, die sich weder um Herkunft, noch um Zukunft kümmern.
› Lesen Sie auch: Das Christentum ist keine Boomer-Religion
Die Folge ist – neben der Enttäuschung über die demokratisch legitimierten Herrschenden – die Ohnmachtserfahrung breiter Mehrheiten in der Gesellschaft, die sich ohne wirkmächtige Stimme und ohne helfende Vermittler ihrer Interessen abgehängt vorkommen. Man will sie im Boot haben, aber enthält ihnen vor, wohin man den Dampfer eigentlich fahren lassen möchte.
Diejenigen, die es sich trauen, ab und an danach zu fragen, werden mundtot gemacht. Oder ihnen wird erklärt, dass der Nebel, durch den das Schiff fährt, eine spannende Herausforderung sei, weil er das Bewusstein dafür schärfe, es komme eigentlich gar nicht so sehr darauf an, an ein Ziel zu gelangen, als vielmehr unterwegs zu sein. Das Sichbewegen ist vom Bemühen anzukommen dispensiert. Es ist selbst zum Ziel geworden, gemäß dem mittlerweile im Discounterformat verkauften Mantra „Der Weg ist das Ziel“.
Es gibt ein Ziel, einen Weg dorthin und Wegweiser
Wer Alternativen sucht, womöglich eine echte Orientierung, war bislang bei der Kirche gut aufgehoben. Denn die hat eine Perspektive eingeschrieben, von der sie sagen kann, dass sie im Laufe der Jahrhunderte erprobt und erfolgreich gegen jede Form vernebelter Zeitläufte Halt und Hoffnung gab. Es ist dies die Botschaft und die Person Jesu Christi, der von sich sagt, Er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben und ergänzt: „Niemand kommt zum Vater, außer durch mich!“ (Joh 14,6)
Eine schlichte aber klare Ansage, die an anderen Stellen der Bibel noch nachgeschärft wird mit Konkretisierungen aller Art, die stets das eine herausstellen: dass die Zielperspektive ein Leben in der Vollkommenheit bei Gott bedeutet. Man erreicht es, wenn man nicht „von der Welt“ ist und sein Heil, anstatt aus menschengemachten Quellen zu schöpfen, auf dem Weg göttlicher Gebote dasjenige einlöst, was der Grund allen Heils ist: die Liebe zu Gott.
„Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.“ (Joh 14,21)
Es gibt also ein Ziel, einen Weg dorthin und Wegweiser, die auf diesem Weg helfen, das Ziel nicht zu verpassen und an die man sich folglich halten sollte. Eigentlich ganz einfach. Sollte man meinen. Und man sollte meinen, dass genau aus diesem Grund meine katholische Kirche der prädestinierte Garant einer sicheren Aussicht auf eine glückliche Reise durch die Unwegsamkeiten dieser Welt wäre. Aber, das ist die nüchterne bis tragische Bestandsaufnahme, sie ist es nicht mehr.
Teutonisches Schweben in wirklichkeitsfernen Sphären
Wobei sich das, was ich dem geneigten Leser in der Folge als Bestandsaufnahme unterbreite, ein betont deutsches Phänomen ist. Und das bedeutet, es ist eine Mischung aus teutonischem Schweben in wirklichkeitsfernen Sphären, in denen kein Asphalt mehr unter den Reifen zu spüren ist, und der im Land der Reformation eingewurzelten Abneigung vor geradlinigen und traditionsverbundenen Antworten aus der Theologie.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Was passiert nämlich, wenn ein unbedarfter Gottsucher sich der Kirche unserer Tage nähert? Was erfährt er? Nun, ungefähr das, was man erfährt, wenn man einen Bericht über einen der gängigen Bundesparteitage liest: wenig Konkretes und vor allem Interna. Wer hat was zu sagen? Wer boxt wen aus den Posten und wer erklimmt sie? Wie ist es mit der Frauenquote? Wie „stellt man sich neu auf“? Wie will man sich verändern? Was wird aus dem Programm aussortiert, um an der Macht zu bleiben?
Für den politisch Interessierten, der an dieser Stelle den Medienbericht beim Lesen nicht schon weggeklickt hat, weil es ihn eigentlich wenig interessiert, wie es im Maschinenraum der Partei aussieht, gibt es dann natürlich neben den eher prozessualen Rankünen auch noch Inhaltliches. Aber hier ist die Schalheit der Begegnung mit den politischen Anbietern ebenso groß.
Denn man erfährt in der Regel Abstraktes, wenig Griffiges und insgesamt eine nach allen Seiten offene, wenig nach Alleinstellungsmerkmal riechende Slogan- und Floskelparade. Ein paar Kostproben aus dem jüngsten Bundestagswahlkampf von Grünen, CDU und SPD und FDP: „Zuversicht“, „Zusammen“, „Zukunftskraft“, „Kommt, wir ändern die Politik“, „Klartext“, „Kompetenz“, „Machen“, „Mehr für Dich“, „Alles lässt sich ändern“ und so weiter. Abgesehen vom Abstraktionsgrad der Slogans kann man die Allgemeinplätze der Konkurrenten mühelos untereinander austauschen.
Nicht nur die Slogans sind hohl – auch die Absichten und Konzepte dahinter
Als Beleg dafür, dass diese Form von ganz offenbar zum Zweck des Machterhalts strategisch eingesetzter Unverbindlichkeit schon eine längere Tradition hat, empfehle ich dringend einen Blick in die SWR-Sendung „Auch ein Jahresrückblick“ vom 31.12.1980. Dort inszeniert Loriot die Idee, zum Zweck der ausgleichenden Gerechtigkeit und der Geldersparnis die Fotos für die Wahlplakate der damaligen großen Volksparteien einfach zusammen zu machen.
Der satirischen Enthüllung der Hohlheit mancher Slogans ist auch für unsere Tage kaum etwas hinzuzufügen. Aber es sind nicht nur die Slogans, die hohl sind, es sind ganz offensichtlich auch die Haltungen, Absichten, Konzepte der hinter den Slogans stehenden Politikkonstrukteure. Und was das betrifft, ähnelt tatsächlich der Machterhaltungsbetrieb der Parteien sehr dem Gebaren der Kirchen in unseren Tagen.
Für den Unbedarften oder nach Orientierung Suchenden gibt es wenig zu finden außer eine eher hilflos zusammengerührte Mischung aus demokratischen Bekenntnissen und inhaltsleeren Floskeln, die eines sicher nicht leisten: einen Einblick in das, was die Partei/Kirche/NGO wirklich bewegt und weshalb man sie wählen/an sie glauben/sie gar finanzieren soll.
Das Wesentliche ist „under construction“
Ein paar Kostproben aus dem kirchlichen Milieu. War ein unbedarfter Gottsucher bislang davon ausgegangen, dass er bei der Kirche eine Antwort auf existenzielle Fragen wie „Was kommt nach dem Tod?“ „Welchen Sinn hat mein Leben?“ „Wie gehe ich mit meiner Angst vor der Zukunft um?“, „Was darf ich hoffen?“ „Wie soll ich leben, damit alles gut wird?“, erhält er einen bunten Strauß an Allgemeinplätzen zurück.
Eine zufällige und zugleich für das gegenwärtige kirchliche Imaging repräsentative Stichprobe auf der Homepage einer Deutschen Diözese beginnt mit der Präambel: „Das tradierte Bild von Kirche, die Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben, ist passé.“ Und dann folgt in kleinen Dosen der Entleerungsvorgang: „Wir verändern uns!“, „Neue Pastoralstrategie“, „Mit der Botschaft Jesu nah bei den Menschen mit Ideen von Freiheit, Begegnung und Ermöglichung“, „Wir wollen anschlussfähig bleiben“, „Mit Optimismus und Selbstbewusstsein in die nächste Etappe“, „Wirksamkeit und Gemeinschaft“, „Zum Mitmachen einladen“, „kreative Konfrontation von „Evangelium“ und „Existenz“ etc.
› Lesen Sie auch: Niedergang des Christentums – nicht erst seit dem 20. Jahrhundert
Was die Suche nach Sinn betrifft, erhält der Suchende folgende vielsagende Antwort:
„Da unsere etablierten Formen christlichen Glaubens die[se] Menschen offenbar immer weniger ansprechen, erproben wir gezielt neue Angebote der Sinnsuche, Lebensdeutung und biografiebegleitender Rituale. Wir sind dabei selbst Lernende, da das Wissen über die angemessene Form der Verkündigung des Evangeliums auf diese Bedürfnislage hin noch nicht vorliegt, sondern in konkreten Vorhaben erst entwickelt werden muss.“
Aha, da ist das Wesentliche wohl noch under construction. Wer mag, kann aber die neuen Vokabeln schon einmal mittels eines beigelegten Kreuzworträtsels spielerisch verinnerlichen. Der existenziell Suchende klickt sich indessen raus aus dem Portfolio der Unverbindlichkeit. Zumal er auch Kernbegriffe, von denen er bislang die Ahnung hatte, dass sie in einem kirchlichen Antwortkatalog zu den Fragen der Menschheit vorkommen, auch nach längerem Suchen nicht finden konnte: „Gott“, „Gnade“, „Erlösung“, „Jesus Christus“, „Beten“, „Ewiges Leben“, „Hoffnung“ oder „Umkehr“ und „Vergebung“.
Die Antwort auf diese Unsicherheiten lautet aus dem kirchlichen Strukturalisten-Management: Paradigmenwechsel. Mit anderen Worten: die alten Begriffe fassen nicht mehr das, was der heutige Mensch braucht, weshalb er in seine aktuell geprägte Sprache die überkommenen Inhalte übersetzt bekommen muss. Dies aber ist ein Trugschluss – vorsichtig formuliert.
Denn die Neue-Welt-Begrifflichkeit von „Engagement“ und „Nachhaltigkeit“ bis zu „Wirksamkeit“, „Lebendigkeit“ und „Solidarität“ ist nicht nur durch ihre pluriformen Auslegungsmöglichkeiten, sondern vor allem durch die Untauglichkeit ausgezeichnet, begrifflich und wirklichkeitsbezogen diese Welt zu übersteigen. Sie verbleiben im prozessualen Gewurschtel stecken und liefern am Ende nur eines: Ratlosigkeit. Wie bei jeder Form des extremen Humanismus, der die Beziehung von Mensch zu Mensch zum absoluten Primat erhebt und sie gegen die Beziehung von Mensch zu Gott austauscht oder sie schlicht und einfach umbenennt.
Die Transformation von „Lehre“ zu „Leere“ ist kein Betriebsunfall
Diese Bestandsaufnahme ist nicht schön, aber sie ist unumgänglich, will man den tiefen Kern der Krise des Christentums in unserem Land verstehen, die in manchen Zügen der Krise der Politik und der durch sie geformten Gesellschaft entspricht. Ganz offensichtlich sind die Kirchen dem humanistischen Wegcharakter der Wahrheit aufgesessen, weswegen sie auch so wenig vom Ziel des Weges, als vielmehr nur von ihm selbst sprechen, der sich selbst genügt und die Frage nach einem Ziel nicht mehr stellt.
Die Transformation von „Lehre“ zu „Leere“ ist deswegen kein Betriebsunfall. Sie ist der Kollateralschaden der erst sprachlichen und schließlich inhaltlichen Entsorgung eines transzendenten Ziels. Denn dieses Ziel stört und steht im Weg, weil man sich in der Ausrichtung an dem, was offenbart ist, in seinem Autonomiedrang eingeschränkt fühlt.
Der Prozess, in Religion, Politik, Bildung und Kultur klammheimlich die Schräubchen im Maschinenraum zu lockern, die einst die Motoren des Gesellschaftsdampfers zusammengehalten haben, ist in vollem Gange. Und es ist eine Frage der Zeit, wann die navigationslose Fahrt im Nichts endet. Oder durch Zerschellen - womit noch immer alle bestraft wurden, die die Gefahren zeitgeistlicher Widerstände nicht frühzeitig erkannt hatten.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?







Kommentare
Die Entwicklung wird dort enden, wo sie historisch immer geendet hat: Es werden neue Anbieter auftreten, die Sinnstiftung versprechen, und denen werden die Menschen zulaufen. Vor zweitausend Jahren im Heiligen Land war das eine gute Sache. In den 1930er Jahren in Deutschland nicht. Das Problem: Wir wissen nicht, wer diese neuen Anbieter sein werden. Gnade uns Gott!
Eine sehr treffend formulierte Kolumne.
Sowohl die Politik wie auch die Kirchen sind inhaltsleer geworden.
Für die Menschen, die sich aber von Herzen wirklich nach Gott sehnen und ihn suchen, gibt es Trost...
Ja, Deutschland benötigt insgesamt eine Erweckung... dafür können Christen beten...
Jeremia 29,13: "Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen"
Wenn man heute junge Menschen in der Kirche sieht, dann sind die doch meist sehr gläubig. Sie gehen zur Beichte, empfangen die Mundkommunion usw. Ich finde es deshalb wirklich schlimm, wie das kirchliche Establishment heute die jungen Leute im Stich lässt. Die ganze Reformagenda spiegelt doch vor allem die Anliegen der Boomer-Generation wieder. Das sind diejenigen, die in der Vergangenheit leben und immer noch die uralte Litanei von "Reformen", Liberalisierungen der Moral usw. anstimmen. Die Jungen werden heute schon genug mit solchen Themen an Schule und Universität drangsaliert. Die brauchen das nicht mehr.
Dies bitte nicht falsch verstehen: Es sind ebenso die "Boomer" die heute in Politik und Kirche viel wertvolles leisten. Sie stehen gegen das auf, was ein Teil ihrer Altersgenossen angestoßen hat. Ich bin dafür sehr dankbar. Es geht mir hier nicht um den einzelnen Menschen, sondern darum, ein strukturelles Problem anzusprechen. Man sollte doch einmal wirklich auf die gläubige Jugend hören, anstatt die eigenen Wunschvorstellungen in die Jugend hineinzuprojizieren.
"No hay camino, se hace camino al andar." So der bekannte und suggestive Vers des Antonio Machado. ("Einen Weg gibt es nicht, der Weg entsteht beim Gehen."). Ja, es gibt Situationen im Leben, in denen man vergeblich einen Weg sucht. Und doch muss man einen finden, will man ans Ziel gelangen, man kann auch nicht stehenbleiben. Aber eben, auch das Ziel ist unbekannt. Der Vers will vielleicht suggerieren, das es schliesslich nicht so wichtig ist, was wir eigentlich wollen. Unterwegs, auf einem beliebigen, ja gar nicht existierenden Weg, wird uns schon etwas einfallen, wir werden dann doch ein Ziel erfinden, uns etwas einfallen lassen, und dann dieses Ziel anstreben. Der Vers Machados wäre eventuell brauchbar, wenn der Dichter uns damit ermuntern möchte, neue Wege zu gehen, zu wagen. Kann man aber Weg- und Ziellosigkeit empfehlen, um an neue Ufer zu gelangen? Zweifel sind angebracht.
Herzlichen Dank. Sehr überzeugende Kritik an Kirche und auch an Gesellschaft.
Auch Andeutung eines Lösungsweges.