Wahlhalla

Bevor sich der geneigte Leser allzu schnell über die obige Überschrift echauffiert, die in scheinbar fehlerhafter Schreibweise an den in der Nähe von Regensburg errichteten Ehrentempel für „teutsche“ Geistesgrößen erinnert, mag er sich zu einem anderen Aufreger entführen lassen. Und zwar zu einem Streit, der sich regelmäßig in der Gruppe jener Literaturbeflissenen entzündet, die sich gerne mit Aphorismen schmücken, namentlich mit denen des österreichischen Publizisten Karl Kraus (1874–1936).
Seine Abneigung gegen den Berufsstand des Journalisten goss er einmal in den Ausspruch: „Keinen Gedanken haben und ihn ausdrücken können – das macht den Journalisten.“ So ist der Satz überliefert, der in seiner Abschätzigkeit nur noch von dem von Karl Kraus geprägten Begriff „Journaille“ übertroffen wird, in dem „Journalismus“ und „Canaille“ zu einem Wort verschmolzen sind.
Für Karl Kraus war schon in seiner Zeit die Armada von Berichterstattern eine Art Gesindel, das sich mal käuflich, mal aus Überzeugung zwischen die Welt und die Leser schiebt. Ein harter Vorwurf, der seither dem Journalismus insgesamt anhaftet. Was nichts daran ändert, dass sich eine Abkehr der Journalisten von ihren oftmals tendenziösen Methoden des Umgangs mit der Wirklichkeit bislang nicht in einem nennenswerten Maße vollzogen hätte.
In diesem Zusammenhang nun kursiert ein Kraus-Diktum, das gerne in Reden und Artikeln verwendet, aber in der Regel falsch zitiert wird. Dies schadet ihm jedoch nicht im Mindesten. Es ist der auf die Presse bezogene Satz: „Es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, ihn ausdrücken zu können.“ Hier ruft es die eingefleischten Krausianer auf den Plan, die den dem Schriftsteller zugeschriebenen Satz mit einer Quelle aus der von ihm gegründeten Satirezeitschrift Die Fackel verfälschen und ihn mit Verweis auf Ausgabe Nr. 697, Seite 60, geradestellen.
Inhaltslosigkeit und Manipulation im Journalismus …
Dort nämlich wird keineswegs von der Unfähigkeit, etwas auszudrücken, gesprochen, sondern vom reinen Gegenteil, was dem Spruch einen anderen Klang verleiht: „Es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben: Man muss ihn auch ausdrücken können.“ Hier wird die Stigmatisierung des von Kraus verhassten Journalismus noch schärfer, weil sie in der Kombination von Inhaltslosigkeit und Sprachbegabung eine üble Verbindung entdeckt, der eine geradezu kriminelle Energie innewohnt.
Es ist spannend festzustellen, dass sich dieses Grundgesetz der Verarbeitung defizitärer Wirklichkeitsverarbeitung seit seiner satirischen Formulierung vor über hundert Jahren ganz offensichtlich nicht geändert hat. Im Gegenteil, die Zahl der sprachgewandten Schreiberlinge ist sicher gestiegen, statt geschwunden.
Gleichzeitig ist die Gleichgültigkeit im Umgang mit der Manipulation dessen, was Wahrheit ist, ungebremster denn je. Wobei es – und hier ist die Intervention der Krausianer sehr wertvoll – in der moralischen Beurteilung mancher journalistischer Methoden einen Unterschied macht, ob die leeren Gedanken schlecht oder gut ins Wort gefasst werden.
… und dafür eine perfekte Schreibe als Kosmetik
Die Perfektion, die manche in ihrer Schreibe erreicht haben, lässt oftmals die Wirklichkeit genauso hinter den Worten verschwinden wie das Elend der russischen Bevölkerung hinter den hohlen Fassaden, die der Fürst Grigori Potjomkin errichtet hatte, um die Zarin Katharina die Große bei ihren Reisen von der Realität in ihrem Land abzuschirmen. Sie sah nur das, was man ihr präsentierte: Mauern, hinter denen sich bestenfalls nichts, schlimmstenfalls das Gegenteil dessen verbarg, das sie vermuten ließen.
Unsere tägliche Rezeption von medialen Informationen steht vor keiner anderen Herausforderung, als die Betrugsmasche zu durchschauen und sich einen Blick hinter die Kulissen journalistischer Schön- oder Schlechtfärberei zu verschaffen. Wobei es nicht immer Lüge und Betrug sind, die einen dort von den wirklichen Verhältnissen abschirmen. Und genau hier liegt die eigentliche potemkinsche Perfidie der Medienwelt: Es ist oftmals auch eine erschreckende Inhaltslosigkeit, die durch die verbal aufgezäumten Fassaden verdeckt wird.
Man fühlt sich an den Begriff „Inkompetenzkompensationskompetenz“ des Philosophen und Essayisten Odo Marquart erinnert. Nach erfolgreicher Abschiebung der Wahrheit in das Ghetto der Beliebigkeit bleibt nichts mehr übrig als journalistische Kosmetik.
Auch in der Kirche nimmt man es mit der Wahrheit nicht mehr so genau
Wer hätte nun gedacht, dass sich diese Gefahren von Wirklichkeitsverarbeitung auch in einem Raum finden, der eigentlich als der Hort der Wahrheit und Ehrlichkeit gilt: in der Kirche. Ja, es muss gesagt werden: Die Zeiten, in denen Christen in unserem Land für Realitäten einstanden, die als unverrückbar galten, sind vorbei. So gut wie alles – mit Ausnahme der Kirchensteuer – wird in seiner zeitlosen Gültigkeit in Frage gestellt. Für die Verkündigung des Evangeliums bedeutet dies, dass es sich nicht mehr ausmachen lässt, was es genau bedeutet.
Das, was einst Glaubensunterweisung war, ist zur Darstellung der Meinungsvielfalt geworden. „Ambiguitätstoleranz“ ist dabei ein entscheidendes Stichwort, unter dem sich die führenden Vertreter kirchlichen Managements versammeln. Es ist das gleichzeitige Geltenlassen von Gegensätzen und Widersprüchen, von denen man einst glaubte, sie wären im christlichen Bekenntnis nicht möglich, weil unser „Ja“ doch ein „Ja“ und unser „Nein“ ein „Nein“ sein sollte. Hintergrund für diese Mutation einer einst entschiedenen Religionsgemeinschaft ist die seit langem betriebene intellektuelle Auflösung der Annahme, der Mensch sei wahrheitsfähig.
Der Subjektivismus in seinen diversen Spielarten hat über Jahre in Verstand und Empfinden ganze Arbeit geleistet. Daher dürfen sich heutzutage alle, die dem überlieferten Glauben inhaltlich und formal treu bleiben wollen, wegen ihrer Bezugnahme zu den offenbarten Wahrheiten unversehens als eine Art Al-Qaida – auf Deutsch: die Basis – betrachtet fühlen.
Relativierung von Glaubenswahrheiten führt zu Desinteresse
Ihr Beharren auf der Unveränderlichkeit der Botschaft wird nicht nur als unmodern empfunden, sondern sogar als gefährlich eingeordnet. Auf diesem Hintergrund hat es sich eingebürgert, mit der Verkündigung der christlichen Lehre vorsichtig zu sein und sie stets einer mehrfachen chemischen Reinigung zu unterziehen, bevor man sie ausspricht.
Das Ergebnis dieser „Chamäleonitis“ ist aber keineswegs die erhoffte größere Wirksamkeit, sondern ein Versinken in Bedeutungslosigkeit. Zumindest in Deutschland, wo man sich im katholischen Raum selbst gerne als international maßgeblich empfindet, schwindet das Interesse an christlichen Wahrheiten erkennbar. Nicht durch deren Unzeitgemäßheit, sondern – und das beweist die Entwicklung im europäischen Ausland – durch deren Verschweigen. Man kommt gar nicht erst zur Erhärtung des Verdachts, nicht verstanden zu werden, sondern man spricht dasjenige, was man als unverständlich vermutet, erst gar nicht aus.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Das Ergebnis: Ein Bemühen um eine erhöhte Aufmerksamkeit durch die stetige Beteuerung, dass die Wahrheit des Christentums geschmeidig genug ist, um auch das Gegenteil dieser Wahrheit in sich zu integrieren, verursacht das reine Gegenteil von öffentlicher Wahrnehmung: das erhöhte Desinteresse an dem, wofür sich die Christen zu Beginn der Kirchengeschichte einst die Haut abziehen ließen. Ein Desinteresse, das gerade nicht dadurch entsteht, dass man die christlichen Wahrheiten womöglich allzu deutlich vorgesetzt bekommt, sondern dadurch, dass man ihnen gar nicht erst in der Verkündigung begegnet.
Pastorale Gremien: Mitbestimmung statt Glaubensinhalte?
Als klitzekleines Beispiel mag hier das Bemühen einer deutschen Diözese gelten, sich in Zeiten des Mitgliederschwunds, der ungenutzten Kirchengebäude und der Verdunstung des Christentums selbst aus dem, was man einst Allgemeinbildung nannte, gesellschaftlich bemerkbar zu machen. Was könnte das sein? Glaubensverkündigung in der Fußgängerzone? Ein perfektionierter Medieneinsatz für Jesus Christus als Eyecatcher inmitten einer banalisierten Diversitätswelt? Oder gar eine neue Formierung der Gläubigen zum Glaubenszeugnis des Einzelnen im Alltag? Weit gefehlt! Man setzt nicht auf Inhalte, sondern auf Mitbestimmung.
Im konkreten Fall sind es deswegen nicht inhaltsbetonte Missionsmodelle, sondern Wahlen von pastoralen Gremien, die neuen Schwung in die ansonsten recht ratlose Stimmung bringen sollen. Einem höheren geistlichen Funktionsträger wurde jüngst in diesem Zusammenhang die folgende wichtige Frage zur Zukunft seiner Diözese gestellt: „Nicht nur die Kirche im Bistum befindet sich gerade in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Warum sind gerade in dieser Zeit Wahlen so wichtig?“ Die Antwort lautete:
„Die Wahlen sind wichtig, weil wir in vielen gesellschaftlichen Bereichen nicht nur ein Problem damit haben, dass sich Extreme immer mehr polarisieren, sondern eben auch die Zwischentöne verloren zu gehen drohen. Diese Zwischentöne machen eine gesellschaftliche Debatte aus und prägen sie. Vor diesem Hintergrund schwindet im Allgemeinen die Akzeptanz von demokratisch legitimierten Institutionen. Radikale Gedanken und Kräfte nehmen zu. Umso wichtiger ist es, dass Wahlen eine entscheidende Möglichkeit darstellen, im gesellschaftlichen und kirchlichen Kontext Menschen an demokratisch legitimierten Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen: indem sie sich mit ihrer Stimme einbringen, indem sie Mandatsträger dafür legitimieren, für ihre Interessen einzutreten.“
„Für die Zwischentöne und Differenzierungen werben“
Wer nun empfindet, dass diese Antwort auch aus dem Kreisvorstand der CDU oder SPD stammen könnte, liegt richtig. Auch im weiteren Verlauf des Interviews erfährt man nicht, was die Kirche verkaufen will, sondern nur, dass alle Kompetenzen, Partizipationen, Machtverhältnisse und Genderquoten in der Mitläuferschaft geklärt sind. Dann entwickelt sich der Rest ganz offensichtlich von selbst. Abschlussfrage und -antwort bestätigen dies: „Ist Kirche nach wie vor ein relevanter Player in der Gesellschaft?“ will man wissen. Die Antwort:
„Ich erlebe kirchliche Akteure als diejenigen, die bei den drängenden Grundfragen unserer Gesellschaft mit wichtigen Orientierungen aus dem Glauben für die Zwischentöne und Differenzierungen werben; die nicht der Versuchung anheimfallen, gleich alles zu skandalisieren, zu polarisieren und damit zu spalten. Sie bemühen sich darum, in einem ehrlichen Hören einen offenen Diskurs zu ermöglichen und den Freiraum dafür offenzuhalten.“
Wann immer man einen Beleg für den Unterschied zwischen „gut“ und „gut gemeint“ sucht: Hier hat man ihn gefunden! Denn was sollte eine säkulare Öffentlichkeit dazu bewegen, sich der Kirche und ihrer Botschaft zuzuwenden, wenn sie lediglich eine Ansage erhält, Demokratie und offenen Diskurs zu preisen? Also das, was allenfalls formale Kriterien sein können, um irgendetwas damit zu erreichen.
Enttäuschende Plattitüden lassen Suchende ratlos zurück
Eine solche Botschaft sagt der Öffentlichkeit aber nicht, was man im Angebot hat und dass das ein Gott ist, der erst dann eine Hilfe für die Menschheit ist, wenn Er angebetet und verherrlicht wird. Und nicht, wenn Er als Funktionsträger der humanistischen Union betrachtet wird, noch dazu mit der unterschwelligen Botschaft: Du musst nicht an Ihn glauben, du musst nur die, die an Ihn glauben, akzeptieren, damit – so der geistliche Interviewpartner in seiner Konklusion wörtlich – die „Kirche bei den Menschen, mit den Menschen und in den Menschen vor Ort auf Augenhöhe weiter erlebbar bleibt“.
Und so bleibt derjenige wiederum ob der Plattitüden ratlos zurück, der die ewige „Wahlhalla“ am Wühlkorb mit den Sonderangeboten der permissiven Gesellschaft satthat und vermutete, dass er in der Kirche ein christliches Walhall finden würde, in dem er auf diejenigen stößt, die in der Welt, aber nicht von der Welt sind (vgl. Joh 17,16).
Das derzeit in Deutschland konstruierte kirchliche Plagiat von „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ des Philosophen Karl Poppers, in dem die Kernbotschaft „Mitbestimmung“ heißt, wird wohl kaum bewerkstelligen, dass die Menschheit sich ändert, umkehrt, glaubt und dadurch besser wird. Denn, so sagte der Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Neuss 1969: „Wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie abgeschafft.“


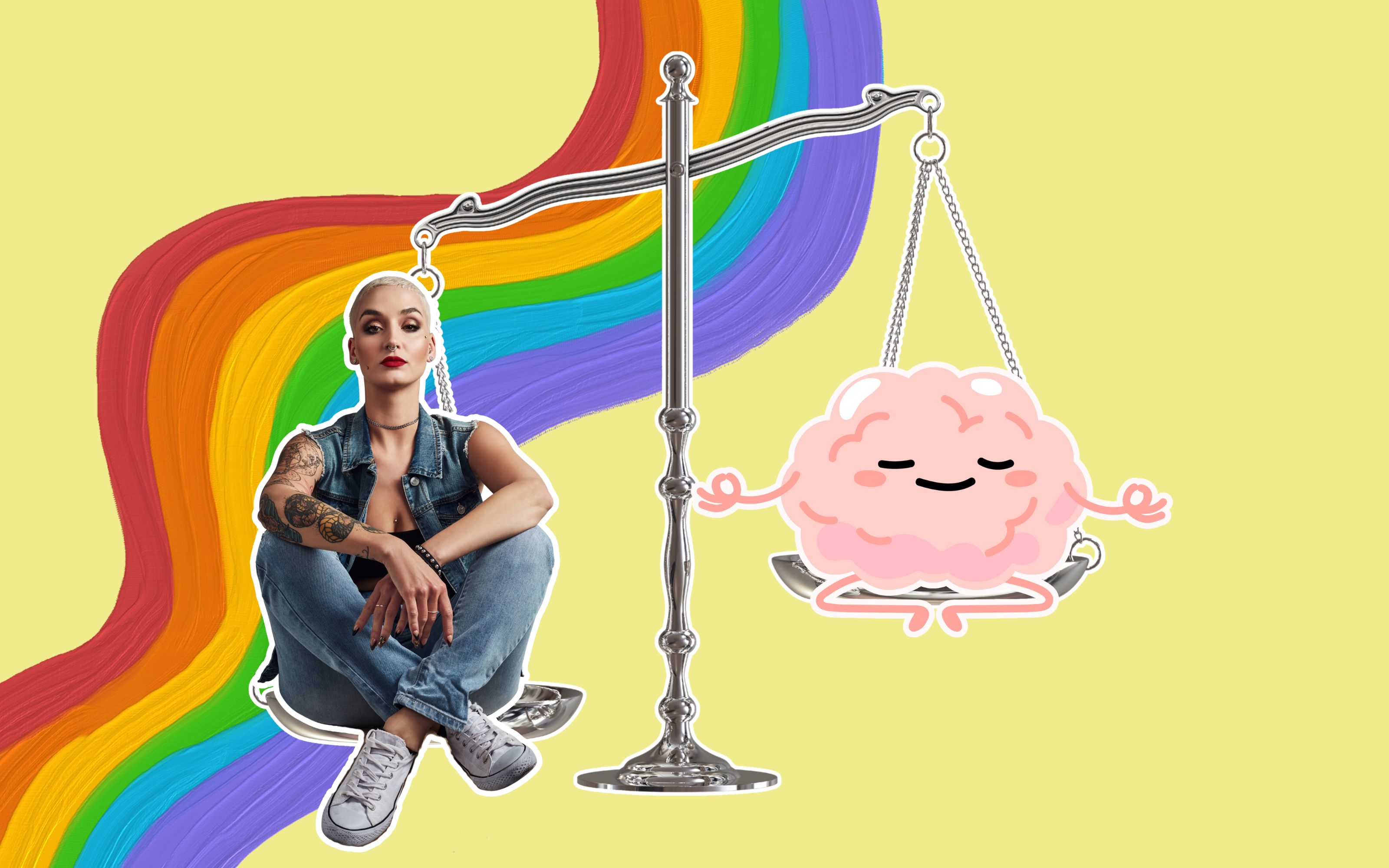



Kommentare
Vor fünf Jahren hat mich ein Gemeindemitglied - eine freundliche und gute Frau - gefragt, ob ich für den Pfarrgemeinderat kandidieren möchte. Ich habe zugesagt, obwohl mir schon im Beruf Gremien und Sitzungen ein Greuel sind. Ich wurde gewählt, und was ich dann fünf Jahre lang erlebt habe (Postengeschacher von Anfang an, Ablehnung des Vatikans, linke Regenbogenverherrlichung, Kampf gegen Rechts etc.), hat mich erschüttert. Das hatte ich nicht erwartet. Als Grundmelodie zu diesem Treiben gab es genau das Wischi-Waschi, das Pfarrer Rodheudt in seinem Artikel so trefflich beschreibt. Meine Abneigung gegen diese „Mitbestimmung“ ging so weit, dass ich mit der Gemeinde nun eigentlich nicht mehr viel zu tun haben möchte. Das ist wahrscheinlich nicht sehr christlich von mir, aber soll man gute Miene zum bösen Spiel machen?
@Alluskewitz Wie haben Sie reagiert in den Sitzungen? Waren Sie der einzige Konservative?
Ich bin fassungslos darüber, wie sehr alles verwässert ist und wie wenig Überzeugung selbst kirchliche Würdenträger heute noch in ihrem eigenen Glauben haben. Auch die Kandidatenvorstellungen bei den Pfarrei-Mitgliederwahlen waren so nichtssagend und gleichförmig, dass sie mir keine echte Wahl ermöglichten. Mir fehlten klare Positionen, Mut und ein Bekenntnis zum katholischen Glauben. Deshalb habe ich nicht gewählt. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
@Natascha Hebell Mir ging es genauso. Ich habe nicht gewählt, eben aus der Erfahrung heraus, Pfarrgemeinderatsmitglied gewesen zu sein bzw. bis zum Jahresende noch zu sein.
Die Situationsbeschreibung des geschätzten Herrn Pfarrers Dr. Rodheudt teile ich, bei seiner Analyse bin ich eher skeptisch:
Der Hund scheint mir nicht bei demokratischen Elementen zu liegen, die ja schon in Kapitel 6 der Apostelgeschichte (Wahl von Diakonen für sozioökonomische Themen, damit sich die Apostel auf ihre geistlichen Aufgaben konzentrieren können) beschrieben wurden, sondern in dem von ihmebenfalls genannten Begriff "Kirchensteuer"!
So wie es - vor allem jenseits des durch Zwangsabgaben finanzierten Journalismus - auch gute Journalisten gibt (z.B. Anna Schneider von der Welt), so blüht St. Afra in Berlin ohne einen Cent Kirchensteuer! Oder wie es mir ein Missionar aus einem aus katholischer Sicht erbärmlichen Land sagte: "Gute Seelsorge und Gemeindearbeit finanziert sich immer!"
Und ja, auch ich fand meine Zeit im Kirchengemeinderat als "Kirche zum Abgewöhnen". Aber das lässt sich leider durchaus noch steigern: Durch Kleriker, die auf dem Tempelberg das Kreuz ihres Herrn und Erlösers ablegen (aber weiterhin mit dem kardinalen Purpur der Blutzeugen und Bekenner durch die Kirchengeschichte stolzieren), von Klerikern, die in der Epiklese die "gütige Mutter" um die Herabsendung ihres Heiligen Geistes bitten, der dann aber die Gaben nicht zwingend in Leib und Blut Christ verwandeln soll! So einen Rotz habe ich bislang nicht mal von Maria 2.0 gehört! Und wenn das Kirchenvolk heute glaubensmäßig völlig ungebildet ist, wer hat es denn verbockt??!
Besonders abstoßend wird es übrigens, wenn zwangsabgabenfinanzierter Klerikalismus auf ebensolchen Journalismus trifft: Wenn sich z.B. der Chefredakteur von katholisch.de in m.E. rassistischer Überheblichkeit über die vermeintlich rückständigen afrikanischen Christen echauffiert. Oder wenn sich ein Kleriker, von dessen Kirchentür unweit wiederholt der islamistische Antisemitismus tanzt, oberschlau über des Kanzlers "Stadtbild"-Hinweis auslässt: https://katholisch.de/artikel/65064-jesuit-die-aussage-von-herrn-merz-ist-absurd-und-gefaehrlich. Zum Davonlaufen ...
Und noch ein Nachtrag zur Begriffsklärung: Der "Synodale Weg" ist natürlich - auch aus politikwissenschaftlicher Sicht - KEIN wirklich demokratisches Projekt, sondern der Ersatz einer geistlichen Aristokratie (die sich durch die apostolische Sukzession legitimiert) durch eine schnöde Verbandsoligarchie. Na, dann Prost Mahlzeit! 😞
Zu den bereits aufgezählten Absurditäten kommt im Erzbistum Paderborn in der jetzt angelaufenen Wahlperiode der Pastoralgremien und Kirchenvorstände ein ganz besonderes Schmankerl hinzu. Die jetzt gewählten Gremien haben nämlich den Auftrag, exakt jene Körperschaften, deren Mitglieder zu vertreten sie gewählt wurden, abzuschaffen und abzuwickeln. Eine radikale Bistumsreform macht aus über 600 Pfarreien am Ende ca. 50 Pfarreien in 25 Pastoralen Räumen. Auch wenn wie üblich bei kreisenden Abrissbirnen die bekannte Aufbruchsrhetorik die Sprachregelungen prägt, wird es am Ende nur ein Hauen und Stechen um den Erhalt oder das Erringen von Privilegien sein. Allen anderslautenden Werbebotschaften zum Trotz wird die Reform des Bistums in voller Härte top-down umgesetzt werden. Die heilige Mitbestimmung ist dabei nur verordnete Kosmetik. 2030, wenn die gegenwärtige Wahlperiode der Gremien endet, wird im Erzbistum kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Jemanden mit meiner Wahlstimme dazu beauftragen zu müssen, dabei mitzuwirken, habe ich nicht übers Herz gebracht.