Das Elend des Toleranzparadoxes
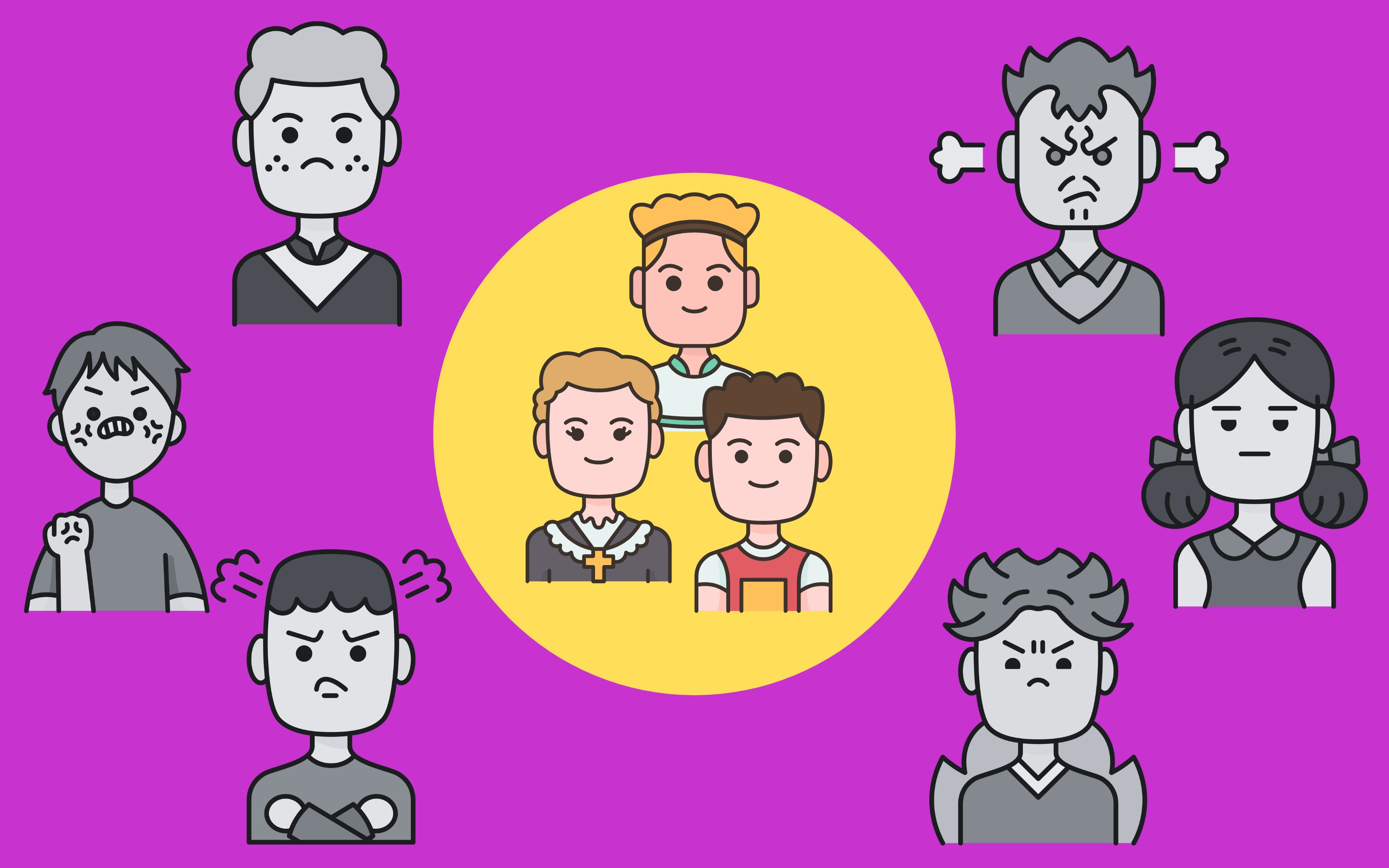
Wer sich abseits des öffentlichen Meinungskorridors bewegt, hat vermutlich schon folgende Erfahrung gemacht: Gerade jene, die sich selbst als weltoffen und tolerant verstehen, verhalten sich angesichts abweichender Ansichten höchst intolerant.
Als Begründung gibt der vermeintlich Tolerante dann gerne an, er habe keine andere Wahl, als selbst intolerant zu werden, um die tolerante Gesellschaft vor den Intoleranten zu schützen.
Das Toleranzparadox Karl Poppers
Der Philosoph Karl Popper hat diesen folgenschweren Gedanken im ersten Band seines Werks „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ (1945) beschrieben und als das „Toleranzparadox“ bekannt gemacht: Grenzenlose Toleranz führe demnach zwangsläufig zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn man auch gegen die Intoleranten tolerant sei, dann würden diese früher oder später die Toleranten aus dem Weg räumen und damit der Toleranz ein Ende bereiten.
Popper betonte zwar, dass er nicht dafür sei, pauschal alle intoleranten Weltanschauungen zu verbieten. Allerdings sei so viel Nachsicht intoleranten Meinungen gegenüber nur angebracht, solange man diese durch Argumente entlarven und damit im Rahmen einer öffentlichen Debatte unschädlich machen könne.
Hier dachte Popper offenbar strategisch: Alles Intolerante verbieten zu wollen, wäre unklug. Damit hatte er sicher recht. Schließlich werden bestimmte Ansichten erst durch Verbote attraktiv.
Allerdings beharrte Popper darauf, dass sich eine tolerante Gesellschaft das Recht vorbehalten müsse, intolerante Meinungen notfalls zu verbieten. Das gelte vor allem dann, wenn sich die intoleranten Ideologien partout nicht auf die besseren Argumente einlassen wollten und ihren Anhängern gar den Einsatz von Gewalt nahelegten.
Ein wechselseitiges Unterdrücken von Meinungen
Diese Logik wirkt bis heute auf viele bestechend. Dabei ist es eindeutig zu kurz gedacht, denn dieser Gedanke lässt sich, wie es eben Kennzeichen von Paradoxien ist, auch gegen sich selbst wenden: Die Toleranten, die sich mit repressiven Maßnahmen gegen jene wenden, die sie – zu Recht oder zu Unrecht – für intolerant halten, erweisen sich schließlich dadurch selbst als intolerant.
Dadurch aber könnten sich ihre Gegner mit gleichem Recht auf das Toleranzparadox berufen, um sie zuerst als intolerant zu brandmarken und dann zu unterdrücken. So droht die Berufung auf das Toleranzparadox letztlich zur wechselseitigen Unterdrückung von Meinungen zu führen, die man selbst ablehnt und für schädlich hält.
Toleranz ist eine Duldung, kein eigenständiger Wert
Wie aber sollte man es dann mit der Toleranz halten? Zunächst einmal gilt es, sich von der Ansicht zu verabschieden, dass Toleranz ein Wert an sich ist. Tolerant zu sein bedeutet schließlich, etwas trotz seiner Schlechtigkeit zu ertragen. Ein Eigenrecht des Unwahren und Unsittlichen lässt sich aus der so verstandenen Toleranz nicht ableiten.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Jedoch ist zugleich auch die prinzipielle Fehlbarkeit des menschlichen Denkens zu beachten: Gerade deshalb, weil ich selbst falsch liegen und meine Überzeugung im Lichte einer mir neu aufscheinenden Wahrheit ändern könnte, bin ich angehalten, andere Meinungen zu dulden, und zwar selbst solche, die mir unsinnig, falsch und gefährlich vorkommen. Repressionen gegen Andersdenkende, deren Ansichten wir für intolerant halten, verstoßen gegen diese fundamentale Einsicht.
Größtmögliche Einigkeit als Ideal
Wenn aber Toleranz kein Wert an sich ist, muss das Ziel einer Gesellschaft lauten, den Bedarf nach ihr zu minimieren: In einem Gemeinwesen sollte größtmögliche Einigkeit darüber bestehen, was für den Menschen gut und erstrebenswert ist – und diese Einigkeit sollte freilich nicht im Irrtum, sondern in der Wahrheit gründen.
Dann werden die Grundüberzeugungen der Menschen in einem weit höheren Maß konvergieren, als dies unter den Bedingungen einer von Vereinzelung und Spaltung geprägten Gesellschaft der Fall ist.

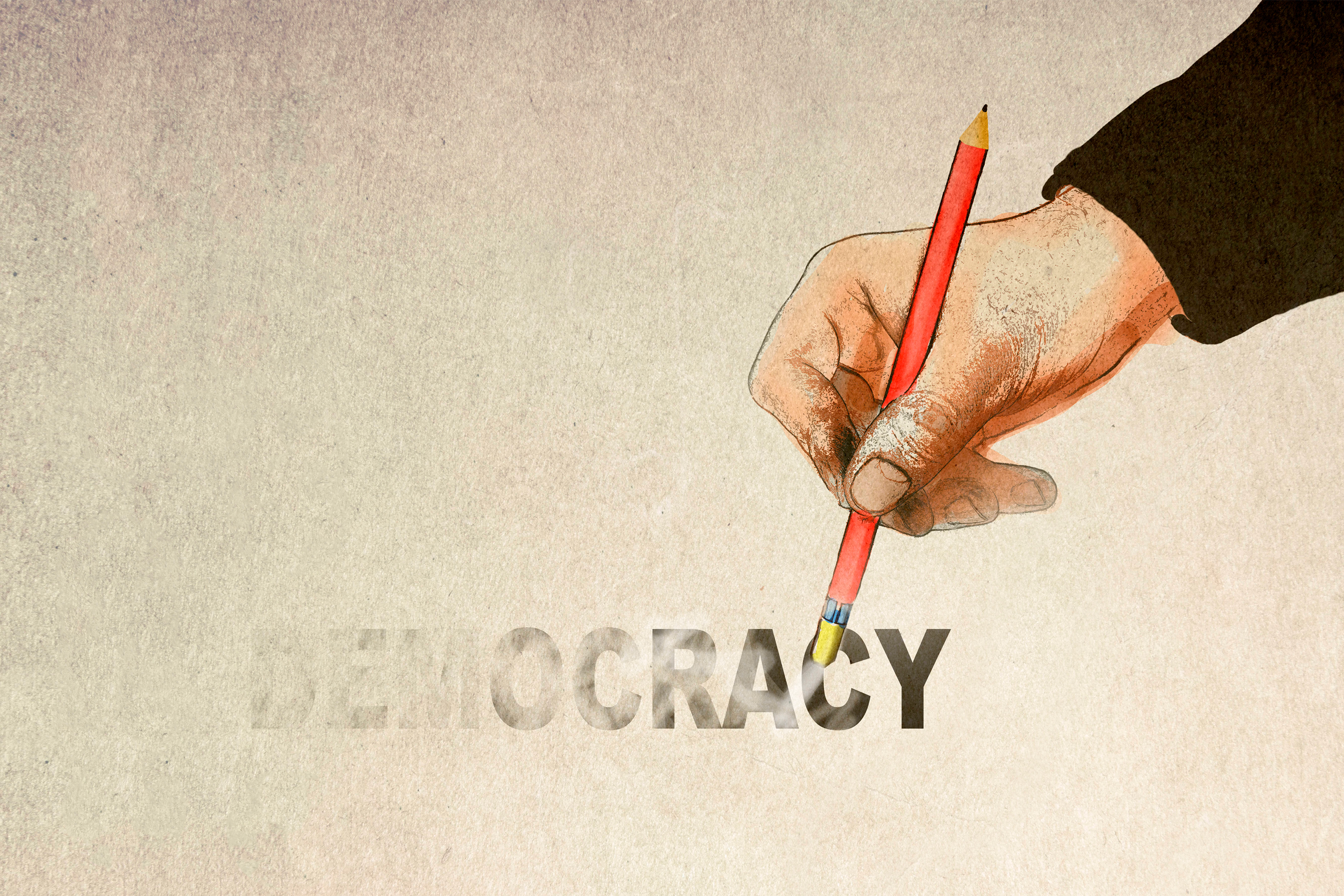
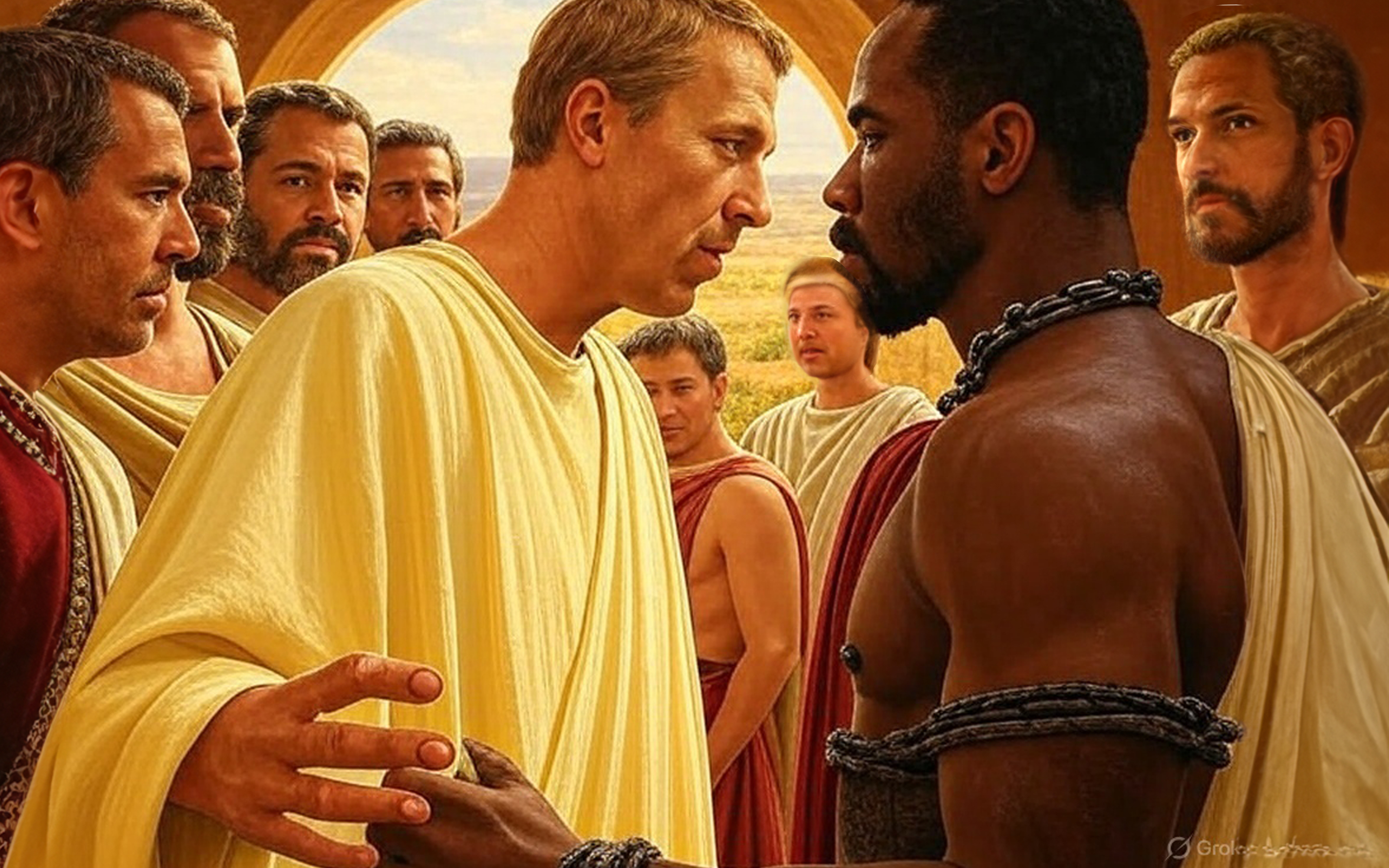


Kommentare
Lieber Herr Dr. Ostritsch sie gehen von einer falschen Grundannahme aus es geht nicht um Toleranz sondern um völlige Gleichberechtigung
„Einigkeit in Wahrheit“, gefällt mir! Das Streben des Menschen in der Umkehr zu Gott, dem einen Guten, wie schön.
Toleranz heißt für mich hier, das Böse, im Evangelium „Unkraut“, zunächst nicht zu bekämpfen. Erst während der Ernte wird aussortiert, das Böse in der Zeit scheint in Gottes Augen einen gewissen Nutzen zu haben, es übt auf viele zuerst auch einen großen Reiz aus! Die Frage ist trotzdem, wo und wie man es existieren lassen sollte (tolerieren). Es gedeiht offensichtlich in Ruinen, „lost places“, in der Destruktivität, im Schummrigen, Stinkenden, dort wo streunende Hunde, streunende Kater und streunende Katzen unterwegs sind, wo das Käuzchen kreischt, wo inhaltsleere Gespenster rumgeistern, die Angst verbreiten wollen. Es kann sich aber auch eine bestimmte Zeit lang tarnen und täuschen (Stichwort „Relativismus“), so dass es nicht sofort zu erkennen ist. Darum pflege man auch im eigenen Leben eine Kundigkeit und Unterscheidungsfähigkeit.
Was aber ist nun böse? Böse im Menschen sind die Wegweiser in die Sinnlosigkeit. Man handle also klug und arglos, d.h. „Lost places“ meiden, man erfreue sich des Lebens jeden Tag aufs Neue, hege und pflege seine Welt und ganz besonders seine Erinnerung und schenke z. B. dem nächsten Menschen, dem man begegnet, ein freundliches Lächeln ohne Erwartung, dass es erwidert wird. Vor allem gehe man jedoch Frust aus dem Weg. Ja, Unkraut existiert, es ist expansiv und aggressiv, aber es darf nicht überhand nehmen und sich frech, unkeusch und fordernd in Szene setzen, denn es ist der Zeit unterworfen und kommt nicht darüber hinaus. Tolerieren in begrenztem Rahmen ja, aber nicht für sich annehmen bzw. sich mit Gottes Hilfe davon befreien. Umkehren zu Gott, ja sagen zum Leben, ja sagen zur Schöpfung, Sinn suchen als ganzer Mensch in Wahrheit.
"Gerade jene, die sich selbst als weltoffen und tolerant verstehen, verhalten sich angesichts abweichender Ansichten höchst intolerant."
Es sind halt Kommunisten, deren Ziel es ist, sie umzuerziehen oder bei anhaltendem Widerstand dafür zu bestrafen. Es geht diesen Leuten nicht um irgendwelche Werte, Utopien oder edlen Ziele. Es geht ihnen um Macht und ein Weg zur Macht ist die Propaganda, man sei so besorgt um die Demokratie und das Gemeinwohl. Marx schreibt irgendwo, dass die Bourgeoisie ihr eigenes Partikularinteresse als Allgemeininteresse durchsetzen könne. Das ist nichts anderes, als das, was diese Leute tun. Sie verkaufen eine hehre Absicht, aber wollen die ganze Macht und werden jeden bekämpfen, der sie daran hindern will.
"Repressionen gegen Andersdenkende, deren Ansichten wir für intolerant halten, verstoßen gegen diese fundamentale Einsicht."
Nein, das tun sie nicht. Repressionen gegen Andersdenkende haben die Aufgabe, die Andersdenker außerhalb der Gruppe zu bestrafen, aber vor allem sind sie Mittel zum Zweck, mögliche Andersdenkende in der eigenen Bubble vor solchen Dummheiten zu warnen. Stalinisten interessieren sich nicht für sie, sondern für die anderen Stalinisten, die auf falsche Gedanken kommen könnten.
Der Aufsatz nimmt sich selbst nicht ernst und stolpert über seine eigenen Annahmen!
1) Fehlbarkeit wird behauptet – aber sofort ignoriert.
Der Text gibt zu, dass jeder irren kann. Ein sinnvoller Gedanke – doch er wird keine fünf Sätze lang ernst genommen.
Denn direkt danach wird gefordert, eine Gesellschaft solle „größtmögliche Einigkeit“ darüber erreichen, was gut und wahr ist.
Das ist, gelinde gesagt, widersprüchlich.
Wer wirklich damit rechnet, dass Menschen sich täuschen können, sollte froh über Abweichungen sein. Abweichende Meinungen sind kein Störfaktor, sondern ein Warnsystem. Sie zeigen, dass sich niemand unbemerkt in eine Sackgasse denken kann.
Einigkeit hingegen ist trügerisch: Auch eine große Mehrheit kann sich gemütlich im Irrtum einrichten. Historisch ist das oft genug passiert.
Wenn man Fehlbarkeit ernst nimmt, ist das Ziel nicht Einigkeit, sondern eine Gesellschaft, in der Irrtümer auffallen dürfen – und zwar laut.
2) Es bleibt unklar wie „Wahrheit“ in gesellschaftlichen Fragen überhaupt festgestellt werden soll.
Der Aufsatz fordert, dass die angestrebte Einigkeit „in der Wahrheit gründen“ müsse.
Schön – aber wie soll das funktionieren?
Gibt es ein Prüfverfahren?
Wer wendet es an?
Wie verhindert man, dass „Wahrheit“ einfach nur das Label der eigenen Überzeugung ist?
Solange das nicht geklärt ist, bleibt die Forderung nach „Wahrheit“ eine leere Hülse.
Sie wirkt eher wie ein rhetorischer Joker: Was mir richtig erscheint, soll bitte auch offiziell als „Wahrheit“ gelten. Das löst kein Problem, sondern schafft ein neues: Wer entscheidet?
In offenen Gesellschaften gibt es kein Wahrheitsamt. Es gibt nur Streit, Argumente, Gegenargumente – und die Freiheit, sich auch hartnäckig zu irren, solange man anderen nicht schadet. Alles andere führt schneller zu geistiger Monokultur, als dem Text lieb sein dürfte.
Fazit
Der Aufsatz stolpert an seinen entscheidenden Stellen über die eigenen Prämissen.
Er fordert Einigkeit, obwohl er Fehlbarkeit anerkennt; und er ruft nach „Wahrheit“, ohne zu erklären, wie man sie erkennt. In Kombination mit den weiteren Problemen – unklare Begriffe, Anekdoten als Argumente, fehlende Unterscheidung zwischen Meinung und Handlung, logische Symmetrien – ergibt sich ein Bild: Das Plädoyer gegen das sogenannte Paradox wirkt selbst paradox.
Wer wirklich rational argumentiert, schützt nicht Einigkeit, sondern die Möglichkeit des Widerspruchs.