Nach vorne zurück zum Common Good
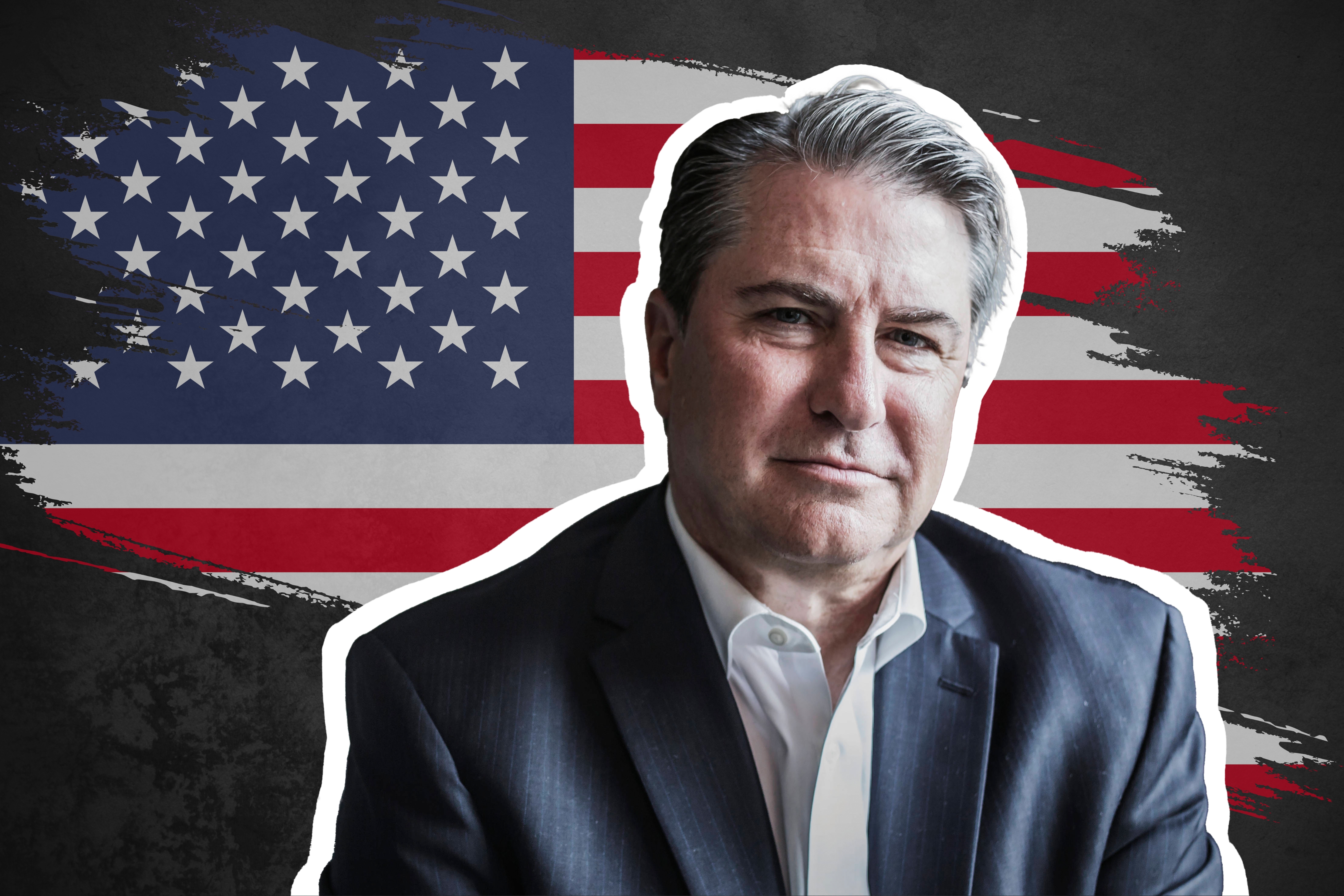
Im Oktober 2024 veröffentlichte ein jüngerer amerikanischer Autor, Nathan Pinkoski, der jetzt am konservativen Center for Renewing America als Senior Fellow arbeitet, einen aufschlussreichen Beitrag auf dem Blog First Things. In dem Beitrag mit dem Titel „Actually Existing Postliberalism“ versuchte Pinkoski zu zeigen, wie sich ein moderner Hyperliberalismus, der seine eigenen kulturellen Wurzeln gekappt hat, immer mehr in Widersprüche verwickelt.
Pinkoski sieht diese Widersprüche vor allem in dem Umstand, dass eine politische Bewegung, die ursprünglich das Individuum vor einem übergriffigen Staat schützen und Staat und Gesellschaft klar trennen wollte, nun Maßnahmen legitimiert, die darauf hinauslaufen, die private Existenz der Bürger zu überwachen und immer stärker zu reglementieren. So alimentiert bei uns der Staat im Namen der „Demokratieförderung“ private Vereinigungen und Institutionen, die ihm helfen sollen, ein bestimmtes Ethos der Toleranz und „Vielfalt“ durchzusetzen, gegebenenfalls auch mit dem Mittel der Denunziation.
Ein klassischer Liberaler würde im Grabe rotieren, wenn er sähe, wie hier die Grenzen zwischen Staat und Gesellschaft verwischt werden, und private Organisationen staatliche Hoheitsfunktionen übernehmen.
Gleiches gilt für eine umfassende Antidiskriminierungsgesetzgebung, die in letzter Konsequenz Firmen zwingen soll, ihr Personal nicht nach Leistung, sondern nach Quoten auszuwählen. Wenn man Minderheiten nicht mehr nur gegen Diskriminierung durch den Staat schützen will, sondern auch durch Privatpersonen und zu dieser Benachteiligung am Ende auch schon bloße verbale Äußerungen zählt, dann gibt man einem allmächtigen Staat eine Generalvollmacht, sich in alle Sozialbeziehungen, selbst die intimsten, einzumischen und sie zu regulieren und zu überwachen; der Liberalismus torpediert sich faktisch selbst.
Eine Gesellschaft ohne gemeinsame moralische Werte und soziale Konventionen
Man könnte es auch anders formulieren und sagen: Das, was heutigen liberalen Gesellschaftsentwürfen fehlt, ist der Bezug zu einem Gerüst gemeinsamer moralischer Werte und sittlicher Verhaltensnormen für den Alltag, die in der Vergangenheit nicht zuletzt die christlichen Kirchen vermittelten und verteidigten.
In einer radikal säkularisierten und noch dazu durch einen enormen Pluralismus der Lebensstile und -entwürfe geprägten Gesellschaft fehlt dieser Rahmen. Eine soziale Ordnung, die nicht mehr in der Lage ist, sich auf eine von der Mehrheit geteilte Vorstellung von moralischen Werten und entsprechende soziale Konventionen zu stützen, wird dabei, wie die englische Journalistin Mary Harrington argumentiert hat, am Ende all jene Aspekte des Lebens bürokratisieren, die sonst von einer gemeinsamen Moral geregelt würden, weil andernfalls das Chaos ausbricht („A liberal social order that declines to embrace a unified moral vision will end up bureaucratising those aspects of life that would elsewhere be governed by morality“).
Ein Konservatismus des „Common Good“ als Antwort auf die Krise der Gegenwart?
Wenn man die Krise der Gegenwart auf diese Weise analysiert, stellt sich die Frage, ob es aus ihr überhaupt noch einen Ausweg gibt. Zu den nordamerikanischen Denkern, die sich auf die Suche nach einer Lösung gemacht haben, gehört der Politikwissenschaftler Patrick J. Deneen, seines Zeichens Professor an der privaten katholischen Universität Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana.
Deneen, Jahrgang 1964, gilt als prononcierter Liberalismuskritiker und Ideengeber für US-Vizepräsident J. D. Vance; er stelle „dem Liberalismus in mehreren Büchern den Totenschein aus“, beschrieb es die FAZ.
Deneens eigene Position ist dabei von einem katholischen Aristotelismus geprägt. Von daher steht er dem jüngst verstorbenen katholischen Philosophen Alisdair MacIntyre (1929-2025) in manchen Aspekten nicht ganz fern, auch wenn dieser sich dagegen gewehrt hat, mit dem konservativen politischen Lager in Verbindung gebracht zu werden.
Deneen hat 2023 seine politischen Vorstellungen in Buchform ausformuliert unter dem Titel: „Regime Change“. Deneens Kritik richtet sich sowohl gegen den Liberalismus an sich wie gegen die progressiven Eliten, die ultraliberale Ordnungsentwürfe propagieren. Unter Liberalismus versteht Deneen eine Weltanschauung, für die die Freiheit des Individuums der höchste Wert ist und die alle Einschränkungen dieser Freiheit durch überkommene soziale Konventionen, durch Traditionen, korporative Bindungen oder nicht-meritokratische Hierarchien aufheben will. Das Ideal ist der Mensch als sein eigener Schöpfer, der keinen überindividuellen objektiven Werten wie bestimmten Vorstellungen von einem sittlichen Leben verpflichtet ist, außer dem Ideal der umfassenden Toleranz.
Dieser Position setzt Deneen eine Haltung entgegen, die er als „common good conservatism“ bezeichnet. Was ist mit Common Good gemeint? Es handelt sich hier um den Begriff des „Gemeinsamen Guten“ (koinon agathon), der in der Ethik des Aristoteles eine zentrale Rolle spielt. Deneen schwebt eine Gesellschaft vor, die sich leiten lässt von gemeinsamen ethischen Werten, von einer allgemein akzeptierten Vorstellung des richtigen und sittlichen Lebens. Für ihn gehören dazu das Bekenntnis zur traditionellen Ehe und Familie – die der Staat fördern sollte – und entsprechend die Ablehnung der Unterstützung von Lobby-Gruppen, die zum Beispiel eine „queere“ Sexualität oder Transsexualität als vorbildlich propagieren.
Mehr Orbán, weniger Trump?
Aber er tritt auch für einen funktionsfähigen Sozialstaat ein, der die wirtschaftlich Schwächeren vor den negativen Auswirkungen des Globalismus und eines entfesselten Kapitalismus schützt. Den Kapitalismus, in diesen Fragen durchaus linke Positionen vertretend, sieht Deneen sehr kritisch.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Ergänzt wird das durch einen Patriotismus, der den Kosmopolitismus der heutigen progressiven Eliten, der „Anywheres“, ablehnt und für wirksame Migrationskontrollen ebenso wie für eine Pflege der nationalen Kultur eintritt. An einigen Stellen klingt an, dass Deneen zum Beispiel einen Politiker wie Viktor Orbán in Ungarn als erfolgreichen Vertreter eines solchen Programms sieht; deutlich kritischer ist seine Haltung zu Donald Trump. Er sieht offenbar in ihm vor allem einen selbstverliebten Egomanen, der allenfalls als Gegner der etablierten liberalen Eliten zeitweilig nützlich sein kann.
Wie die USA laut Deneen gesunden können
Deneen teilt mit den Trump-Anhängern eine tiefe Abneigung gegen das progressive akademische Milieu. Diese linke Bildungselite lasse sich leiten von einem Lebensideal des Hyperindividualismus, der vollständigen individuellen Autonomie, das mittlerweile auch begonnen habe, die Lebensführung der breiten Masse der Bevölkerung zu beeinflussen, dort aber anders als bei der Elite selbst, wo man gelernt habe, radikale Selbstverwirklichung zu einer Quelle der Kreativität zu machen, katastrophale Wirkungen entfalte: Drogenmissbrauch, zerfallende Familienstrukturen, die Unfähigkeit, das eigene Leben so zu organisieren, dass man beruflich erfolgreich ist. Dazu kämen in den USA eine liberale Handels-, Migrations- und Wirtschaftspolitik, die das Einkommen der großen Masse der Bevölkerung stagnieren oder real sogar sinken lasse.
Für Deneen ist klar: Gesunden können die USA – und der ganze Westen – nur, wenn man die jetzige durch eine neue Elite ersetzt, die die Wertvorstellungen der Masse der Bevölkerung zumindest ansatzweise teilt und diese Menschen nicht einfach nur als ungebildete Hinterwäldler verachtet. Man brauche eine ganz neue Führungsgruppe, einen neuen „Adel“, der sich ebenso wie die Masse der Bevölkerung von einem eher konservativen Ethos leiten lasse, das, wenn schon nicht dezidiert christlich, so doch offen sei für Formen religiöser Spiritualität.
Hier setzt Deneen freilich voraus, dass sich die massive Säkularisierung von Gesellschaft und Kultur, die mittlerweile auch die USA erfasst hat, zurückdrehen lässt. Das ist eine kühne Hoffnung. Überdies stellt sich die Frage, wie man in diesem Kontext mit nicht-westlichen Religionen wie dem Islam umgehen will, die man verfassungsrechtlich kaum anders als etwa den Katholizismus behandeln kann, die aber zumindest in bestimmten Spielarten nicht kompatibel sind mit jenem Erbe der westlichen Kultur, das Deneen verteidigen will.
Mit den Methoden Machiavellis auf dem Weg zu einer neuen aristotelischen Ordnung
Es kommt noch ein anderes Problem hinzu. Wie will man die Hegemonie der bisherigen linken Eliten, deren Intoleranz gegenüber Andersdenkenden oft nur noch durch ihre Selbstgerechtigkeit übertroffen wird, brechen? Hier plädiert Deneen dafür, die Methoden einer Politik anzuwenden, die sich an der Philosophie eines Machiavelli orientiert (Deneen denkt hier aber eher an den Republikaner der „Discorsi“ als an den Ratgeber von Alleinherrschern und Autor des „Principe“). Als Ziel soll eine neue aristotelische Ordnung erreicht werden, eine „Mischverfassung“ und ein „Aristopopulismus“, in der sich eine Elite, die diesen Namen wirklich verdient, die Macht teilt mit den einfachen Menschen.
In diesem Sinne hält Deneen einen „popular tumult“, einen Volksaufstand, so wie ihn die Römische Republik als immer wieder auftretendes Phänomen mit kreativer Kraft kannte, wenn man Machiavelli folgt, für durchaus gerechtfertigt, wenn es etwa gilt, eine Erneuerung der Gesellschaft herbeizuführen.
Im Übrigen sieht es Deneen als Aufgabe des Gesetzgebers an, eine „public morality“ zu fördern, notfalls auch durch Zensurmaßnahmen etwa gegen Pornografie. Wer unbegrenzte sexuelle Freizügigkeit und den Konsum von Drogen propagiere oder Religion verächtlich mache, soll, so schlägt es Deneen vor, mit Gegenmaßnahmen der Regierung rechnen müssen.
Das sind sehr weitgehende Vorschläge. Deneen stellt damit der woken öffentlichen Moral von links eine konservative Moral von rechts entgegen, die aber dann in der Praxis schlimmstenfalls ähnlich intolerant wäre.
Sind die Vorstellungen Patrick Deneens realistisch?
Darüber hinaus ist der Pluralismus der Lebensentwürfe, der religiösen oder nicht-religiösen Orientierungen und der Weltanschauungen, ein Kennzeichen moderner Gesellschaften spätestens seit den 1960er Jahren. Eine neue kulturelle Homogenität ist unter diesen Umständen kaum ein realistisches Ziel, auch jenseits des Multikulturalismus, der eine Folge der Massenimmigration ist.
Allerdings eines kann man von Regierungen doch verlangen: dass sie nicht den umgekehrten Weg beschreiten und eine öffentliche Moral versuchen durchzusetzen, die Menschen, die sich älteren, bis vor wenigen Jahrzehnten noch dominanten kulturellen und religiösen Traditionen verpflichtet fühlen, nur noch die Rolle der verstockten Gegner des Fortschritts und der Toleranz zuschreibt, die man mit allen Mitteln umerziehen müsse.
Dem modernen Staat fällt es sicherlich schwer, eine konsensfähige öffentliche Moral zu verkünden, aber er kann zumindest davon absehen, die Reste älterer religiöser und sittlicher Traditionen überall zu demontieren, indem er beispielsweise jeden zwingt, den Gesslerhut der Regenbogenfahne – in ihrer neuesten Fassung – vor öffentlichen Gebäuden zu grüßen oder laut seine Freude über die wachsende Präsenz importierter Kulturen und Religionen im öffentlichen Raum kundzutun, selbst dann, wenn diese sehr aggressiv auftreten und archaisch wirken.
Wenn Deneen solches Gebaren ablehnt, hat er gute Argumente, auch wenn man sonst manche seiner Vorschläge eher skeptisch sehen mag.
Die Situation in den USA ist besonders
Allerdings gilt es auch die besondere Situation in den USA zu bedenken. Dort hat sich der Kulturkampf auch gegen traditionelle christliche Wertvorstellungen schon so zugespitzt, dass es für Konservative, wenn sie überhaupt überleben wollen, zu dem umfassenden „Regime Change“, den Deneen vorschlägt, oft gar nicht mehr so viele Alternativen gibt außer dem kompletten Rückzug ins Private.
Nur hat die „woke“ Linke in den USA diese private Sphäre eben mittlerweile vollständig politisiert. Nichts ist mehr wirklich privat, das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern nicht und die Alltagssprache mit den passenden Pronomen für jede sexuelle Identität oder dem Versuch, mit bestimmten vermeintlich „verletzenden“ Wörtern auch oppositionelle Gedanken zu verbieten, erst recht nicht.
Wenn aber dieser Rückzug ins Private nicht mehr möglich ist, dann darf man sich nicht wundern, wenn konservative Katholiken wie Deneen versuchen, genauso wie ihre linken Gegner, ihre persönliche Moral zur allgemein gültigen zu machen, denn nur so können sie und ihre Lebensweise überhaupt überleben.
Einen Kompromiss, bei dem unterschiedliche Wertegemeinschaften relativ friedlich nebeneinander leben, indem sie sich über gemeinsame Anliegen in einer neutralen, dezidiert vorpolitischen Sprache verständigen, lehnt das progressive Lager jedoch ab. Vor allem, wenn es nicht um die ethnische „Vielfalt“, sondern um die Bekämpfung des politischen Gegners und die Umerziehung der „unaufgeklärten“ Massen geht.
Wer aber in einem kulturellen Bürgerkrieg einmal die Parole ausgegeben hat „The winner takes it all“ und „Wir machen keine Gefangenen“, der sollte sich nicht wundern, wenn die Gegenseite einer ähnlichen Strategie folgt. Und für eine solche Strategie hat Deneen zumindest einen Schlachtplan entworfen, der in den USA vielleicht sogar eine gewisse Chance hat, in Teilbereichen umgesetzt zu werden, auch wenn die Kosten dafür hoch sein werden.





Kommentare