Wenn Worte nicht mehr tragen

Neulich sitze ich in einer Diskussion. Zwei Menschen, beide klug, beide überzeugt von ihrem Standpunkt. Sie sprechen eine ganze Stunde lang miteinander – und doch gehen sie am Ende auseinander, ohne dass sich etwas bewegt. Kein neues Verständnis entsteht, kein Innehalten, kein leises „Da könnte etwas dran sein“. Es bleibt ein Schlagabtausch von Worten, ohne Resonanz.
Und ich frage mich: Warum ist das so? Warum gelingt es Worten heute so selten, uns wirklich zu erreichen?
Wir leben in einer Gesellschaft, in der Sprache allgegenwärtig ist. Wir debattieren, wir posten, wir kommentieren. Bildung, Werbung, Unterhaltung, selbst die Psychotherapie – alles ist von Worten getragen. Und doch spüren wir immer häufiger, dass Worte uns nicht weiterbringen. Argumente prallen ab, Diskussionen enden nicht in Einsicht, sondern in Spaltung.
Vielleicht liegt das Problem nicht allein in den Worten selbst, sondern darin, dass der Raum fehlt, in dem sie ihre Kraft entfalten können – der Raum, in dem wir berührbar sind, ins Nachdenken geraten und uns verwandeln lassen.
Eine psychologische Beobachtung
Warum also erreichen uns Worte so selten? Ein wichtiger Grund liegt in uns selbst. Wir hören nicht unbefangen, sondern immer durch Filter. Wenn jemand spricht, prüfen wir seine Worte nicht an der Wirklichkeit, sondern an unseren eigenen Überzeugungen. Stimmen sie mit dem überein, was wir ohnehin schon denken, fühlen wir uns bestätigt. Widersprechen sie uns, gehen wir sofort in Abwehr.
Dabei halten wir uns gern für rational und vernünftig. Doch in Wahrheit überzeugt uns Logik nur selten. Viel stärker wirken Emotionen, Vertrauen, Sympathie – oder Angst. Worte, die nicht an ein Gefühl gebunden sind, bleiben wirkungslos.
Und noch etwas: Eine Meinung ist heute oft mehr als nur ein Gedanke. Sie ist Teil unserer Identität, Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ein Gegenargument bedroht deshalb nicht nur meine Ansicht, sondern auch mein Selbstbild. Also wehre ich es ab.
Worte verhallen wie Rufe in einer leeren Halle
Das erklärt, warum selbst die klarsten Argumente so oft nicht durchdringen. Stell dir vor, du streitest mit jemandem. Du bringst Belege, Zahlen, Beispiele. Und trotzdem spürst du: Es erreicht ihn nicht. Denn es geht nicht allein um Fakten. Es geht um Zugehörigkeit, um Rechtfertigung, um das Bedürfnis, gesehen zu werden.
In politischen Talkshows lässt sich das besonders deutlich beobachten. Menschen formulieren brillant, sie beherrschen jede rhetorische Figur. Und doch sind die Fronten am Ende verhärteter als zuvor. Worte verhallen wie Rufe in einer leeren Halle – sie schaffen keine Resonanz.
Dazu kommt unsere Zeit. Wir leben in einer Welt der Informationsüberflutung. Jeder redet, jeder will überzeugen. Überall werden wir umworben, manipuliert, überredet. Doch schon die erste große Verführung der Menschheit beruhte auf dem Missbrauch von Worten. Die Schlange im Paradies sprach – und ihre Worte verdrehten die Wirklichkeit. Der Sündenfall begann mit Sprache, die nicht mehr Brücke war, sondern Täuschung.
Soziale Medien: das Echo unserer eigenen Innenwelt
Das Ergebnis ist ein tiefes Misstrauen gegenüber Sprache. Man hört Worte – und denkt sofort: PR, Manipulation, Eigeninteresse. Sprache ist nicht mehr Weg zur Wahrheit, sondern Strategie.
Und dann Social Media: Ein Tweet, hundert Kommentare, null Einsicht. Die Algorithmen zeigen uns genau das, was wir ohnehin schon denken. So entstehen Echokammern. Wir hören immer nur das Echo unserer eigenen Innenwelt. Das Außen, die gemeinsame Realität, wird leiser.
Worte sind dadurch oft performativ geworden. Man spricht sie, um Haltung zu zeigen, um ein Signal zu setzen, nicht um in einen echten Austausch zu treten. Sprache wird zum Instrument – nicht mehr zur Brücke. Und ohne Brücke entsteht keine Resonanz.
Ist wahr das, was sich für mich richtig anfühlt?
Man kann es auch so sehen: Die Ursache liegt tiefer. Sie beginnt mit einer großen Bewegung nach innen.
Schon im 16. Jahrhundert verändert der Protestantismus die religiöse Landschaft. Erlösung kommt nicht mehr durch die Teilnahme am Leben der Kirche, sondern durch innere Gewissheit: „Ich glaube – also bin ich errettet.“ Die Wahrheit zieht in den Innenraum des Einzelnen.
Im 17. Jahrhundert verstärkt sich diese Entwicklung. Europa ist erschüttert von Kriegen, religiösen Konflikten und politischer Unsicherheit. Menschen suchen Halt. René Descartes sitzt in seiner Studierstube und fragt: Was kann ich überhaupt sicher wissen? Er findet nur einen Punkt: Cogito ergo sum – ich denke, also bin ich. Von da an liegt Gewissheit nicht mehr draußen, im Kosmos oder in den Sternen, sondern drinnen – in meinem Kopf, in dem, was ich meine, verstanden zu haben, und später: in dem, was ich fühle.
So verschiebt sich der Maßstab für Wahrheit Schritt für Schritt vom Glauben zur Vernunft, von der Vernunft zum subjektiven Empfinden. Heute ist dieser Prozess radikalisiert: Wahr ist, was sich für mich richtig anfühlt. Die letzte Instanz liegt nicht mehr außerhalb meiner selbst, sondern in meinem Inneren.
Wahrheit verliert ihren gemeinsamen Boden
Das macht den Menschen einerseits freier und unabhängiger. Er braucht keine Autoritäten mehr, keine Kirche, keine Väter, keine Hierarchien, um zu wissen, was gilt. Andererseits verliert Wahrheit damit ihren gemeinsamen Boden. Sie wird zu etwas, das ich in mir spüre – nicht unbedingt zu etwas, das wir miteinander teilen können. Das Vertrauen in die Außenwelt schwindet – ebenso das Vertrauen in überlieferte Strukturen, in die Stimmen der Väter, in die Hierarchien, die einst Orientierung gaben. Und was uns noch verbindet, ist oft nicht mehr gemeinsame Wahrheit, sondern das Resultat von Propaganda – Worte, die künstlich Einigkeit schaffen sollen, ohne dass sie wirklich tragen.
Heute ist diese Entwicklung radikalisiert. Jeder lebt in seiner eigenen Innenwelt, verstärkt durch Algorithmen, durch personalisierte Feeds, durch die ständige Spiegelung des Eigenen. Die gemeinsame Außenwelt, in der man sich begegnen, voneinander lernen und sich korrigieren könnte, löst sich auf.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Und so fehlen uns Resonanzräume: Orte, an denen etwas von außen an uns rührt, uns trifft, uns verwandelt – Orte, an denen wir nicht nur wir selbst bleiben, sondern auch verändert werden. Echte Verbindung lebt nicht von Propaganda, sondern von Resonanz – von dem Moment, in dem uns etwas wirklich berührt und verändert. Damit beginnt die nächste Frage: Was trägt Resonanz, und wohin führt sie?
Leben braucht Resonanz, aber auch Orientierung auf ein Ziel hin
Der Soziologe Hartmut Rosa sagt: Leben gelingt, wenn wir in Resonanz treten. Resonanz heißt: Etwas spricht mich an, ich lasse mich berühren – und ich antworte, indem ich mich verändere. Resonanz ist Beziehung, sie geht über bloße Harmonie hinaus.
Sie kann in Musik entstehen, wenn ein Ton in uns weiterklingt. Sie kann in einem Gespräch entstehen, wenn wir wirklich hören. Sie kann in der Natur entstehen, wenn uns ein Sonnenaufgang ins Herz fällt. Entscheidend ist, dass Resonanz uns verwandelt.
› Lesen Sie auch: Schenkt der deutschen Sprache mehr Liebe!
Doch die Frage ist: Resonanz mit was? Wenn alles Resonanz sein kann, fehlt ihr die Richtung. Denn auch Lüge, Ideologie oder Propaganda können Resonanz erzeugen. Auch das bewegt, auch das klingt nach – aber es führt nicht ins Leben, sondern verführt.
Darum braucht Resonanz Orientierung. Einen Rahmen, der zeigt, was trägt und was zerstört. Für Hartmut Rosa bleibt diese Frage offen; er beschreibt nur die Erfahrung. Im Leben der Kirche aber hat Resonanz ein Ziel: Ich schaue Gott – und in dieser Begegnung verändert sich mein Leben. Resonanz ist dann nicht nur ein Echo, sondern Antwort auf eine Stimme, die größer ist als ich selbst.
Die Ordnung Gottes, die Richtschnur des Glaubens
Früher lag dieser Rahmen selbstverständlich in Gott, im Glauben, in einer Wirklichkeit, die mehr ist als wir. Mit der Verdrängung und Auslöschung Gottes aus dem Leben der Nationen ist diese Orientierung zerbrochen. Resonanz ist möglich, aber sie verliert die Richtung. Sie kann ins Leere laufen, sie kann ins eigene Ego führen oder in die Hände derer fallen, die mit Sprache nur manipulieren.
› Lesen Sie auch: Nimm dir Zeit für die Liebe
Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum unsere Worte heute so oft machtlos sind. Sie erzeugen keine Resonanz mehr – oder sie erzeugen Resonanz ohne Orientierung. Resonanz ohne Richtung ist wie ein Instrument ohne Melodie. Und dort, wo kein größerer Rahmen mehr trägt, entsteht Verbindung oft nur noch als Resultat von Einflüsterungen – Worte, die zwar bewegen sollen, aber unwahr bleiben und innerlich leer sind.
Die Familie als Resonanzraum – Bindungen eingehen, Bindungen halten
Und so stehen wir heute inmitten einer Flut von Worten – und doch fehlt uns oft die gemeinsame Sprache. Wir reden, wir argumentieren, wir kommentieren. Aber unsere Stimmen verhallen, weil Resonanzräume verschwunden sind und die Orientierung verlorengegangen ist.
Resonanzräume entstehen nicht durch Worte oder Ideen, sondern durch gelebte Wirklichkeit. Die Familie ist ein solcher Raum. Doch sie ist weithin zerbrochen und durch das Ideal individueller Selbstverwirklichung ersetzt worden. Freundschaften sind auch kein Ersatz. Familie mag misslingen, doch sie bleibt der wichtigste Ort, an dem Leben gedeihen kann. Darum müssten wir neuen Mut finden, Bindungen einzugehen und sie zu halten.
Fehlen solche Bindungen, zeigt sich das überall: Wir verstehen uns nicht mehr und trennen uns. Politiker sprechen und sprechen, aber überzeugen niemanden mehr; Entscheidungen werden nur noch durchgesetzt. In Gremien und Gesellschaften findet man keine gemeinsame Linie, weil keiner mehr zuhört. Am Ende setzt sich durch, was die Macht vorgibt – nicht, was den Menschen dient. Und so zerfällt, was eigentlich zusammengehören sollte.
Vielleicht liegt darin die eigentliche Aufgabe unserer Zeit: tragfähige Rahmen und Bindungen zu schaffen, in denen Worte wieder gehört werden – und etwas in uns zum Klingen bringen, das Leben erhält.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?



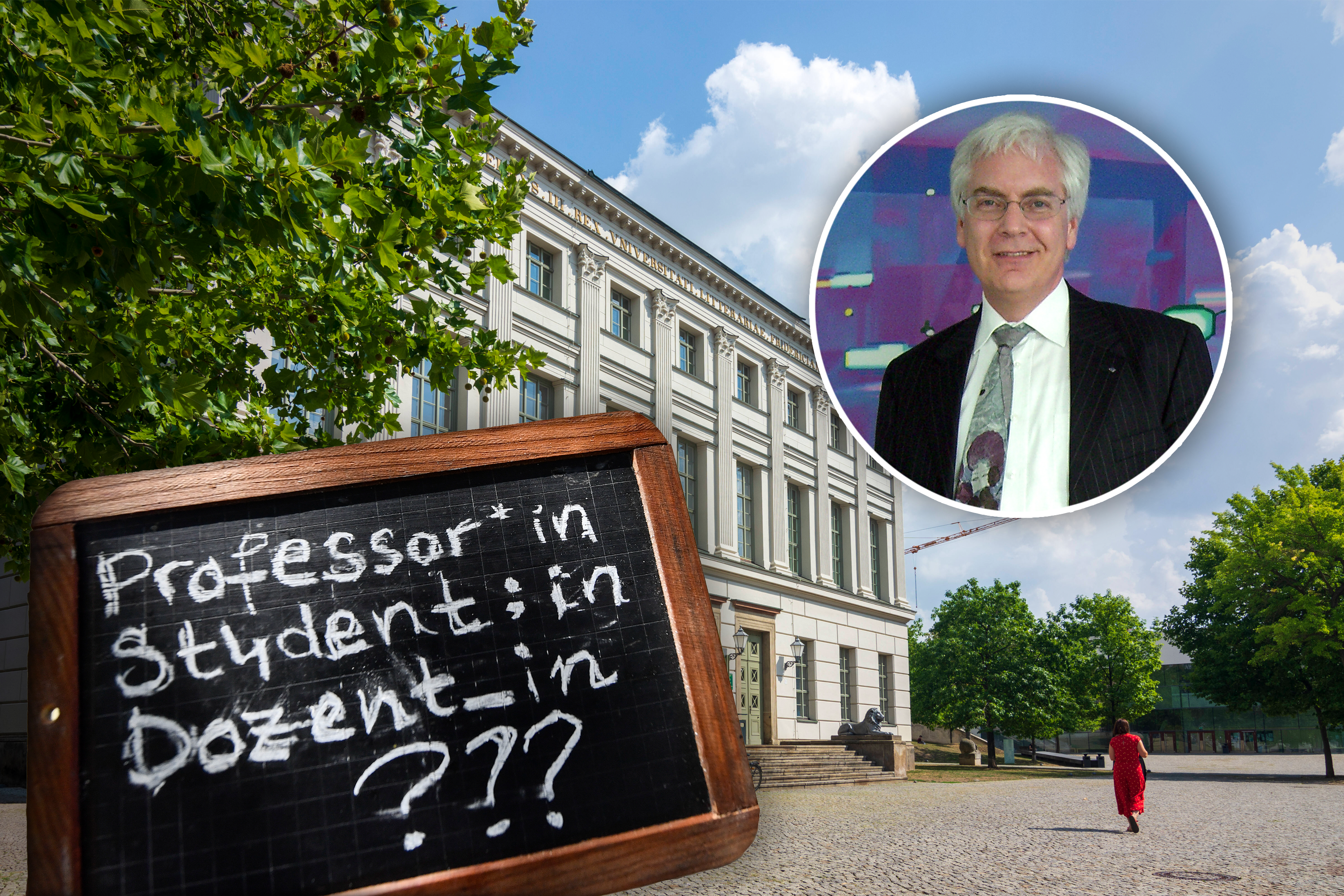


Kommentare
Früher lag dieser Rahmen selbstverständlich in Gott, im Glauben, in einer Wirklichkeit, die mehr ist als wir. …
Jedes Mal, wenn ich so etwas lese, dann frage ich mich, wann genau dieses resonanzreich-resonierende „früher“ eigentlich gewesen sein soll. Wenn man die Propheten in der Heiligen Schrift liest, muss die Antwort wohl lauten: Schon sehr lange. Und die Heilige Schrift gibt auch die Antwort: Vor dem Sündenfall. Warum nimmt die Autorin dies offensichtlich nicht ernst, obwohl sie davon spricht?
Ob uns ein Modesoziologe, der alle paar Jahre sowieso anders heißt, und ein Modebegriff wie „Resonanz“ hier weiterhelfen, weiß ich nicht …
@Braunmüller Ich meine schon, dass diese Annahme berechtigt ist. Das merkt man, wenn man links und rechts schaut beim Lesen über Geschichte. Viele viele Menschen früherer Zeiten wären tiefgläubig. Das ist oft einfach eine Randnotiz. Unsere Zeit wäre ihnen sicherlich sehr seltsam vorgekommen.
Der Nachteil dieses Artikels liegt in der Verwechslung zwischen einer „Willkür der Innenwelt“ und einer geistigen Innenwelt. Das Gegeneinanderstellen von äußerer (objektiver) und innerer (subjektiver) Wahrheit führt leider an dem eigentlich Beabsichtigten vorbei.