Der Verlust des Vertrauens

Die Prognostiker in der Schweiz haben sich gnadenlos vergaloppiert. Erst kürzlich haben sie noch gesagt, dass die Abstimmung über die elektronische Identitätskarte, kurz E-ID, eine klare Sache sein wird. Eine deutliche Mehrheit werde Ja sagen zur Vorlage über die Einführung eines digitalen Ausweises, der künftig allen Bürgern das Leben leichter machen werde.
Dann kam der Abstimmungssonntag, und am Ende war es tatsächlich eine Mehrheit. Aber fernab von Deutlichkeit. Gerade einmal 50,4 Prozent sagten Ja. Ein Zufallsmehr, und das bei einer Abstimmung, bei der Regierung und fast alle Parteien vereint für Annahme geworben hatten. Eine Ohrfeige, bei der nur ein Wimpernschlag fehlte, um aus ihr einen Faustschlag zu machen.
Es waren keine Fortschrittsskeptiker oder Ewiggestrige, die Nein sagten. Es waren Leute, die den Versprechen nicht glauben wollten und konnten. Die E-ID, hieß es, werde freiwillig sein. Die Daten seien sicher und Missbrauch ausgeschlossen. Fast die Hälfte derer, die zur Abstimmung gingen, wollte nicht darauf vertrauen, dass das wirklich so ist. Es war nicht Misstrauen gegenüber der Technik, die diese Personen leitete – sondern gegenüber dem Staat.
Ein frischer Riss
Dieses Misstrauen ist jung. Es ist ein frischer, tiefer Riss, der sich erst in den letzten Jahren aufgetan hat. Der Bruch trägt das Label „Corona“. Damals ist etwas passiert, was in der politischen DNS dieses Landes nicht vorgesehen war: Der Staat trat den Bürgern nicht mehr als Partner gegenüber, sondern als Vormund. „Du darfst nicht raus.“ – „Du darfst nicht arbeiten.“ – „Du darfst deine Eltern nicht besuchen.“ – „Du musst dich nicht impfen lassen, aber …“
Ein Land, das bisher davon lebte, dass der Staat zurückhaltend war, hat plötzlich dessen Kehrseite gesehen. Und diese Bilder haben sich eingebrannt. Man vergisst nicht, wie man in den eigenen vier Wänden eingesperrt wurde, weil Bundesbern beschlossen hatte, dass Spaziergänge im falschen Kanton eine Gefahr darstellen. Man vergisst nicht, wie Politiker über Nacht Verordnungen erließen, ohne Rücksicht auf Verhältnismäßigkeit. Und man vergisst nicht, dass bis heute keine ernsthafte Aufarbeitung stattgefunden hat.
Ausdruck des Misstrauens
Es war die Zeit der Befehle, Einschränkungen und Verbote. Und wer zweifelte, wurde nicht gehört, sondern abgekanzelt. Die Medien als Hofberichterstatter erledigten den Rest. Seither gilt: Ist die Rede von Freiwilligkeit, hören wir unbewusst den geflüsterten Zusatz „… mit Konsequenzen“. Tu, was du möchtest. Lass es ruhig sein. Halte dich an nichts, aber dann wird das Folgen haben.
Es war nur logisch, dass sich viele fragten, ob das bei der E-ID genauso aussehen würde. Man muss sie sich nicht anschaffen – aber vielleicht kann man dann künftig einige Dinge eben nicht mehr tun. Oder der Staat schaut, was wir tun, und belohnt oder bestraft uns dafür. Wer einmal erlebt hat, dass der Staat Fakten willkürlich zurechtbiegt, Freiheitsrechte einkassiert und Kritiker diffamiert, glaubt ihm kein Wort mehr.
Und es ist nicht nur Corona. Schon vorher hat der Staat an seinem Vertrauenskapital gezehrt. Erinnern wir uns an die EU-Verhandlungen, die jahrelang im Hinterzimmer geführt wurden, während man den Bürgern eine andere Version verkaufte. Erinnern wir uns an die Energiepolitik, bei der man jahrelang das Märchen erzählte, die Energiewende sei ohne neue Abhängigkeiten zu haben.
Diese Beispiele fügen sich zu einem Bild zusammen: Der Bürger erkennt, dass er nicht die ganze Wahrheit erfährt. Dass ihm Halbwahrheiten serviert werden, damit er ruhig bleibt. Dass er im Zweifel belogen wird, wenn es der Regierung nützt.
Drei Schritte zur Lösung
Wie aber gewinnt man Vertrauen zurück? Sicher nicht, indem man so tut, als sei nichts geschehen. Genau das ist aber die Masche der Politik: Die Corona-Jahre sollen unter den Teppich gekehrt werden. „Schwamm drüber, wir haben doch alle unser Bestes gegeben.“ Nein, haben sie nicht. Manche haben ihre Macht genossen, manche ihre Profite eingefahren, und alle zusammen haben das Fundament der politischen Kultur erschüttert.
Der Weg zurück wäre simpel. Schritt eins: Eingeständnis. Ein klares Wort, dass Fehler gemacht wurden, dass Maßnahmen überzogen waren, dass Existenzen zerstört wurden. Schritt zwei: Konsequenzen. Wer damals verantwortlich war, müsste sich kritischen Fragen stellen und nicht wieder auf die Kanzel steigen. Schritt drei: Transparenz. Statt immer neue Phrasen über Sicherheit und Datenschutz zu predigen, müsste der Staat seine Karten offen auf den Tisch legen.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Doch genau diese Schritte bleiben aus. Und solange sie ausbleiben, bleibt der Graben. Jede Vorlage, die ein Mindestmaß an Vertrauen verlangt, wird auf Skepsis stoßen – ob E-ID, Gesundheitsdaten oder Energieabgaben. Die Bürger haben gelernt, dass sie den Versprechen aus Bern nicht blind folgen dürfen.
Vielleicht ist das am Ende gar nicht schlecht. Vielleicht ist es sogar heilsam, dass sich eine Gesellschaft daran erinnert: Der Staat ist nicht unser Freund. Er ist eine Notwendigkeit, ein Instrument. Aber er muss kontrolliert werden. Wenn die E-ID daran scheitert, ist das kein Armutszeugnis für die Bürger, sondern ein Weckruf an die Politiker.
Und vielleicht sollte man in Bern endlich begreifen: Vertrauen lässt sich nicht verordnen. Es lässt sich auch nicht erpressen. Es muss verdient werden. Wer es verspielt hat, muss doppelt so hart arbeiten, um es zurückzugewinnen. Oder er wird eben scheitern. Auch wenn es im Fall der E-ID jetzt noch einmal knapp „gut“ gegangen ist.





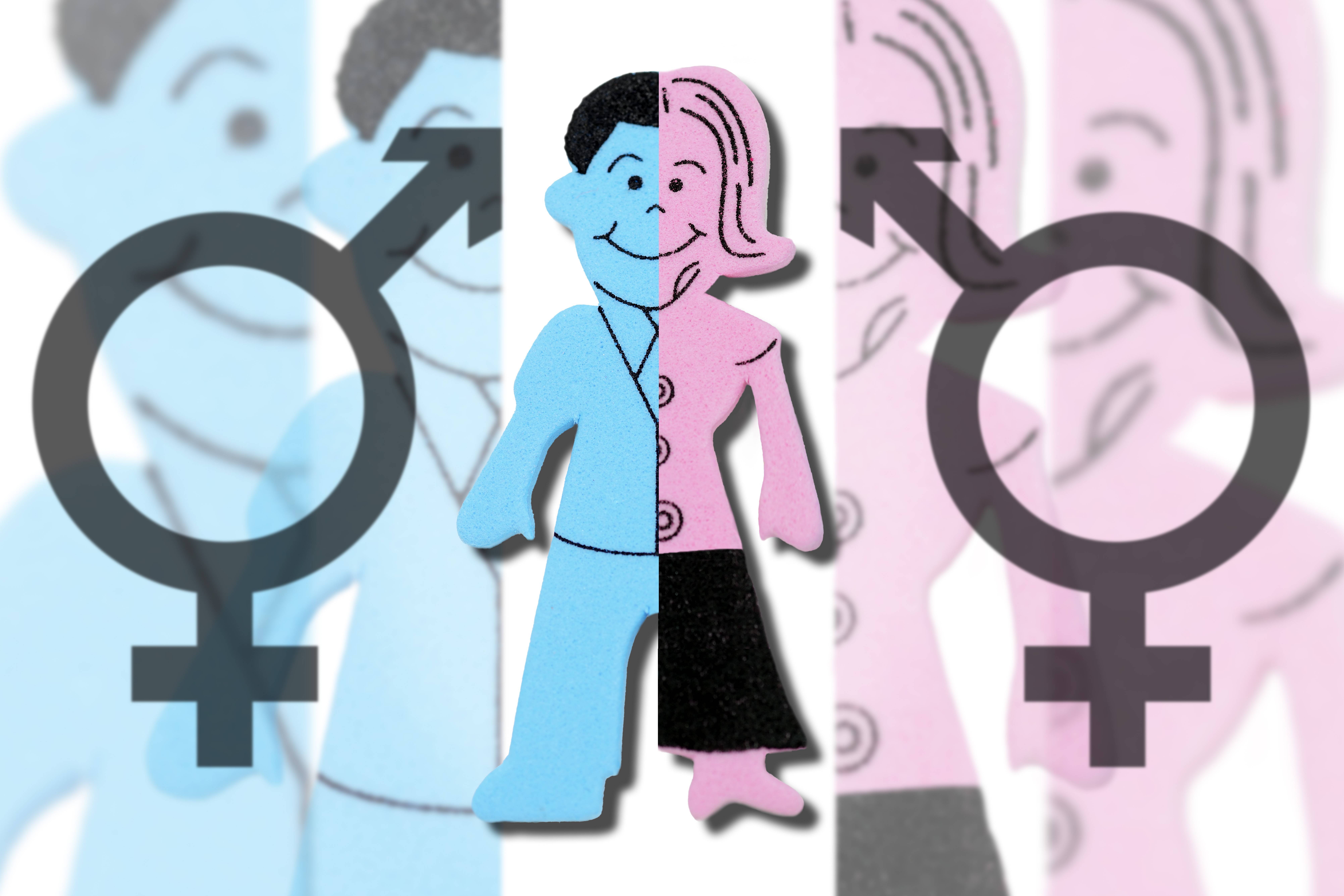
Kommentare
Ich erlaube mir als Österreicher eine praktische Frage: wie hoch war die Wahlbeteiligung?
@Thomas Kovacs
Die Wahlbeteiligung lag bei rund 50 %