Spuren eines Vierteljahrhunderts: Veränderungen einer Übergangszeit

Das erste Viertel des 21. Jahrhunderts bescherte uns in zuweilen atemberaubender Geschwindigkeit Veränderungen, teilweise sogar einen dramatischen Wandel. Wir ahnen zunehmend, was uns bald erwartet: Vor allem dank der Künstlichen Intelligenz kündigt sich eine neue Ära – vielleicht sogar ein Epochenbruch – in der Menschheitsgeschichte an.
Die Jahre 2000 bis 2025 haben alle Merkmale einer Übergangszeit, mit einschneidenden Brüchen für die Gesellschaft, aber auch grundlegenden, wenn auch oft kaum wahrgenommenen Entwicklungen. Hier soll es nicht um große Politik, globale Verwerfungen, Kriege oder Klima gehen.
Es ist ein Blick auf unsere Alltagskultur, auf Arbeitswelt, Familie und Freundeskreis, auf unsere Gewohnheiten und unsere Kommunikation, aber auch auf den Wandel in Stadt und Land. Auf Entwicklungen, Prioritäten und Werte, auf folgenreiche soziale und strukturelle Veränderungen. Es sind 25 Momentaufnahmen eines zuweilen gravierenden, oft unmerklichen Wandels unserer Welt – in Zahlen, Fakten und Trends.
1. Medizinische Durchbrüche
In der Medizin gab es große Fortschritte. Neue Medikamente und Operationsmethoden haben den Schrecken mancher Erkrankungen deutlich vermindert. Die mRNA‑Impfstofftechnologie gegen COVID‑19 verspricht neue Wege in Krebstherapie und individualisierter Medizin. Dank der Genforschung können früher als unheilbar geltende Erberkrankungen teilweise sogar besiegt werden. Spürbare Fortschritte gibt es auch bei künstlichen Organtransplantaten und Immuntherapie. Robotergestützte, bildgesteuerte und invasive Operationstechniken sowie Künstliche Intelligenz in der Diagnostik bedeuten enorme Fortschritte.
2. Weniger Volkskrankheiten, mehr psychische Probleme
Die Menschen werden immer älter. Wer vor 25 Jahren in Deutschland geboren wurde, hatte statistisch eine durchschnittliche Lebenserwartung von knapp 78 Jahren. Heute beträgt sie bei Neugeborenen fast 81 Jahre. Klassische Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Leiden wurden zurückgedrängt. Enorm zugenommen haben verschiedene Formen psychischer Erkrankungen. Die Zahlen von „Burn-out“-Diagnosen und Depressionen (vor allem bei jungen Erwachsenen) sind deutlich gestiegen. Konservative Schätzungen sprechen von einer Steigerung von 100 bis 200 Prozent. Psychische Erkrankungen waren 2000 für 6,6 Prozent aller Krankheitstage verantwortlich, heute sind es mehr als 15 Prozent. Als dramatisch gilt die Zunahme psychischer Leiden – wie ADHS und Essstörungen – bei Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig hat Studien zufolge die physische Fitness von Kindern dramatisch abgenommen.
3. Die Arbeitswelt verändert sich deutlich
Die Zahl der Fabrikarbeiter ist seit dem Jahr 2000 drastisch gesunken: In den neunziger Jahren arbeitete fast jeder zweite Arbeitnehmer in der Fabrikation, heute nur noch jeder vierte. Fast halbiert hat sich die Zahl der Menschen im Agrarsektor (heute sind es knapp 600.000 Personen). Ähnlich viele arbeiten im Finanzbereich – dort ging jeder vierte Arbeitsplatz verloren. Mit ca. 1,3 Millionen Beschäftigten in der IT- und Kommunikationsbranche hat sich diese Zahl fast verdreifacht.
Sechs Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen bedeuten ein Plus von fast 50 Prozent. Es gibt immer weniger Bäcker und Metzger. Mit rund 10.000 Metzgereibetrieben gibt es heutzutage nur noch halb so viele. Ähnlich ist es mit eigenständigen Bäckereien. Hingegen sind Großbäckereien und Filialketten enorm gewachsen.
4. Weniger Familien, mehr Single-Haushalte

Die Menschen in Deutschland leben immer seltener in Familien. Im Jahr 2000 gaben noch 81 Prozent der Deutschen an, in einem Mehrpersonenhaushalt zu wohnen. 2023 waren es nur noch 72 Prozent. Die Zahl der Singlehaushalte stieg von 36 auf über 42 Prozent; in manchen Städten wie Frankfurt oder Köln leben die meisten Menschen allein. Die Zahl der Rentner hat sich seit 2000 von 19 auf knapp 22 Millionen, die Zahl der Arbeitnehmer (die in die Rentenkassen einzahlen) von etwa 39 auf 40 Millionen erhöht.
5. Es fehlen Kinder, die Immigration nimmt zu
Der demografische Trend verändert Deutschland. Vor 25 Jahren lag die Geburtenrate der Frauen bei 1,38, heute ist sie unwesentlich niedriger. Diese Werte bedeuten zwangsläufig eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung, da die Geburtenrate bei etwa 2,1 liegen müsste, um den Einwohnerstand ohne Immigration zu halten. Schon die aktuelle Geburtenrate von weniger als 1,4 ist vor allem den Frauen mit Migrationshintergrund zu verdanken, die deutlich mehr Kinder haben als die anderen Frauen. Die Fertilitätsrate bei Frauen mit Migrationshintergrund lag 2024 bei 1,84 Kindern pro Frau.
Im Jahr 2000 lebten in Deutschland rund 14 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind etwa 18 Prozent der Gesamtbevölkerung. Heute liegt diese Zahl bei etwa 24 Millionen, was einem Anteil von rund 29 Prozent entspricht.
6. Mehr Abiturienten und Akademiker
Etwa ein Drittel eines Jahrgangs machte vor 25 Jahren Abitur, heute sind es ungefähr die Hälfte. Die Zahl der Akademiker hat deutlich zugenommen. Sowohl die Zahl der Menschen mit Hochschulabschluss (heute etwa jeder Dritte zwischen 25 und 64 Jahren) als auch die der Studenten (knapp drei Millionen) haben sich ungefähr verdoppelt. Es gibt heute aber mehr junge Menschen – 20 Prozent der unter 35-Jährigen – ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Vor 25 Jahren lag der Anteil bei 15 Prozent.
7. Neue Arbeitsmöglichkeiten zu Hause oder auf Bali
Fast ein Viertel der Arbeitnehmer in Deutschland – rund elf Millionen – arbeiten heute zeitweise oder dauerhaft von zu Hause aus. Homeoffice war vor 25 Jahren nahezu unbekannt. Dank der globalen, digitalen Vernetzung gibt es inzwischen Hunderttausende von Beschäftigten, die ihren Arbeitsplatz in einem Café auf Mallorca oder auf einer Terrasse auf Bali haben. Geschätzt gibt es zwischen 50.000 und 200.000 dieser digitalen Nomaden aus Deutschland.
8. Gasthaus-Sterben

Die Zahl der deutschen Gasthäuser und Speiselokale hat deutlich abgenommen. Dies erinnert an den Schwund der Pubs in England, der Brasserien in Frankreich oder der Trattorien in Italien. Die Fachverbände schätzen, dass es heute nur noch etwa 10.000 traditionelle deutsche Wirtshäuser und Speiselokale gibt, vermutlich halb so viel wie um die Jahrhundertwende. Dabei blüht die Gastronomie insgesamt: 2.500 vegane Lokale gibt es in Deutschland, vor 25 Jahren waren diese fast unbekannt. Massiv zugenommen hat die Menge der Dönerimbisse – von 400 auf 16.000 Imbisse, der asiatischen Lokale (von 3.000 auf 12.000), der Pizzerien, die sich mit 18.000 verdoppelt haben, und der Fast-Food-Ketten, deren Anzahl sich vervielfacht hat.
9. Weniger Fleisch, weniger Alkohol
Der durchschnittliche Fleischverzehr lag 1995 in Deutschland bei etwa 65 Kilogramm pro Kopf und Jahr, 2023 waren es nur noch 52 Kilogramm. Gleichzeitig sank der Alkoholkonsum um etwa 20 Prozent. Statistisch konsumiert jeder Bundesbürger im Jahr durchschnittlich zehn Liter reinen Alkohol, meist in Form von Bier und Wein. Während um die Jahrhundertwende knapp zwei Prozent der Erwachsenen angaben, sich vegetarisch zu ernähren, sind es heute etwa acht Prozent. Veganer gab es früher sehr wenige, heute sind es Umfragen zufolge fast zwei Prozent.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Das Konsumverhalten in Deutschland hat sich Studien zufolge in den 25 Jahren auch grundsätzlich stark gewandelt. Während beispielsweise um die Jahrtausendwende noch sehr viel mehr als heute der Besitz materieller Güter – beispielsweise Auto, Eigenheim und Markenkleider – den sozialen Status definierte, sind es heute vor allem Erlebnisse wie Reisen sowie Authentizität, die sich durch einen eigenen Stil oder politisches Engagement zeigt.
10. Die digitale Welt dominiert, das globale Dorf wird Realität

Vor 25 Jahren gab es zwölf Millionen Handys, heute etwa 84 Millionen Smartphones. Die Vision des globalen Dorfes von Marshall McLuhan ist fast schon Wirklichkeit: Kommunikation in Echtzeit ist weltweit und oft kostenlos möglich. Der Zugang zu Informationen auf allen Gebieten ist gigantisch. Im Jahr 2000 besaßen gerade einmal 37 Prozent der Deutschen einen Internetanschluss, wie das Statistische Bundesamt dokumentiert. Heutzutage sind es über 95 Prozent. Mittlerweile trifft der Satz des Soziologen Hartmut Rosa zu: „Der Mensch des 21. Jahrhunderts lebt in einem permanenten Zustand der Erreichbarkeit und des Vergleichs.“
11. Weniger Zeit für Freunde und Familie
Die digitale Welt drängt in den Alltag: Statistisch gesehen verbrachte man privat vor 25 Jahren keine zehn Minuten an Handy oder Laptop, aber etwa vier Stunden vor dem Fernseher. Inzwischen sinkt der TV-Anteil und das Digitale gewinnt enorm an Bedeutung, vor allem bei den jüngeren Leuten. Bildschirme dominieren heute mehr als zwei Drittel der gesamten Freizeit. Die Zeit mit Freunden und Familie sank statistisch von täglich ca. 2,5 auf 1,5 Stunden. Mit etwa 30 Minuten jeweils für Sport und Lesen hat sich im Durchschnitt wenig verändert. Junge Menschen treiben allerdings mehr Sport als ihre Altersgenossen früher. Dafür lesen sie etwas weniger.
12. Mehr Internet und Härte im Liebesleben
Früher lernte man sich im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder in Vereinen kennen, heutzutage immer häufiger im Internet. Umfragen zufolge haben sich zwischen 25 und 40 Prozent der Paare im Alter unter 40 Jahren auf Dating-Apps getroffen. Etwa jeder dritte Deutsche sucht nach Schätzungen der Branche online nach einem Partner. 74 Prozent der Generation Z, also Personen, die nach dem Jahr 2000 geboren sind, gaben in Umfragen an, Datingplattformen zu nutzen. Zugenommen hat statistisch gesehen – wobei es sich dabei meist um Umfragen handelt – die Zahl der Sexualpartner junger Menschen. Dramatisch zugenommen hat offenbar das „Ghosting", das plötzliche, kommentarlose Verschwinden aus einer Beziehung. Zwei Drittel aller unter 30-Jährigen hat einer Studie zufolge Erfahrungen mit „Ghosting“ gemacht.
13. Das Web verdrängt das Gedruckte
Mit 13 Millionen Gesamtauflage hat sich die Zahl der gedruckten Zeitungen ungefähr halbiert. Etwa die Hälfte aller Bundesbürger informiert sich in erster Linie über digitale Quellen. Dabei spielen sowohl traditionelle als auch neue Medien eine Rolle, beispielsweise soziale Plattformen, Blogs und Beiträge von Influencern. Vor allem junge Menschen unter 35 Jahren haben sich von den traditionellen Medien zum großen Teil verabschiedet. Vor 25 Jahren galten noch 36 Prozent der Bundesbürger als regelmäßige Buchleser, also mehr als 28 Millionen. Heute sind es nur noch 27 Prozent. Die Buchbranche verzeichnet derzeit eine Abnahme der Buchkäufer von jährlich zwischen 500.000 und einer Million. Die Zahl der Buchneuerscheinungen hat sich von 78.000 jährlich auf 67.000 reduziert.
14. Das Christentum verliert, der Islam gewinnt

In den 90er Jahren gab es 57 Millionen Christen in der Katholischen oder Evangelischen Kirche, heute nur noch knapp 40 Millionen. Regelmäßig besuchte vor 25 Jahren noch fast jeder fünfte Katholik den Gottesdienst, heute sind es nicht einmal sechs Prozent. Weniger als drei Prozent der evangelischen Christen gehen am Sonntag in die Kirche, vor 25 Jahren waren es zumindest sechs Prozent. Die Zahl der katholischen Priester sank von rund 20.000 auf etwa 11.500. Bei evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern gab es einen Rückgang von ca. 23.000 auf 18.000. Seit den 1990er-Jahren wurden in Deutschland mehrere tausend Kirchengebäude – vor allem evangelische Gotteshäuser – säkularisiert. Die Zahl der Muslime hat sich mit knapp sechs Millionen Menschen heute ungefähr verdoppelt. Inzwischen gibt es geschätzt 2.800 Moscheen im Land.
15. Gewerkschaften verlieren, Vereine gewinnen
Hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 2000 noch etwa 7,8 Millionen Mitglieder, so sind es heute ca. 5,6 Millionen. Am meisten büßte die IG Bau ein, sie verlor etwa die Hälfte ihrer Mitglieder. In deutschen Sportvereinen sind heute knapp 29 Millionen Menschen organisiert, im Jahr 2000 waren es etwa 23,5 Millionen. Das Deutsche Rote Kreuz mit heute rund drei Millionen Mitgliedern hat fast 1,4 Millionen Mitglieder verloren. Umweltorganisationen wie NABU, BUND oder der Deutsche Alpenverein haben mit 1,1 Millionen Mitgliedern ihre Zahl seit 2000 fast verdreifacht. 1,3 Millionen Menschen sind in Schützenvereinen Mitglied, fast 300.000 weniger als vor 25 Jahren. Die geschätzte Zahl von zwei Millionen Mitgliedern in Gesangsvereinen blieb ungefähr unverändert, die der Karnevalsvereine hat sich von 150.000 auf 200.000 erhöht. Viele hunderttausend Menschen sind in Freiwilligen Feuerwehren oder dem Technischen Hilfswerk aktiv.
16. Sicherheit
Spätestens mit den Terroranschlägen von „9/11“ in den USA setzte weltweit ein gravierender Wandel im Sicherheitsdenken ein. Spürbar ist er auf Flughäfen, Ämtern, in Firmen, Innenstädten, auf Veranstaltungen, Volksfesten und beim Karneval. Nie gab es in Deutschland mehr Polizisten als heute – es sind 335.000. Private Sicherheitsdienste beschäftigen 290.000 Personen, 1997 waren es nur 175.000. Zwischen der Jahrtausendwende und heute hat sich das Sicherheitsempfinden der Deutschen spürbar gewandelt – nicht nur in Reaktion auf reale Kriminalitätsentwicklungen, sondern auch unter dem Eindruck gesellschaftlicher Debatten, globaler Krisen und neuer Bedrohungsszenarien. Die Menschen haben heute polizeilichen Studien zufolge weniger das Gefühl von Sicherheit als früher. Etwa ein Viertel der Menschen gibt heute an, sich unsicherer zu fühlen als früher. Mehr Menschen meiden vor allem in Städten bestimmte Orte. Die Nachfrage nach Sicherheitstechnik hat sich dem Branchenverband zufolge von mit fast fünf Milliarden Euro fast verdoppelt. Rasant gestiegen ist die Angst vor Cyber-Kriminalität.
17. Viel Gewalt, mehr Gruppenvergewaltigungen
Das Ausmaß an Gewaltkriminalität ist Statistiken zufolge seit 2000 auf hohem Niveau geblieben – zuletzt waren es 217.000 Fälle. Sie sind sogar leicht zurückgegangen. Die Zahl der Sexualdelikte – mit großer Dunkelziffer – hat deutlich zugenommen. 1999 wurden nur 89 Gruppenvergewaltigungen gemeldet, 2023 waren es mehr als 700. Abgenommen hat die Zahl der Mordfälle. Der Anteil der Täter mit ausländischen Wurzeln – insbesondere bei Sexualdelikten – ist überproportional, teilweise extrem hoch. Experten betonen, dass bei Migranten der Anteil junger Männer ohne Familie und Job sehr hoch ist. Soziologisch wird diese Gruppe in allen Gesellschaften besonders oft straffällig. Gewalt bei Kindern und Jugendlichen nahm kaum zu, hatte aber vor mehr als 15 Jahren einen Höchststand. Die Zahl der minderjährigen Verdächtigen bei Gewalttaten ist 2024 in Deutschland auf über 45.000 gestiegen, mit einer vermutlich hohen Dunkelziffer. Mobbing – insbesondere im Internet – hat dramatisch zugenommen.
18. Ängste vor Krieg und Zukunft
Während in den 90er Jahren durch den US-amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama – wenngleich etwas missverstanden – ein „Ende der Geschichte“, verbunden mit einem weltweiten Trend zur Demokratie und dem Ende kriegerischer Konflikte zumindest in Europa, formuliert wurde, dominiert inzwischen Aufrüstung weltweit. Vor allem angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine scheint die einst weitverbreitete Sehnsucht nach „Frieden schaffen ohne Waffen“ heute bedeutungslos. In der Gesellschaft stellen Wissenschaftler die Zunahme von Ängsten fest, sei es vor Klimawandel, Krieg oder gesellschaftlichen Spannungen und allgemein der Zukunft. „Wir haben uns von einer Risikogesellschaft zu einer Angstgesellschaft entwickelt“, schrieb der Zukunftsforscher Matthias Horx.
19. Die Einsamkeit nimmt zu

In den Industriestaaten reagiert inzwischen auch die Politik auf die zunehmende Vereinsamung von Menschen aller Altersgruppen. In Großbritannien und Japan gibt es dafür eigene Ministerien, andere Länder haben spezielle Programme aufgelegt. Die Krise von Familie, Ehe und Religionsbindung begünstigt vor allem die Alterseinsamkeit. Jugendliche und junge Menschen, die Außenseiter sind oder sich als solche fühlen, ziehen sich in digitale Welten zurück. „Die digitale Vernetzung führt paradoxerweise zur Isolation. Man kommuniziert mehr denn je und ist gleichzeitig einsamer denn je“, schrieb der koreanische Philosoph Byung-Chul Han.
20. Die Verschönerung des Körpers ist ein großes Thema
Immer mehr Menschen tragen ein Tattoo als Körperschmuck. Waren vor 25 Jahren weniger als zehn Prozent der Deutschen über 14 Jahren tätowiert, so sind es heute Schätzungen zufolge mehr als 20 Prozent. Besonders oft haben junge Menschen und von ihnen vor allem Frauen Tattoos. Einer „Schönheitsoperation“ unterzogen sich Ende der 1990er-Jahre geschätzt weniger als 100.000 Menschen. Dies betraf vor allem Nasenkorrekturen, Lidstraffungen und Brust-OPs. Heute berichtet die Branche von mehr als einer halben Million ästhetisch-chirurgischer Eingriffe pro Jahr. Die Zahl der Nagelstudios hat sich von etwa 1000 vor 25 Jahren auf rund 25.000 erhöht. Waren früher etwa zwei Millionen Mitglieder in Fitnessstudios, so sind es heute mehr als zehn Millionen.
21. Gute Manieren und Höflichkeit schwinden
Schon in der Antike lamentierte man über die Verwahrlosung der guten Sitten. Allerdings scheint heute das Schwinden des sozialen Konsenses über Kleidung, Manieren, Stil, Etikette und Sprache eine dramatische Dimension anzunehmen. Die Mehrheit der Bundesbürger glaubt Umfragen zufolge, dass die Unfreundlichkeit seit Jahren zunehme. Der Bedeutungsverlust von Höflichkeit, Rücksicht und Anstand ist unübersehbar. Telefonieren und lautes Sprechen in Bussen, Bahnen, Lokalen und Wartezimmern sind weit verbreitet. Wer sich beschwert, gilt als Querulant. Professoren und Lehrer klagen zunehmend über Unpünktlichkeit und Unhöflichkeit von Studenten und Schülern. Die Gastronomie berichtet von einer dramatischen Zunahme aggressiver und respektloser Gäste. „Aggressives Fahrverhalten“ sei heute häufiger denn je, berichten Versicherungen.
22. Mehr Respekt und Sensibilität für Minderheiten
Sprache und Verhalten, die gegenüber Angehörigen ethnischer, religiöser oder sexueller Minderheiten als rassistisch, geringschätzig oder diffamierend empfunden werden, sind zunehmend verpönt. Eine Kultur der Wokeness hat das Ziel, niemanden zu diskriminieren und auszuschließen. Ungeachtet vieler befremdlicher Auswüchse dieser Ideologie ist die gewachsene Empfindlichkeit bei der Missachtung von Randgruppen für die Betroffenen oft ein Gewinn. Auch die Durchsetzung der „Political Correctness“ soll dem hehren Ziel von mehr Gerechtigkeit und weniger Unterdrückung oder Ausbeutung dienen.
23. Das Duzen breitet sich weiter aus
An Universitäten, in der IT- und Kommunikationsbranche ist Duzen üblich. Mittlerweile duzen sich die Mitarbeiter in etwa einem Drittel der Firmen vollständig. Nur noch drei Prozent der Unternehmen verwenden durchgängig das „Sie“. Auch im Alltag wird immer häufiger und ungefragt geduzt, ebenso duzen viele Online-Unternehmen die Kunden. Vor allem in der jungen Generation wird kaum noch gesiezt. Das Siezen von Vorgesetzten oder das Aufstehen bei der Begrüßung wird einer Untersuchung zufolge in über 60 Prozent der Unternehmen nicht mehr praktiziert.
24. Schlabberlook statt Krawatten und Anzüge

Wurden früher etwa 15 Millionen Krawatten importiert, waren es 2024 nur noch fünf Millionen. In Büros und Ämtern haben sich die Kleidervorschriften deutlich gelockert. Im Straßenbild dominiert lässige, bequeme, sportliche Freizeitkleidung. Selbst in vielen Hotels und Restaurants, in der Bahn und im Flugzeug gibt es Gäste in Badeschlappen, Jogginghosen oder Schweißhemden. In Theater und Oper wird die klassische Garderobe massiv zurückgedrängt.
25. Verrohung der Sprache, insbesondere im Netz
Soziale Plattformen sind erfüllt von Beschimpfungen, Beleidigungen und Häme. Das Klischee der früheren „Stammtischparolen“ findet sich heute in der digitalen Kommunikation millionenfach verbreitet. Studien zufolge hat allein seit 2015 die Zahl beleidigender und aggressiver Kommentare um etwa 30 Prozent zugenommen. Das Bundeskriminalamt registriert eine rasante Zunahme von Hassrede im Netz. Soziologen sprechen von einer „sozialen Erosion“, dem Rückzug ins Private und Digitale, der den Mangel an direktem, respektvollem Miteinander vorantreibe. Schulen berichten von einer zunehmenden Aggressivität und verstärktem Mobbing. Studien belegen eine zunehmende Vulgarisierung in Diskussionsforen, Unfähigkeit oder Unwillen zur differenzierten Argumentation und einen Siegeszug primitiver Kraftausdrücke auch in gebildeten Schichten. Bildungsinstitute sprechen von einem deutlich geringeren aktiven Wortschatz junger Menschen als früher.
Wohin führt der Weg in den nächsten 25 Jahren?
Die vergangenen 25 Jahre waren für die Menschen in Deutschland historisch betrachtet keineswegs schlechte Jahre, schon gar keine Katastrophe. Allerdings sind viele Entwicklungen im Land und in der Welt tief beunruhigend. Es gibt gute Gründe, mit manchen Sorgen vorauszuschauen.
Sehr vieles spricht dafür, dass die kommenden 25 Jahre noch unruhiger und dramatischer sein werden. Dass sie noch deutlich mehr die Welt verändern werden als die vergangenen 25 Jahre, die uns neben manchen positiven Entwicklungen auch mehr Instabilität, schreckliche Kriege, Terroranschläge und Pandemien bescherten.
Insbesondere die Künstliche Intelligenz wird die Welt in einem bisher kaum vorstellbaren Maße verändern. Die Möglichkeiten von KI sowie Quantencomputer werden die Welt vermutlich heftig durcheinanderwirbeln – mit unbekanntem Ausgang. Nicht wenige fürchten eine Bedrohung unserer Zivilisation, manche sogar der Menschheit. Auch angesichts der vielen Ungewissheiten bezüglich der Zukunft ist mit Sicherheit die Kenntnis von Fakten und Trends sowie von Hintergründen und unserer Geschichte hilfreich. Ebenso ein kühler, analytischer Kopf und eine gute Portion Gottvertrauen.
> Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?




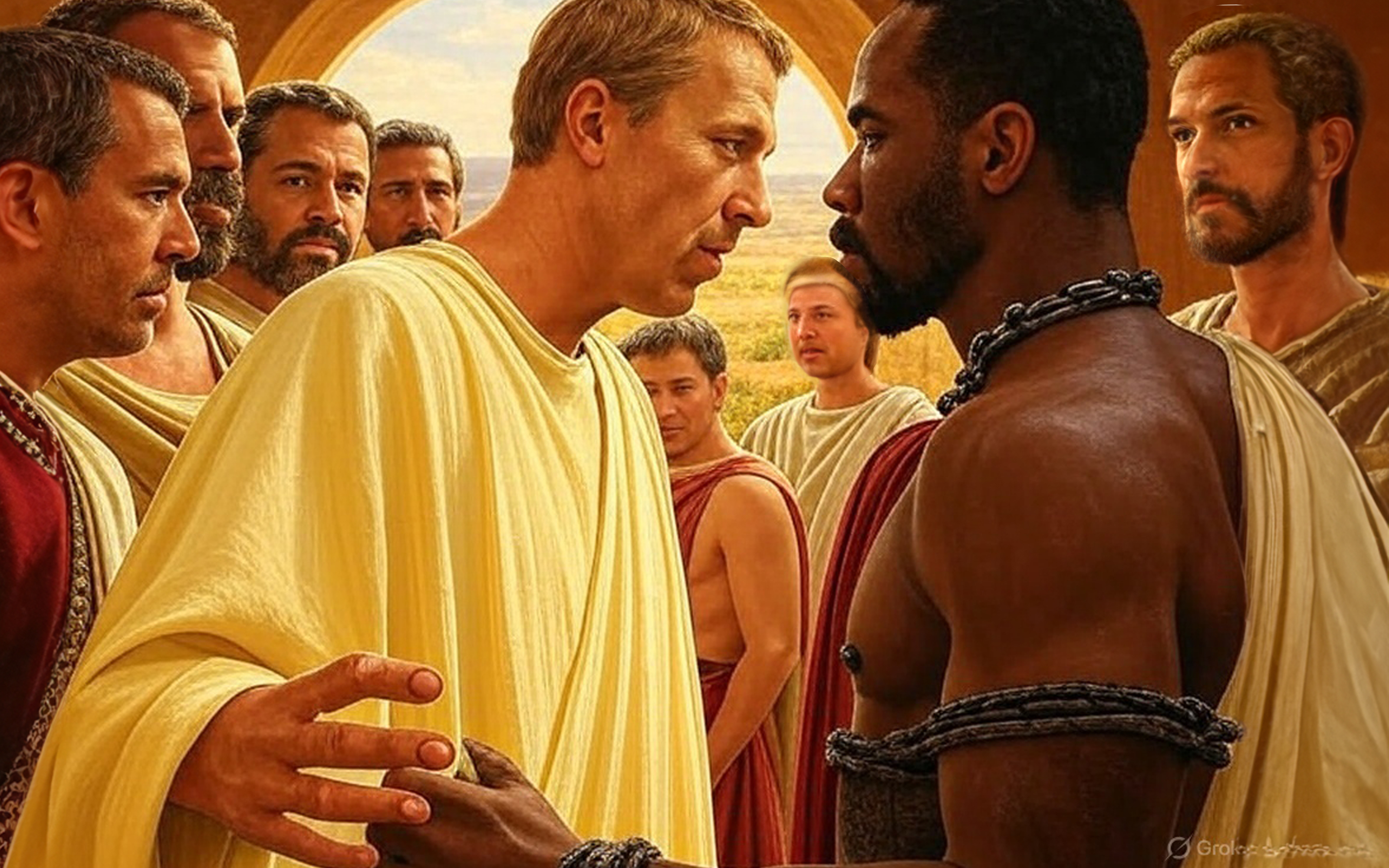
Kommentare
Das Alter hat ja doch Vorteile, man wird nicht nur weißer, sondern auch weiser.