Romanisierung damals – und Globalisierung heute

Die berühmte Romrede des Aelius Aristides demonstriert, wie stark bereits die antike Welt miteinander verflochten war. Besonders gut zeigt dies folgender Auszug:
„Wenn jemand die ganze Mittelmeerwelt sehen will, so muss er entweder den gesamten Erdkreis bereisen, um es auf solche Weise anzuschauen, oder in diese Stadt kommen, nach Rom. […] So zahllos sind die Lastschiffe, die hier eintreffen und alle Waren aus allen Ländern von jedem Frühjahr bis zu jeder Wende im Spätherbst befördern, dass die Stadt wie ein gemeinsamer Handelsplatz der ganzen Welt erscheint. Schiffsladungen aus Indien, ja – wenn man will – sogar aus dem „glücklichen Arabien“, kann man in solchen Mengen sehen, dass man vermuten könnte, für die Menschen dort seien fortan nur kahle Bäume übriggeblieben, und sie müssten hierherkommen, um ihre eigenen Erzeugnisse zurückzufordern, wenn sie etwas davon bräuchten.“
Und wenn bis heute auch die Frage nach dem Primitivismus oder vielmehr dem Modernismus der antiken Wirtschaft heiß debattiert bleibt, besteht doch kaum ein Zweifel daran, dass jenseits der engen wirtschaftlichen Interdependenz des griechisch-römischen Lebensraums auch bedeutsame Akkulturationsphänomene – also Fremdbeeinflussungen der ursprünglichen Kultur – nachweisbar sind. Diese führten zu einer zivilisatorischen „Globalisierung“ der griechisch-römischen Lebenswelt von Britannien nach Ägypten und von Hispanien bis nach Syrien. In den Zeiten des Hellenismus sogar bis weit in den Iran hinein.
Parallelen zur heutigen Amerikanisierung
Und schon damals war klar, dass man kaum von einer echten Globalisierung im Sinne eines gleichberechtigten Gebens und Nehmens sprechen konnte. Gerade im kulturellen Bereich stand die Vereinigung und Vereinheitlichung der Mittelmeerwelt genauso im Zeichen der Hellenisierung und der Romanisierung wie die der gegenwärtigen westlichen Welt mit ihren vielfältigen Ausstrahlungen nach Asien und Afrika hinein unter dem der Amerikanisierung.
Im 21. Jahrhundert hat sich die Globalisierung nämlich trotz des allmählichen Rückzugs des Westens und der Entstehung einer multipolaren Welt zur alles dominierenden Realität der internationalen Politik, Ökonomie und Kultur entwickelt. Der Nationalstaat scheint zu verblassen, kulturelle Identität wird zunehmend zur Frage des individuellen Geschmacks, wirtschaftliche Effizienz triumphiert über historische Bindungen. Es ist eine Entwicklung, die von den einen als Zeichen von Fortschritt, Offenheit und Modernität gedeutet wird, von den anderen als Indiz zivilisatorischen Verfalls.
Doch der historische Vergleich mit der Romanisierung im spätrepublikanischen und frühkaiserzeitlichen Rom zeigt: Globalisierung ist kein neues Phänomen. Auch Rom stand einst vor der Herausforderung, ein riesiges und ethnisch diverses Imperium durch zivilisatorische Standardisierung zu stabilisieren und dabei kulturelle Homogenisierung durchaus auch bewusst als strategisches Machtmittel einzusetzen.
Die Romanisierung als zivilisatorisches Projekt …
Die Romanisierung war eine Strategie der kulturellen Integration, die auf äußerst wirksame Weise politische Macht mit kultureller Hegemonie verband. Überall im Imperium entstanden römische Bäder, Tempel, Theater, Straßen, Foren, Aquädukte oder Verwaltungsgebäude.
Die lateinische Sprache verbreitete sich im gesamten Westen, während im Osten das Griechische weiter hegemonial blieb. Das römische Recht wurde schrittweise bis in die kleinsten Dörfer eingeführt, römische Kleidung, römische Esskultur und römische Architektur wurden zum Standard nicht nur der Elite, sondern zunehmend auch der Gesamtbevölkerung, wobei man freilich kaum genug betonen kann, dass jene römische Zivilisation in vielen, wenn auch nicht allen Aspekten, bereits ein oft vereinfachtes und verflachtes Resultat der in den früheren Jahrhunderten von griechischen Händlern und Kolonisten sowie von makedonischen Soldaten überall hin verbreiteten hellenistischen Weltkultur war.
Doch diese kulturelle Homogenisierung war kein spontaner oder wirklich einvernehmlicher Prozess. Sie beruhte nicht (nur) auf wechselseitigem Austausch, sondern auch und vor allem auf Hierarchie. Rom war das Zentrum, die Provinzen die Peripherie. Wer aufsteigen wollte, musste sich anpassen – nicht durch juristischen Zwang, aber doch durch starken sozialen Druck.
… oder als Teil der Sklaverei?
Die Kultur der Besiegten wurde somit Schritt für Schritt marginalisiert, ihre Traditionen zur Folklore degradiert oder mit einer römischen Fassade versehen, hinter der die ursprünglichen Inhalte oft zunehmend verblassten. Das römische Modell war universell – aber es war auch imperial und neben der Eroberung durch die Legionen ein wichtiger Vektor der Machtsicherung, wie etwa ein römischer Politiker wie Tacitus in der Biografie seines Schwiegervaters, des römischen Statthalters Agricola, durchaus kritisch eingestand:
„Der folgende Winter wurde mit äußerst zuträglichen Plänen verbracht. Um nämlich die Menschen, die verstreut und roh und daher leicht zum Kriege geneigt waren, an Ruhe und Muße durch Lustbarkeiten zu gewöhnen, ermutigte er sie persönlich zum Bau von Tempeln, Foren und Häusern und unterstützte sie dabei auf öffentlichem Weg, wobei er die Entschlossenen lobte und die Trägen tadelte: So herrschte wetteiferndes Streben um Ehre anstatt Zwang. Ferner ließ er den Söhnen der führenden Männer Unterricht in den freien Künsten zukommen, und zog das geistige Talent der Britannier dem Fleiß der Gallier vor, sodass diejenigen, die gerade noch die römische Sprache ablehnten, bald deren Beredsamkeit begehrten. Von da stand auch unsere Tracht in Ehre und die Toga war oft gesehen. Allmählich wurden sie zu den Lockungen von Lastern geführt, zu Portiken, Bädern und der Feinheit von Gastmählern. Und dies wurde von den Unkundigen ‚Zivilisation‘ genannt, während es in Wahrheit ein Teil der Sklaverei war.“ (Tacitus – Agricola, 21)
Globalisierung heute: das neue Imperium der Normen
In der heutigen westlichen Welt ist Ähnliches zu beobachten, auch und gerade auf dem „alten Kontinent“. Die europäische Integration wird nicht nur als politisches, sondern auch als kulturelles Projekt betrieben. Einheitliche Standards, Harmonisierung von Bildungssystemen, Sprachanpassungen, Rechtsangleichung – all das geschieht im Namen der Effizienz, der Vernetzung, der europäischen Idee, und strahlt in die gesamte Welt aus.
Doch der Preis ist hoch: Nationale Kulturen werden nivelliert, regionale Traditionen verschwinden, historische Eigenarten gelten als hinderlich. Doch vor allem: Die Vereinheitlichung nicht nur der Institutionen, sondern auch der Kultur findet wesentlich unter dem Einfluss der imperialen amerikanischen Leitkultur statt.
Die englische Sprache ist zur lingua franca, der Verkehrssprache nicht nur Europas, sondern bald der ganzen Welt geworden, und der amerikanisierte europäische Verwaltungsjargon ersetzt das gewachsene politische und literarische Vokabular der Nationalstaaten und dringt tief in den Alltag ein.
In der Musik, in der Werbung, in der Politik, in der Kunst, und natürlich auch in der Kleidung, der Lebensart und der Architektur herrscht mittlerweile eine ästhetische Homogenität, die an die römische imperiale Zeit erinnert. Und über allem steht eine neue, transnationale Oberschicht, die mobil, kosmopolitisch und englisch denkt – und die sich zunehmend von den kulturellen Tiefenstrukturen der Bevölkerung entfernt. Dies nicht nur in Europa oder anderen Teilen der westlichen Welt, sondern letztlich überall auf dem Globus, wo der amerikanische zivilisatorische und politische Einfluss längst die letzten Spuren europäischer kolonialer Ausstrahlung überlagert hat.
Weltzivilisation oder kulturelle Auslöschung?
Was ist davon zu halten? Auf der einen Seite ist die amerikanische Zivilisation nur eine verflachte Variante der englischen und damit letztlich europäischen Kultur. Wenn wir uns also beklagen, dass die Welt „amerikanisch“ geworden ist, so dürfen wir nicht vergessen, dass sie dadurch im Guten wie im Schlechten „europäischer“ geworden ist, und damit auch die zunehmend wachsenden Ressentiments jener, die bis in die nepalesischen Bergdörfer und afrikanischen Steppen ihre eigene Kultur zunehmend durch Netflix und TikTok zurückgedrängt sehen, sich nicht nur gegen die USA, sondern den gesamten Westen richten. Auch wenn viele US-kritische Europäer dies nur ungern zugeben möchten.

Auch die Kultur der Gallier, Iberer, Daker oder Numider wurde nicht völlig ausgelöscht, aber sie wurde auf ein dekoratives Beiwerk und die Trivialität des Alltags reduziert. Keltische Götter wurden in römische integriert, lokale Feste überformt, indigene Bauten abgetragen, lokale Sprachen schrittweise mit lateinischen und griechischen Lehnwörtern überformt.
So entstand eine Welt, die zwar formal geeint, aber innerlich entfremdet war, und zwar nicht nur an der Peripherie, sondern auch in jenen nicht-lateinischen Regionen Italiens, die lange Zeit zu eigenständigen Bundesgenossen zählten und nun nicht nur juristisch, sondern auch sprachlich zu Römern wurden, als ihre eigene Sprache ausstarb.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Auch die Globalisierung der Gegenwart kennt dieses Paradox. Sie verspricht Vielfalt und erzeugt Uniformität; sie feiert Differenz und produziert Gleichförmigkeit. Die kulturelle Diversität der Völker wird oft rhetorisch beschworen, aber in der Praxis unterlaufen: durch wirtschaftlichen Druck, sprachliche Dominanz, juristische Harmonisierung. Mode, Konsumgüter, Musik, Serien, Apps und Standards gleichen sich allesamt von Lissabon bis Tallinn, stammen direkt oder indirekt aus den USA und strahlen in die gesamte Welt aus.
Der Einzelne erlebt dies als Erleichterung und Entfremdung zugleich. Man kann sich überall zurechtfinden, aber nirgends wirklich zuhause fühlen. Die lokale Prägung verschwindet, die örtliche Identität wird zum Freizeitaccessoire, ein wenig wie die mehr als durchsichtigen Versuche McDonald’s, durch regionale „Sonderangebote“ örtliche Verwurzelung zu heucheln. Was bleibt, ist ein globales Netz von austauschbaren Lebenswelten: Das Etikett mag variieren, der Inhalt ist überall der gleiche – in den USA konzipiert, meist in China hergestellt.
Widerstand und Anpassung: zwei Seiten derselben Medaille
Wie in Rom zeigen sich auch heute ambivalente Reaktionen: Auf der einen Seite finden wir mächtige Eliten, die Globalisierung als Fortschritt feiern. Auf der anderen Seite entstehen gerade in Europa zahlreiche Bewegungen, die sich aus oft verschiedensten ideologischen Gründen dagegen wenden: Nationalisten, Regionalisten, Traditionalisten, selbst Ökologisten.
Im Rom der späten Republik und des Kaiserreichs war es ähnlich: Nicht nur die Barbaren an den Außengrenzen des Reichs oder jenseits des Limes, sondern manchmal auch aus dem Herzen der Mittelmeerwelt lehnten sich gegen die zivilisatorische Verflachung auf. Doch die Sogkraft des Zentrums war zu groß, und bezeichnenderweise äußerte sich selbst der Widerstand gegen die Globalisierung in einer Formensprache, die zunehmend römisch war. So wie jene patriotischen Blogger in ganz Europa und darüber hinaus, die sich – auf Englisch – gegen die amerikanische Weltkultur wehren.
Besteht eine Chance, zumindest in Europa eine gewisse zivilisatorische Vereinheitlichung zu erzielen, die unabdingbar dafür ist, zu einem gleichberechtigten und resilienten Zivilisationsstaat zu werden, der auch gegen China, Russland, die USA und Indien bestehen kann, ohne dafür die amerikanische Formensprache zu übernehmen und dadurch das gesamte Unternehmen im Voraus zu diskreditieren?
Verflachung der Sprache in der globalisierten Welt
Man wird es wohl so lange wie möglich versuchen müssen, ohne große Hoffnungen zu hegen. Eines aber dürfte jetzt deutlich sein: Was vor vielen Jahren einmal von dem Philosophen und Soziologen Ortega y Gasset in schauerlichen Worten als Endzustand der globalisierten und romanisierten Mittelwelt charakterisiert wurde, zeichnet sich auch heute wieder als Umriss abendländischer Spätzivilisation am Horizont der Geschichte ab:
„Doch das furchtbarste Zeugnis und System dieser ebenso einheitlichen wie geistlosen Lebensform, die sich über die ganze Weite des Imperiums verbreitete, finden wir in einem Bereich, in dem wir es am allerwenigsten erwartet hätten und in dem es auch – meines Wissens – bis jetzt noch von niemandem gesucht worden ist: in der Sprache. […] Bei den nicht hellenisierten Teilen des römischen Volkes herrschte ein Idiom, dem man den Namen Vulgärlatein gegeben hat und das die Mutter unserer romanischen Sprachen ist. […] Das eine […] Kennzeichen ist die – im Vergleich zum klassischen Latein – geradezu unglaubliche Vereinfachung des grammatischen Gefüges.“
Diese Vereinfachung führt leider dazu, dass die Sprache ihre Schönheit und ihren Glanz verliert – wie ein alte Münze:
„Es ist eine Sprache ohne Licht und Temperatur, ohne Überzeugungskraft, ohne seelische Wärme, eine trostlose Sprache, die ständig im Dunkeln tappt. Ihre Worte sind verschmutzt und kantig wie alte Kupfermünzen, denen man es anzusehen glaubt, dass sie des ewigen Kreislaufs durch die Mittelmeertavernen müde sind. Wieviele inhaltslos gewordene, trübselige, zu steter Alltäglichkeit verurteilte Existenzen ahnt man doch hinter diesem öden sprachlichen Machwerk! Das andere beelendende Merkmal des Vulgärlateins ist seine Uniformität.“
Zurück bleibt eine Sprache, die an ein trockenes, langweiliges Petrefakt – ein Fossil – erinnert:
„Natürlich steht fest, dass es Afrikanismen, Hispanismen und Gallizismen gab. Aber gerade dies besagt uns, dass der Grundstock der Sprache überall der Nämliche war, trotz der riesigen Entfernungen, trotz des geringen Austausches, trotz der Verkehrsschwierigkeiten, trotz des Fehlens einer Literatur […]. Wie aber hätte diese Übereinstimmung […] anders zustande kommen können als im Gefolge einer allgemeinen Verflachung, bei der das Dasein auf seine Elemente reduziert und die Einzelleben ihres Inhaltes entleert wurden. Das Vulgärlatein ruht in unseren Archiven als ein schaudererregendes Petrefakt als das Zeugnis einer Zeit, in der die Geschichte unter der uniformen Herrschaft des Vulgären dahinstarb […].“
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?


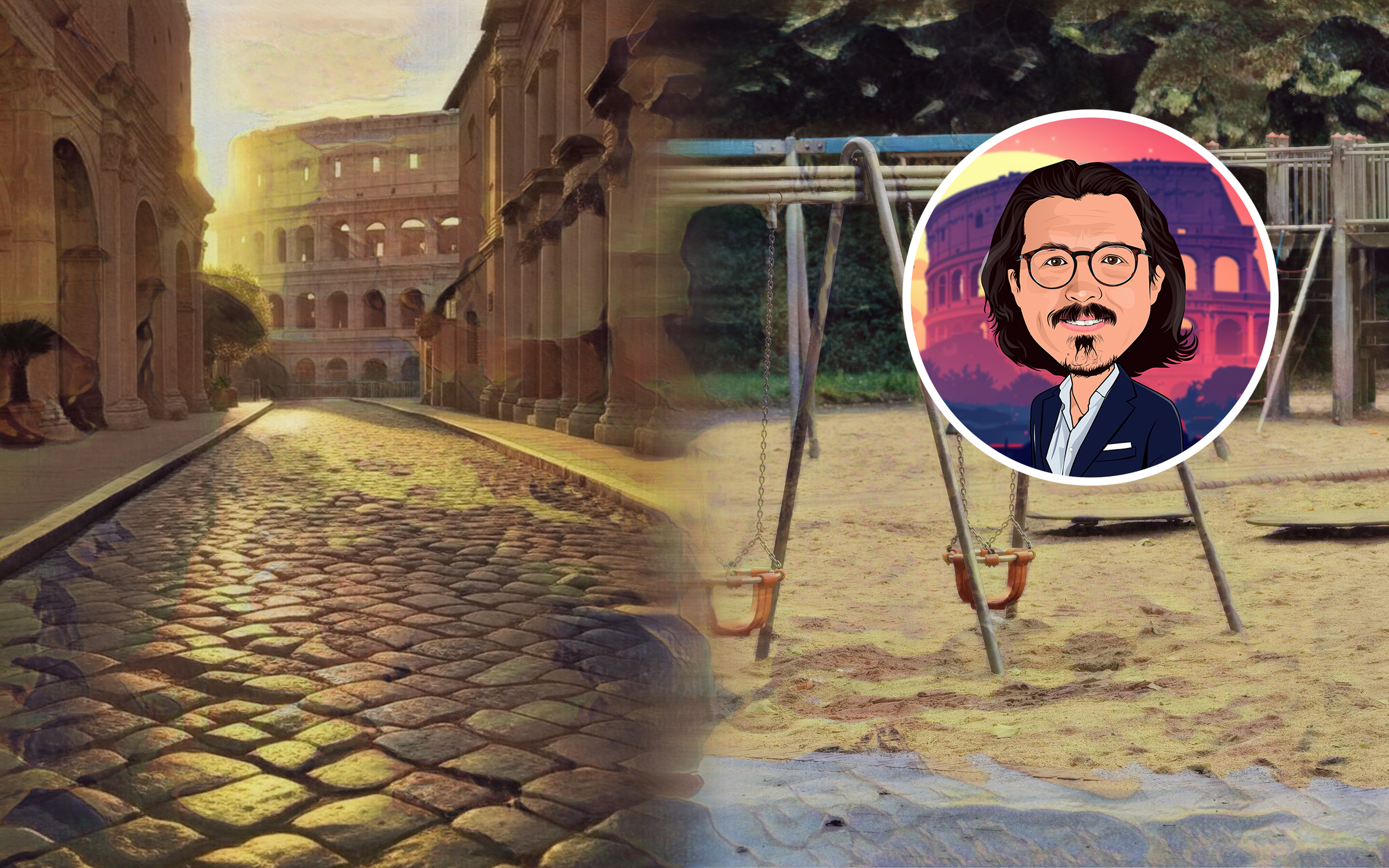

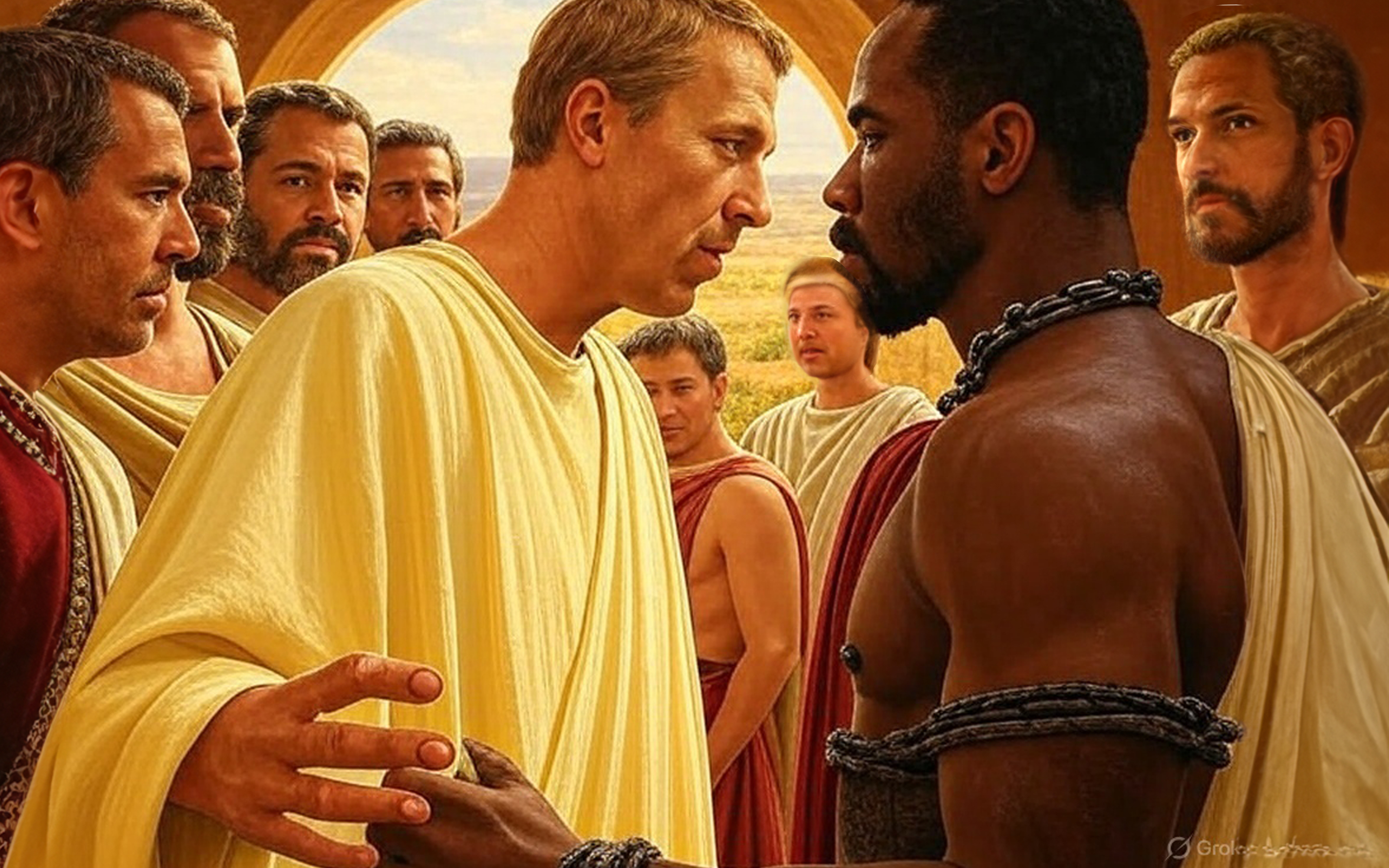

Kommentare
Aber was kam danach, bzw. noch unter der römischen Kaiserzeit? Unter dem Einfluss des Christentums sind seit dem 2./3. Jh. neue Literatursprachen geradezu explodiert: Syrisch und andere aramäische Dialekte (ganz wesentlich für die Überlieferung klass. gr. Literatur, v.a. im wissenschaftlichen Bereich! In Bagdad des 9. Jh. hätte man ohne die syrischen Übersetzer nix von den Griechen gewusst!), Armenisch, Koptisch, Gotisch; in Kleinasien ist ab dem 4. Jh. plötzlich Phrygisch wieder belegt. Wer sich näher mit bestimmten Überlieferungssträngen beschäftigt, z.B. kleinasiatischen Inschriften, wird die griechisch-römische Uniformität auch nicht zu sehr überbewerten.
Aber dass ich ggü. solchen 'Großerklärungen' wie hier ziemlich skeptisch bin, wird so mancher Mitleser auch schon bemerkt haben...
@Braunmüller Nachtrag: die angebliche Verflachung des Vulgärlateins ist schon, naja etwas Käse; das klassische Latein eines Caesar, Cicero, Tacitus, Seneca usw. war eine Literatursprache, die kein Mensch jemals gesprochen hat; im Grunde sind viel Erscheinungen des Vulgärlateins in der Spätantike bis in die römische Rep. zurückzuverfolgen. Und immerhin sind aus dem Vulgärlatein die italienischen Dialekte, Okzitanisch, Katalanisch, spanische, portugiesische, französische Literatursprachen entstanden.
Offen gestanden frage ich mich schon, was solche 'Argumente' eigentlich sollen. Mit Realitäten haben sie wenig zu tun.
Die deutsche Sprache in ihrer ganzen Höhe und Tiefe zu erhalten ist in der Tat ein gutes Werk an der Menschheit, schon allein weil so viele so wichtige und grundlegende Werke in ihr zuerst verfasst wurden.
Die einzige "Globalisierung", die ich befürworten würde, wäre die Einheit im Glauben. Doch selbst dann sollte die Verschiedenheit von Kulturen und Völkern erhalten bleiben. Alles andere wäre anthropologisch falsch (nicht dem Menschen entsprechend).
Dass die Welt dadurch, dass sie amerikanischer wird, auch europäischer wird, würde ich so nicht sagen. Aufschlussreich ist hier das Buch "Über die Demokratie in Amerika" von Alexis de Tocqueville. Er konnte als Zeitzeuge beide System miteinander vergleichen. Also Monarchie in Europa und Demokratie in Amerika. Schon damals waren fundamentale Unterschiede deutlich, vor allem, was die Mentalität betrifft. Bereits am Anfang der amerikanischen Gesellschaft hatte der Familienvater z. B. viel von seiner Autorität eingebüßt. Er war eher so etwas wie ein lieber und harmloser Großvater, den man nicht ernst zu nehmen braucht, wie Tocqueville sagt. Das ist ein "Detail", das ich schon bemerkenswert finde. Es hat sich jedoch mit Sicherheit auf die Dauer tiefgreifend ausgewirkt auf die Gesellschaftsstruktur und das Staatsverständnis der Amerikaner. Wäre es also nicht sinnvoller zu versuchen, das spezifisch Europäische wieder zu entdecken?
Die Frage "inwieweit ist die kulturelle Globalisierung eine gute, inwieweit eine schlechte Sache" ist eine interessante, d. h. eine, bei der die Antwort wohl eher schwer zu finden und facettenreich usw. ist.
Leider scheint mir hier der Autor, trotz einer ausführlichen und durchaus schön zu lesenden Beleuchtung des Untersuchungsgegenstands, an einer eigentlichen Antwort ("ich sage im großen und ganzen ja/nein, weil; aber, weil; und die Gesellschaft insgesamt sollte sich am besten so entwickeln, weil; aber, weil; und der Einzelne sollte dort, wo sie das nicht tut, das folgende tun, weil; aber, weil"... and that sort of thing, wie der hier erwähnte Amerikaner sagen würde) nicht wirklich, mit Verlaub, zu versuchen.
- Auch zu dem Zitat von Tacitus (aber, danke: Ich hatte vorher nicht gewußt, daß Tacitus da so etwas schreibt), daß die Zivilisation ein Teil der Sklaverei sei, wären ja die Fragen zu stellen: Tacitus sagt das, aber hat er auch Recht damit? Und, angesichts dessen, daß "Agricola" - so viel weiß ich davon - als Lob von Agricola gedacht ist, hat er das vielleicht eigentlich als Lob (geschickte Staatskunst, und "Sklaverei" vielleicht nur so etwas wie "Unterordnung unter die Obrigkeit") gemeint?
Zum Vulgärlatein sei noch gesagt, daß bei aller Wertschätzung für die Aeneis, die Metamorphosen und Orationes in Catilinam (und anderer toller Werke, die ich vergessen habe... Catull z. B.): es dürfte recht schwer fallen, auch nur ein einziges Werk der Antike zu nennen, dass nicht der Divina Commedia von Dante respektvoll den Vortritt lassen müsste, und die ist in einer Form des Vulgärlatein (namens Italienisch) geschrieben worden. Auch die Aeneis müsste. Und auch ganz spätes Latein wie "Jesu, spes poenitentibus, / quam pius es petentibus! Quam bonus te quaerentibus! Sed quid invenientibus?" (Vesperhymnus zum Namen Jesu; mit einem ganz unantiken Reim) ist durchaus sprachlich (nicht nur inhaltlich) nicht schlechter als große Hymnen der Antike. Ganz zu schweigen von Messe und Offizium von Fronleichnam; das hat ja auch ein Thomas von Aquin geschrieben. "Sumit unus, sumunt mille, quantum isti, tantum ille, nec sumptus consumitur. Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen inaequali: vitae vel interitus. Mors est malis, vita bonis: vide paris sumptionis quam sit dispar exitus." Cicero, Caesar, Sallust, Tacitus, Vergil, Ovid: verbeugen sie sich angesichts solcher Verse nicht auch sprachlich alle vor dem Meister?
Wieder ein intellektueller Hochgenuss aus dem man viele Erkenntnisse schöpfen kann. Viele Phänomene aus unserer Zeit lassen sich besser erklären, wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft.