Lebensermüdung und Gleichheitsdogma: Europas demografischer Verfall im Spiegel Roms
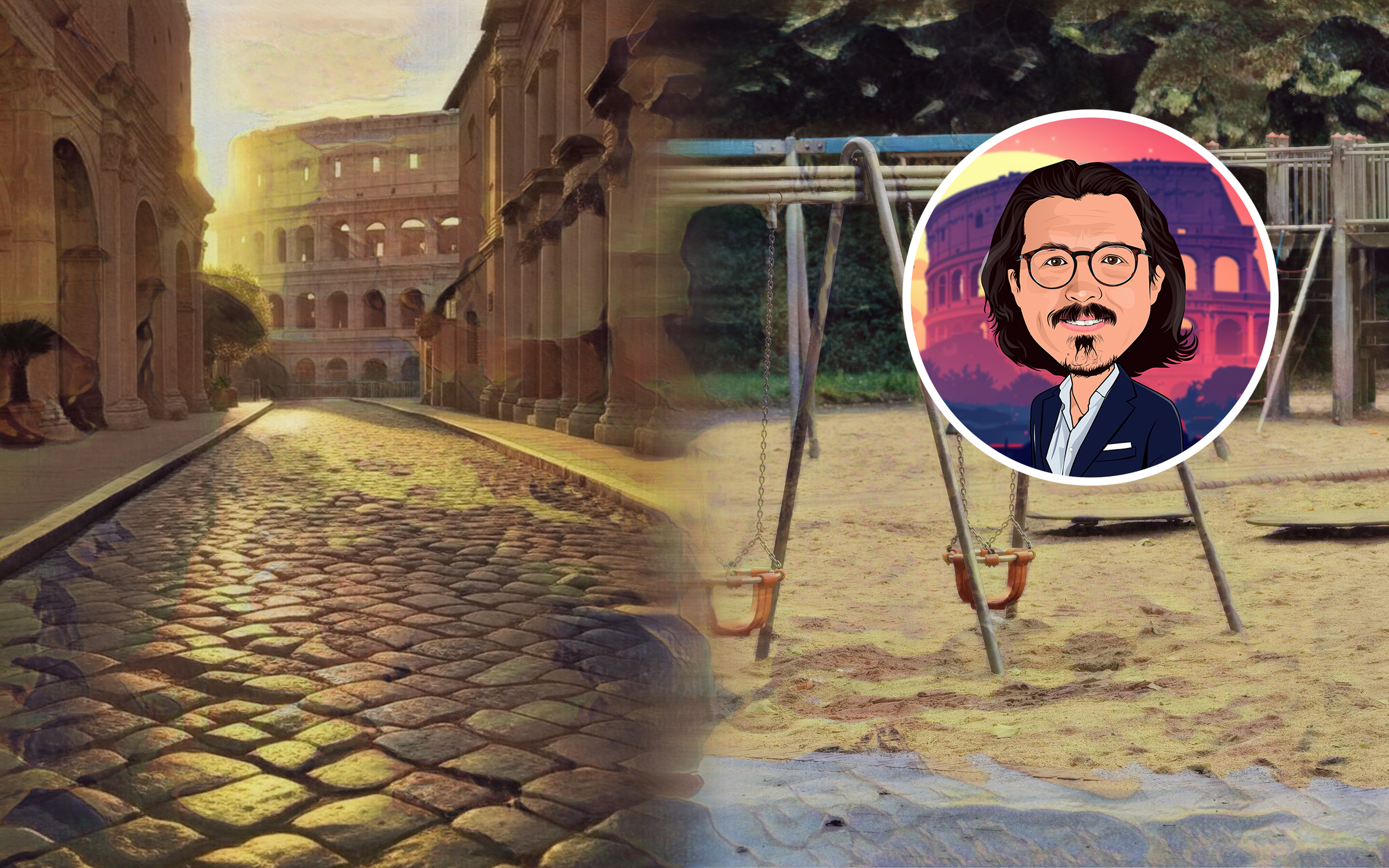
Europa altert und schrumpft, und ebenso seine Zukunft. Die Symptome sind bekannt: sinkende Geburtenraten, wachsende Kinderlosigkeit, überalterte Gesellschaften, zusammenbrechende Rentensysteme. Doch dieser Wandel ist nicht einfach ein zufälliges biologisches oder ökonomisches Phänomen – er ist Ausdruck einer tiefgreifenden kulturellen Krise.
Eine Krise, die schon einmal ein Imperium erschütterte: das spätrepublikanische Rom. Ein Vergleich der damaligen Entwicklungen mit der heutigen Situation in Europa offenbart frappierende Parallelen – und warnende Einsichten.
Der Kinderverlust als Zivilisationsphänomen
In der römischen Welt des 1. Jahrhunderts v. Chr. wurde die Geburtenrate zumindest der Oberschicht zu einem drängenden und viel besprochenen Problem. Schon Polybios (36,17) beklagte bereits im 2. Jahrhundert vor Christus die sinkende Kinderzahl der hellenistischen Kerngebiete und führte sie auf einen übersteigerten Individualismus zurück:
„Zu unserer eigenen Zeit (Ende 2. Jhd. v. Chr.) hat ganz Griechenland eine Kinderlosigkeit und überhaupt eine Bevölkerungsabnahme befallen, in deren Folge die Städte verödeten und das Land unfruchtbar wurde, obschon es doch bei uns weder langdauernde Kriege noch Seuchen gab [...]. Da die Menschen zu Hoffart, Habsucht und zu Gleichgültigkeit entartet waren, weder heirateten noch, wenn sie heirateten, ihre Kinder dann aufziehen wollten – im Höchstfalle eins oder zwei, um sie in Reichtum hinterlassen und in Üppigkeit aufziehen zu können –, darum nahm dieses Übel, ohne dass man es so recht gewahr wurde, schnell überhand.“
Gerade in Rom sollte diese Entwicklung nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch zum Problem werden. Ob es nun um die Rekrutierung der Bürgersoldaten ging, die privilegiert aus den mittleren und höheren Einkommensklassen eingezogen wurden, das immer asymmetrischere Verhältnis zwischen Einheimischen und zugewanderten Fremden oder die Destabilisierung der zunehmend kinderlosen Familien aus der politischen Nobilität: Der Bevölkerungsniedergang schien ein ernstzunehmender Faktor bei der Destabilisierung der römischen Republik.
Gesetze helfen nicht …
Kein Wunder, dass gerade Augustus Gesetze erließ, um dem entgegenzuwirken: Die leges Iuliae und die lex Papia Poppaea erschwerten Ehescheidungen, kriminalisierten Ehebruch und verpflichteten Senatoren, Ehen zu schließen und Kinder zu bekommen – andernfalls drohten Sanktionen. So soll Augustus in einer seiner Reden gesagt haben (Cass. Dio 56,7-8):
„Falls Euch dieses einsame Leben gefällt, so nicht, weil Ihr ohne Frauen leben würdet; kaum einer von Euch isst oder schläft ja allein: Was ihr begehrt, ist die freie Befriedigung all Eurer Triebe und Unarten. [...]. Ihr seht ja selber schon, wie sehr Eure Zahl die der verheirateten Bürger übersteigt, obwohl Ihr uns doch schon seit langem mindestens soviele Kinder gegeben haben solltet, wie Ihr selbst stark an Zahl seid. [...] Es wäre doch ein Frevel, eine Schandtat, wenn unser Volk untergehen würde, wenn der Name der Römer mit uns enden würde, wenn unsere Stadt den Fremden überlassen würde, etwa den Griechen, oder Barbaren. Soll es soweit kommen, dass wir unsere Sklaven nur noch deshalb freilassen, um die Bürgerschaft so groß wie möglich zu halten, und unseren Bundesgenossen das Bürgerrecht zugestehen, um unsere Bevölkerung zu vergrößern, während Ihr, Römer römischen Ursprungs, die Ihr mit Stolz die Marcii, Fabii, Quintii, Valerii, Julii zu Euren Vorfahren zählt, offensichtlich sowohl Euer Volk als auch seinen Namen untergehen lassen wollt?“
… der kulturelle Wandel war und ist stärker
Doch der kulturelle Wandel war stärker: Auch in der Kaiserzeit wurde die Ehe zunehmend als wirtschaftliche und gesellschaftliche Belastung empfunden. Zeitgenössische Autoren wie Tacitus und Plutarch berichteten daher zuhauf über römische Ehefrauen, die sich lieber von ihren Ehemännern scheiden ließen, als sich dem Mutterdasein zu unterwerfen.
Die matrona Romana verlor ihren Stellenwert, der Nachwuchs galt als hinderlich für persönliche Ambitionen. Viele Angehörige der Oberschicht zogen es vor, in komfortabler Kinderlosigkeit zu leben, während die ärmeren Schichten zwar mehr Kinder hatten, aber kaum gesellschaftlichen Einfluss ausübten.
› Lesen Sie auch: It’s the demography, stupid
Europa erlebt heute eine ähnliche Entwicklung. Trotz großzügiger Familienförderung, Elterngeld, Krippenausbau und Gleichstellungsmaßnahmen bleibt die Geburtenziffer weit unter dem Bestandserhalt. In weiten Teilen Westeuropas liegt sie bei 1,4 Kindern pro Frau – zu wenig, um eine Gesellschaft stabil zu erhalten.
Selbst in Ländern wie Ungarn, das große Summen in die Steigerung seiner katastrophalen Natalität investiert hat, bleiben positive Resultate letztlich aus: Zu stark ist auch hier der Wunsch nach „Selbstverwirklichung“, denn Kinder gelten überall als individuelle Option, nicht mehr als gesellschaftliche Selbstverständlichkeit. Die Vorstellung, dass es eine Pflicht zur Weitergabe von Leben und Liebe geben könnte, ist weitgehend verschwunden.
Die Auflösung der Familie
Was sind die Gründe dieser Entwicklung? In Rom war die familia einst das Rückgrat der Gesellschaft und umfasste nicht nur Vater, Mutter und Kinder, sondern auch Sklaven, Klienten und Verwandte. Der pater familias hatte absolute Autorität, seine Rolle verband Macht mit Verantwortung.
Doch mit dem Vordringen griechischer Philosophie, individualistischer Lebensentwürfe und wachsender sozialer Mobilität lösten sich diese Strukturen allmählich auf. Scheidungen wurden häufig, Ehen temporär, sexuelle Verfügbarkeit omnipräsent, die Autorität des Vaters nur noch eine vage Erinnerung an eine archaische Vergangenheit. Pompeius, Cicero oder Caesar – sie alle ließen sich aus politischem Kalkül scheiden, viele Senatoren wechselten mehrfach die Ehepartner, sei es aus erotischen, emotionalen oder strikt bündnispolitischen Gründen. Die Familie wurde zur Zweckgemeinschaft – nicht zur Lebensaufgabe.

In Europa hat sich spätestens seit den 1960er-Jahren ein ähnliches Bild entwickelt, auch wenn das Phänomen der Ehescheidung natürlich schon seit dem 19. Jh. zu einem vieldiskutierten Thema geworden war. Die klassische Kernfamilie verliert seitdem immer weiter an Bedeutung; Patchwork-Modelle, kinderlose Partnerschaften, Alleinlebende und „digitale Nomaden“ prägen das Bild.
Die Ehe wird als rechtlich-kulturelles Modell entkernt, die Elternschaft zur privatisierten Entscheidung, und die Einführung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und der „Ehe für alle“ entzieht die Ehe schließlich ganz ihre naturrechtliche Grundlage. Was einst Generationen verband, wird heute als Risiko, als Einschränkung, als Option auf Zeit betrachtet. Die Familie als grundlegende soziale Institution befindet sich in einem Zustand fortschreitender Erosion.
Der Rückzug ins Private
Ein zentrales Merkmal beider Epochen ist somit der Rückzug ins Private. Im Rom des späten 1. Jahrhunderts v. Chr. verloren die republikanischen Tugenden – Pflicht, Opferbereitschaft, Dienst an der res publica – an Strahlkraft; stattdessen blühten Epikureismus und Skeptizismus: Die Philosophie riet zur Weltabgewandtheit, zum otium cum dignitate.
Die römische Elite zog sich in ihre Villen zurück, diskutierte über Ethik oder Kunst, kümmerte sich aber wenig um die Zukunft des Staates, der immer mehr mit Populismus, Bürgerkrieg, Demagogie, unsauberen Finanzgeschäften und schmutzigen Händen gleichbedeutend schien.
Auch das heutige Europa erlebt eine solche Entpolitisierung des Einzelnen: Während die Öffentlichkeit, das Vereinsleben, der Sport politisiert wird, sinkt das politische Engagement des individuellen Bürgers, das Vertrauen in Institutionen bröckelt, das Interesse an Geschichte, Verantwortung und kollektiver Identität schwindet; stattdessen dominieren persönliche Optimierungsstrategien, Wellness, Selbstverwirklichung, Mobilität. Kinder, Familie, Bindung gelten dabei natürlich als Belastungen.
Die Überzeugung, dass das eigene Leben Teil eines größeren Ganzen sein könnte, schwindet, denn mit jenem ganz konkreten „größeren Ganzen“, als welches sich der spätzivilisatorische Staat konkret offenbart, möchte sich niemand mehr identifizieren.
Der Kult der Gleichheit
Dazu kommt ein gewisser Kult der Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Die späte römische Republik kannte natürlich keine vollständige Gleichheit, aber doch einen wachsenden emanzipatorischen Diskurs, durch den geschlechterspezifische Rollenvorgaben an Bindekraft verloren: Frauen genossen zunehmende wirtschaftliche Selbstständigkeit, hielten Gerichtsreden, brachten sich in die politischen Entscheidungen ihrer Männer ein, überließen die Kindererziehung den Sklaven und spielten sexuell eine immer eigenständigere Rolle, wie die römische Dichtung dieser Zeit umfassend und detailliert beschreibt – eine Entwicklung, der von den Moralisten eine zentrale Mitschuld am Verfall des klassischen Familienideals gegeben wurde.
› Lesen Sie auch: Europa: Ein Kontinent der aussterbenden Völker
Auch heute erleben wir ein ähnliches Phänomen: Ein übersteigertes Gleichheitsdenken, das jede funktionale oder biologische Differenz zwischen Mann und Frau nicht nur auflöst, sondern geradezu politisch verdächtig macht. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die spezifischen Rollen von Mutter und Vater, die Bedeutung von Generationenfolge und natürlicher Abhängigkeiten – all das wird relativiert, geleugnet oder in eine rein wirtschaftlich-finanzielle Quantifizierung übersetzt.
Gleichheit wird nicht mehr als politisch-moralisches Ideal verstanden, sondern als anthropologische Fiktion: alle Menschen sind gleich, immer, überall, in allem. Die Konsequenz ist eine Anthropologie der Austauschbarkeit – der Mensch als geschlechts- und beziehungslose Entität.
Die Instrumentalisierung des Lebens
Wer von sinkender Geburtenrate in einer hochsexualisierten Welt spricht, spricht auch von Verhütung und Abtreibung – und hier gilt es direkt zu betonen, dass es auch in diesem Bereich eher um die persönliche Bereitschaft zur Tat als um die konkrete Technologie geht. In der Antike wurden unerwünschte Neugeborene schon immer ausgesetzt; ein sozial akzeptiertes, wenn auch von den Philosophen immer wieder hart kritisiertes Verhalten.
Noch einstimmiger war die Akzeptanz des Selbstmords, der als würdige Alternative zu einem Leben und Sterben in Armut oder Krankheit idealisiert wurde. Seit dem spätrepublikanischen Rom scheint das Leben allerdings noch mehr als zuvor funktionalisiert worden zu sein: Der Zerfall der Familie brachte ebenso wie die extreme soziale Polarisierung und das entmenschlichte Leben in einer gigantischen Metropole eine noch größere Kaltherzigkeit mit sich sowie verschiedenste Techniken zum Abbruch unerwünschten Lebens, wie etwa Iuncus illustriert (frg. A,12-14):
„Wenn aber etwa einen gealterten Mann auch noch Armut treffen sollte, dann dürfte jener selbst wünschen, endgültig aus dem Leben scheiden zu dürfen wegen der Schwierigkeit mit allem: weil er keinen Wegführer findet, keinen, der ihn füttert, (weil er) nicht ausreichend Kleidung an sich trägt, kein Dach (über dem Kopf) besitzt, keine Nahrung, möglicherweise auch einen entbehrt, der für ihn Wasser schöpft. Die, die ihn sehen, auch wenn sie sich Freunde und Mitbewohner nennen, halten ihn für lästig und für einen schmerzlichen, armseligen und (allzu) lange dauernden Anblick.“
Kein Wunder, dass es gerade in jener Zeit war, dass die jüdische (und später christliche) Botschaft von der unbedingten Erhaltung des Lebens so großen Wiederhall als einzige ehrliche Antwort auf die menschliche Misere fand.






Kommentare
Das ist alles sehr lesenswert und nachvollziehbar, aber was könnte Politik, Kirchen - Gesellschaft tun, um solche Prozesse umzukehren? Oder müssen wir uns einfach damit abfinden, spätes Rom zu sein?
@Ulrich Paul Schmalz Oder müssen wir uns einfach damit abfinden, spätes Rom zu sein?
Wir sind es nicht. Jede Epoche steht unmittelbar zu Gott (Ranke). Der Autor beschreibt eine Umbruchsphase innerhalb der römischen Geschichte von einer aristokratischen Republik zu einer Militärdiktatur, wobei man in der Zusammenschau der politischen Publizistik des Herrn Engels, die als eine historische Publizistik verbrämt wird, für Letztere eine deutliche Sympathie erkennen kann.
Hier werden Symptome des zwingenden Verfallsprozesses beschrieben, den der zitierte Polybios bezüglich der Anakyklosis, dem sich gesetzmäßig vollziehenden Wechsel guter und schlechter Verfassungen, zuschreibt. Wenn man etwas daraus für heute lernen kann, dann ist das aktuell der Wechsel von der Demokratie zur Ochlokratie. Dafür muß man nicht das alte Rom bemühen. Das haben wir hierzulande zuletzt vor etwa hundert Jahren gehabt und jeder weiß wohin das geführt hat. Bei Polybios liest sich das so:
„Der eigentliche Umschlag wird jedoch durch die Schuld des Volkes herbeigeführt, wenn dieses durch die Habsucht der einen sich beeinträchtigt glaubt, während der Ehrgeiz der anderen, seiner Eitelkeit schmeichelnd, es zum Übermut verführt.
Im Zorn wird es sich dann erheben, wird bei allen Beratungen nur seiner Leidenschaft Gehör geben, wird denen, die an der Spitze des Staates stehen keinen Gehorsam mehr leisten, ja nicht einmal mehr Gleichberechtigung zugestehen, sondern in allem das Recht der Entscheidung für sich fordern.
Wenn es dazu kommt, wird sich der Staat mit den schönsten Namen schmücken, nämlich mit den Namen der Freiheit und der Demokratie (τὴν ἐλευθερίαν καὶ δημοκρατίαν); aber in Wirklichkeit wird er die schlimmste Verfassung haben, nämlich die Ochlokratie“
Polybios, Geschichte, VI, 57
@Wolfgang R. Hier wird zwar gescheit über den Verfassungskreislauf bei Polybios dahergeredet, aber dabei vergessen, dass Polybios den Verfassungskreislauf in republikanischen Rom aufgrund der Mischverfassung nicht mehr (!) als wirkmächtig angesehen hat.
Hier stimmt doch so gut wie nix zusammen.
Es ist erschreckend, dass ein professioneller (?) Historiker der Propaganda und den Tendenzen in den Quellen, mit denen er zu arbeiten hat, derart auf den Leim gehen kann...
Die Klagen der Eliten oder derer, die sich selbst dafür halten, sind anscheinend seit tausenden von Jahren dieselben.
@Braunmüller Unabhängig wie man dazu steht, mein Büro befindet sich in einem Stadtteil einer Großstadt in dem man eine Sozialstudie anfertigen kann, die die Thesen von Prof. Engels bestätigt. Es genügt auch wachen Auges durch die Straßen zu gehen.
Der Prozeß ist nicht mehr umkehrbar.
Europa und ganz besonders die EU hat sich entschlossen, ohne den Gott der Bibel zu leben. Die Kirchen
spielen dieses Spiel ganz bewußt mit. Die Freikirchen wachsen zwar, aber es sind ihrer zu wenige (ca. 2 % der Bevölkerung). Papst Benedikt der XVI. ahnte schon damals: in einem Europa ohne Gott wird es dunkel werden.
Gott sagt in seinem Wort, der Bibel ganz klar: Dein (des Menschen) Wille geschehe.
Den Rest gibt uns die ungebremste (gewollte?) Migration von fremden Kulturen, wie damals dem Römischen Reich.
@Helmut Becker Den Rest gibt uns die ungebremste (gewollte?) Migration von fremden Kulturen, wie damals dem Römischen Reich.
Lustig, wenn sich gerade die Nachfahren der damaligen -- im Übrigen meist sogar schon längst christlichen -- 'Migranten' echauffieren und so tun, als hätte es nach dem Ende des weströmischen (!) Reiches keinerlei Fortentwicklung mehr gegeben und als ob das römische Reich ein ethnisch und kulturell homogener Nationalstaat gewesen sei.
Um es mal ganz spöttisch zu sagen, es hindert ja niemand diejenigen die so schlau sind und so gescheit daher reden und wissen warum das Abendland untergeht, sich ans Werk zu machen und viele, viele Kinder zu kriegen, bzw wenn das wegen Alter und Alleinsein nicht geht, diejenigen zu unterstützen die eben noch Kinder haben. Aber diese Kinder da, die machen ja Dreck, Unordnung, Lärm und das über Jahre hinweg, das wollen wir ja nicht, da kann man so schlecht bei denken!
P.S ich hatte einmal einen Band Predigten von Pater Leppich SJ "Predigten auf der Reeperbahn" herausgegeben 1963 und darin beklagt er, dass Leute die z.B eine Wohnung zu vermieten haben und von sich selber denken gut katholisch zu sein, selbige natürlich lieber an das ruhige Ehepaar ohne Kinder, als an das mit drei Kindern vermieten.
Ja weil wenn die mit den Kindern ausziehen dann muss man soviel reparieren und überhaupt wenn die Mutter ja nicht arbeitet, wer weiß ob da die Miete auch pünktlich kommt und überhaupt haben die ja eh kein Geld bei so vielen Kindern, und was sollen die Nachbarn denken, wenn die Haustür ständig offen steht und dann noch ein Kind kommt...........
Bischof Dyba sprach übrigens von der doppelten Verweigerung der Verweigerung zuerst das Leben und dann den Glauben weiterzugeben, aber den mochte man ja nicht, der war ja nicht cool und eloquent, Ja dann!