Angst vor dem Kulturkampf

Vielleicht liegt es am berüchtigten „Sommerloch“, dieser politisch etwas inhaltsarmen Urlaubszeit, die Journalisten zwingt, jeden bereits abgenagten Knochen noch stundenlang zu einer wässrigen Suppe auskochen zu lassen.
Vielleicht ist die Besorgnis auch völlig ernst gemeint. Aber die entstandene These wirkt so dünn wie die Brühe. Aufgebracht hat die These die Zeitung Tages-Anzeiger. Sie lautet wie folgt: Dass Frauke Brosius-Gersdorf, die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin fürs deutsche Verfassungsgericht, vorerst nicht gewählt wurde, ist Ausdruck eines „Kulturkampfs“, der bald auch die Schweiz erreichen könnte. Was unbedingt zu verhindern sei.
Man könnte natürlich auch zu dem Schluss kommen, die aufgeschobene Wahl sei Ausdruck von Demokratie. Für die Kandidatin zeichnete sich die erforderliche Mehrheit eben nicht ab, und kein Kandidat hat ein Recht darauf, auch tatsächlich gewählt zu werden. Denn nicht von ungefähr ist der Zugang zum bundesdeutschen Höchstgericht durch eine Zweidrittelmehrheit abgesichert, um Schnellschüssen oder radikalen Minderheitenpositionen gesetzlich so weit wie möglich vorzubauen. Aber das wäre wohl zu einfach und würde die Angst vor dem, was angeblich kommen soll, beeinträchtigen. „Der Kulturkampf fordert erste Opfer in Europa“ klingt einfach weit knackiger als „In Deutschland wurde eine Kandidatin nicht gewählt“.
Annahmen und Behauptungen
Was aber hat nun eine gescheiterte Richterwahl in Deutschland mit einem in der Schweiz drohenden Kulturkampf zu tun? Dazu muss man sich zunächst einmal auf eine lange Gedankenkette einlassen, die so lautet:
In den USA sind Fake News, politische Polarisierung und der besagte Kampf der Kulturen längst Teil des politischen Alltags. Europa wähnte sich bisher frei davon, doch nun haben diese Unsitten auch hier Einzug gehalten. Und wenn das in Deutschland funktioniert, droht es sicherlich auch bald in der Schweiz.
› Lesen Sie auch: Brosius-Gersdorf: Vier Lehren aus der Richter-Pleite
Diese in den Raum gestellte Abfolge von Ereignissen ist ein schöner Beleg dafür, wie Medien funktionieren. Sie treffen eine Reihe von Annahmen, stellen Behauptungen an, beurteilen Vorgänge aus ihrer eigenen politischen Warte – und leiten danach daraus mögliche Auswirkungen ab.
Keine „Formalie“ mehr
Annahme 1 ist, dass, wie in der Zeitung behauptet, die Kandidatin fürs Verfassungsgericht „zum Ziel einer Hetzkampagne“ geworden sei. Die „Hetze“ ergab sich demnach aus kritischen Reaktionen auf politische Positionen von Brosius-Gersdorf. Und eine Kampagne war es, weil diese Reaktionen von diversen Absendern kamen. Beides ist eine Überdehnung dessen, was wirklich geschehen ist. Selbst wenn vereinzelt Fehlinterpretationen von Aussagen der Kandidatin kursiert haben sollten: Ihre politische Linie und ihre gesellschaftliche Haltung ergaben sich aus dem Gesagten zweifelsfrei, und nur weil mehrere Kritiker auftreten, haben wir noch keine „Kampagne“.
Zudem wächst bei der Lektüre die Sehnsucht nach dem angeblich gefährlichen „Kulturkampf“ regelrecht. Da wird festgestellt, bisher sei die Wahl ins Bundesverfassungsgericht „eine Formalie“ gewesen, nun machte sie Schlagzeilen. Es ist ja vielleicht nicht ganz schlecht, dass die Bestellung des höchsten Gerichts in Deutschland nicht länger eine „Formalie“ ist, die man einfach durchwinkt, sondern sich die Beteiligten Gedanken darüber machen, wen sie wählen und wen nicht.
› Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge
Aber diese vom Gesetzgeber so vorgesehene demokratische Auseinandersetzung ist nun offenbar Grund zur Panik. „Der Fall sollte auch hierzulande alarmieren“, schreibt der Tages-Anzeiger. „Wenn der Kulturkampf aus den USA bereits Deutschland erreicht hat, ist auch die Schweiz nicht mehr weit weg.“
Kulturkampf als Basis für die Schweiz
So unangenehm der Begriff „Kampf“ friedlichen Zeitgenossen auch sein mag: Wer eine Ahnung von der Schweizer Geschichte hat, sieht den Kulturkampf – der Begriff taucht im Artikel sechs Mal auf – etwas entspannter. Ein solcher führte 1847 zum sogenannten Sonderbundskrieg, dem letzten Mal, dass innerhalb der Schweiz militärisch gekämpft wurde. Das Ergebnis war nicht so übel: Daraus entstanden die erste Bundesverfassung und die Schweiz als moderner Bundesstaat.
Dachte man früher bei Kulturkampf stets an eine Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche, wurde der Begriff später auf Kontroversen zwischen allen möglichen Lagern mit unterschiedlichen Werten und Haltungen ausgeweitet. In der Schweiz spielten sich solche historisch betrachtet zwischen Konservativen und Liberalen ab. Beide gibt es nach wie vor. So gesehen befinden wir uns bis heute permanent im Kulturkampf. Denn worin sollte der Sinn einer Demokratie bestehen, wenn nicht jede Seite versuchen würde, für ihre Sicht der Dinge eine Mehrheit zu finden?
Sich vor dem Kampf an sich zu fürchten, ist daher absurd. Was bleibt, ist die Frage, mit welchen Waffen dieser Kampf ausgetragen wird. Im Fall der Wahl ins deutsche Verfassungsgericht war diese Waffe letztlich ein demokratisches Verfahren. Die Behauptung, diese sei von einer „Hetzkampagne“ beeinflusst worden, ist die Interpretation eines Journalisten – die ihm dann als These für etwas dient, das er selbst vermutlich als großen philosophischen Wurf empfindet.
› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?


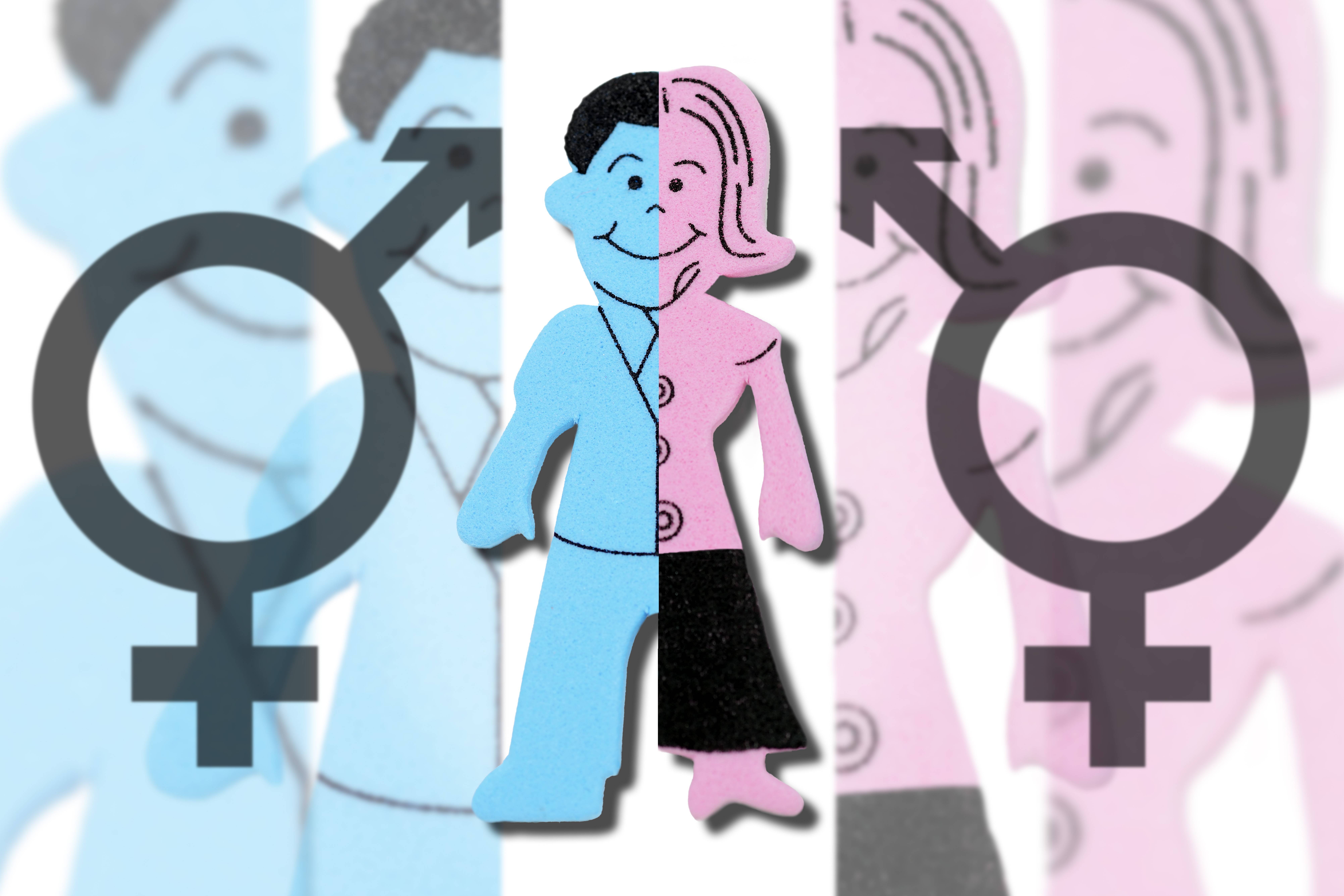

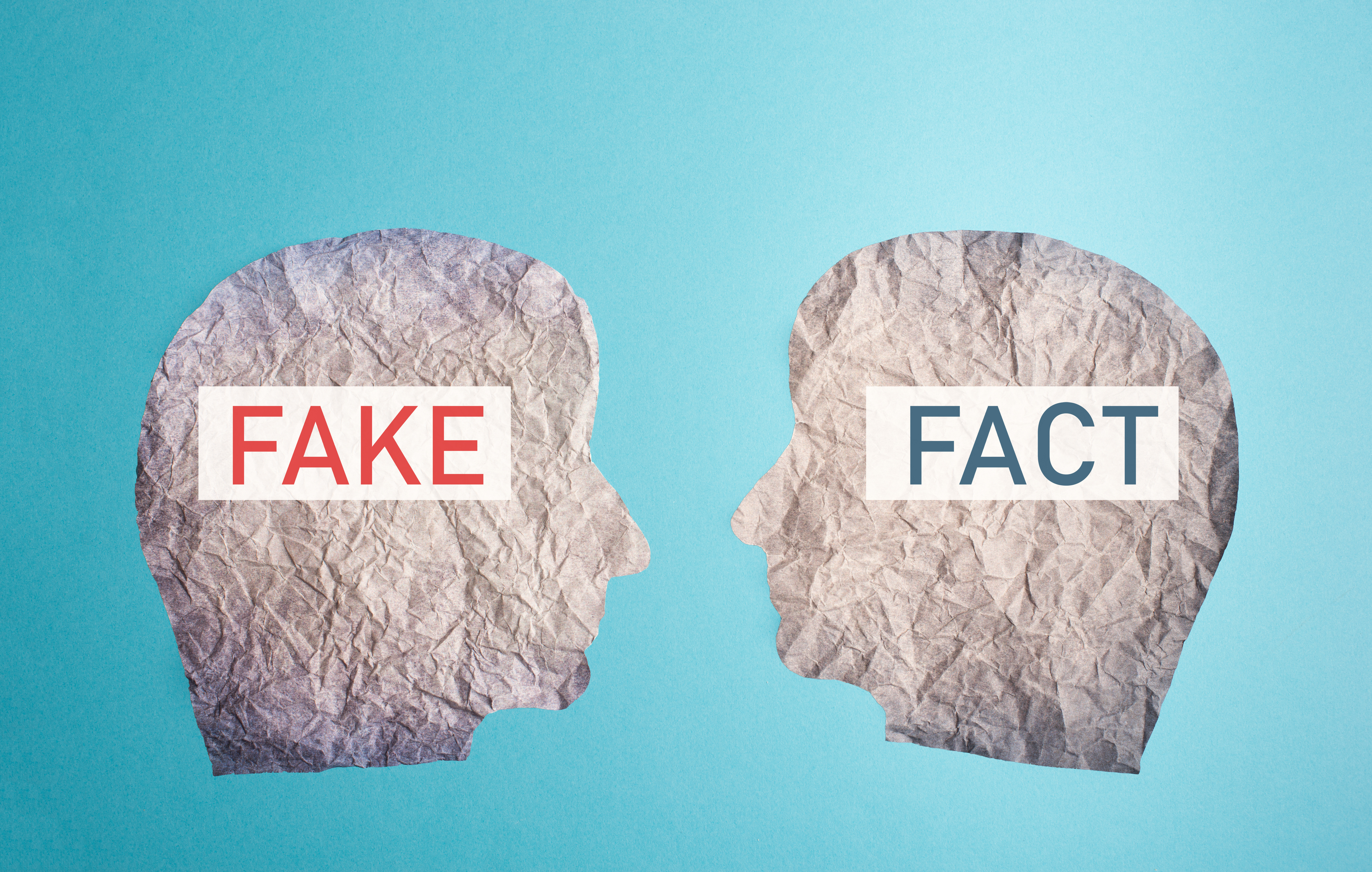
Kommentare